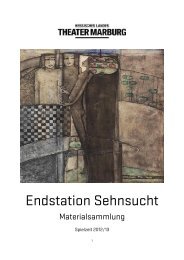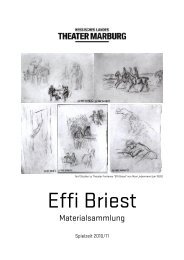Materialsammlung - Theater Marburg
Materialsammlung - Theater Marburg
Materialsammlung - Theater Marburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kafka und seine Mutter, undat.<br />
Das Urteil und<br />
andere<br />
Erzählungen<br />
<strong>Materialsammlung</strong><br />
Spielzeit 2012/13
Inhalt<br />
Franz Kafka<br />
Franz Kafka: oszillierende Negationen von Anna Glazova<br />
Liebeserklärung an Franz Kafka von Nicole Strecker<br />
Laughing with Kafka by David Foster Wallace<br />
Elf Söhne von Franz Kafka<br />
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn<br />
Heimkehr von Franz Kafka<br />
Josef K. und seine arabischen Söhne von Atef Botros (CNMS <strong>Marburg</strong>)<br />
Franz Kafka von Hannah Arendt<br />
Die aufgeklärte Welt im Zeichen ihres Unheils: Verdinglichung im Werk Kafkas von Marcus Hawel<br />
„Es wird gute Arbeit geleistet werden“ – „Kafkas Fabriken“ und sein Vertrauen in den technischen Fortschritt von Uwe Wittstock<br />
"Schraubenkönig" schockiert Mitarbeiter mit Drohbrief<br />
Von Kafka zu Gorbatschow von Norman Manea<br />
Stärker als alle Schwerkraft von Thomas Steinfeld<br />
Die Suche von Heike Faller<br />
"Kafka hatte schöne braune Augen" – Ein Anruf bei Alice Herz-Sommer von Oliver Das Gupta<br />
Born to be wild<br />
Unvollendetes: Der Kampf der Hände von Franz Kafka<br />
Literatur und Links
Prometheus<br />
Von Prometheus berichten vier Sagen: Nach der ersten wurde er, weil er die Götter an die Menschen verraten hatte, am Kaukasus<br />
festgeschmiedet, und die Götter schickten Adler, die von seiner immer wachsenden Leber fraßen.<br />
Nach der zweiten drückte sich Prometheus im Schmerz vor den zuhackenden Schnäbeln immer tiefer in den Felsen, bis er mit ihm eins<br />
wurde.<br />
Nach der dritten wurde in den Jahrtausenden sein Verrat vergessen, die Götter vergaßen, die Adler, er selbst.<br />
Nach der vierten wurde man des grundlos Gewordenen müde. Die Götter wurden müde, die Adler wurden müde, die Wunde schloß<br />
sich müde.<br />
Blieb das unerklärliche Felsgebirge. – Die Sage versucht das Unerklärliche zu erklären. Da sie aus einem Wahrheitsgrund kommt, muß<br />
sie wieder im Unerklärlichen enden.<br />
Franz Kafka
Franz Kafka<br />
geb. 3.7.1883 Prag (Tschechien)<br />
gest. 3.6.1924 Kierling bei Klosterneuburg (Österreich)<br />
Jura-Studium in Prag; im Herbst 1903 Bekanntschaft mit Max Brod, seinem lebenslangen Freund und späteren Herausgeber; 1906<br />
Promotion zum Dr. jur., 1906/07 gerichtspraktisches Jahr; 1907/08 Arbeit in der Prager Filiale der italienischen Versicherungsgesellschaft<br />
›Assicurazioni Generali‹; ab August 1908 Anstellung als Hilfsbeamter mit halbtägiger Dienstzeit an der ›Arbeiter- Unfall-Versicherungs-<br />
Anstalt‹ (AUVA) in Prag; von Oktober 1911 bis Januar 1912 regelmäßige Besuche von Vorstellungen der in Prag gastierenden<br />
ostjüdischen <strong>Theater</strong>truppe ›Jichzak Löwys‹; 1912 Begegnung mit der Berliner Angestellten Felice Bauer (umfangreicher Briefwechsel bis<br />
zur Diagnose einer Lungenerkrankung im Herbst 1917); 1919 kurzzeitige Verlobung mit Julie Wohryzek; 1920–1923 Beziehung zu der<br />
mit Ernst Pollak verheirateten Wiener Journalistin und Übersetzerin Milena Jesenská; Ende Juni 1922, nach wiederholten langen<br />
Beurlaubungen und Sanatoriumsaufenthalten, von der AUVA pensioniert; 1923 Bekanntschaft mit der Ostjüdin Dora Diamant, mit der er<br />
von September 1923 bis März 1924 in Berlin zusammenlebte; 1924 Sanatorium in Kierling bei Klosterneuburg, Tod durch<br />
Kehlkopftuberkulose; testamentarische Verfügung, den größten Teil seines literarischen Werkes zu verbrennen.
Franz Kafka: oszillierende Negationen von Anna Glazova<br />
I. Kafkas unmögliches Sein<br />
Daß es so viele verschiedene Interpretationen von Kafkas Werk gibt – und potenziell noch geben kann – weist darauf hin, wie offen seine<br />
Texte sind. Wie Heinz Politzer in „Kafka, der Künstler“ meinte, im Falle Kafkas verraten die Interpretationen mehr über den Interpreten<br />
selbst, als über den Autor und seine Intentionen. Diese Undefinierbarkeit der Texte Kafkas entsteht daraus, daß sie Fragmente sind, die<br />
niemals ein zusammenhaltendes Ganzes ergaben; oder sie sind nur so winzige Details dieses Ganzen, daß es nicht mehr<br />
wiederherstellbar ist. Das verbindende Prinzip geht verloren, und auf diese Weise nehmen die vereinzelten Fragmente an Bedeutung zu; wenn man<br />
an sie eine oder andere wohl strukturierte Fragen stellt, scheinen sie eine fremde, enigmatische, mysteriöse Antwort zu geben. Die vielen<br />
Möglichkeiten, Kafka zu lesen, entstehen aus der Unmöglichkeit für den Leser, sich auf eine hinreichende, endgültige Antwort zu beschränken: ist<br />
Gregor Samsa Mensch oder Käfer? Ist der Verurteilte in „In der Strafkolonie“ Hund oder Mensch? Ist Odradek ein Wesen oder ein Ding? Lebt der<br />
Jäger Gracchus oder ist er tot? Die Antwort erscheint unmöglich, denn sie lautet: beides.<br />
In einem Brief an Felice schrieb Kafka, er bestehe aus Literatur: Kafka war einer der Schriftsteller, deren Leben und Werk in einem engen<br />
Zusammenhang mitenander standen. Kafkas Biografie ist voll von Unmöglichkeiten. Eine davon (und vielleicht die ausschlaggebendste für Kafkas<br />
literarische Motivation) ist die Unmöglichkeit, oder das Weigern, sich von dem Einfluß der starken Vaterfigur zu befreien. Im Brief an den Vater läßt<br />
sich folgendes finden: „Es ist auch wahr, daß Du mich kaum einmal wirklich geschlagen hast. Aber das Schreien, das Rotwerden Deines Gesichts, das<br />
eilige Losmachen der Hosenträger, ihr Bereitliegen auf der Stuhllehne war für mich fast ärger. Es ist, wie wenn einer gehenkt werden soll. Wird er<br />
wirklich gehenkt, dann ist er tot und es ist alles vorüber. Wenn er aber alle Vorbereitungen zum Gehenktwerden miterleben muß und erst wenn ihm<br />
die Schlinge vor dem Gesicht hängt, von seiner Begnadigung erfährt, so kann er sein Leben lang daran zu leiden haben.“ (2, 138)<br />
Den Ödipuskomplex übertrieb[ii] Kafka bis zum Grad des verhängnisvollen lebenslangen Leidens, und alles Leiden, das ihm das Leben bereitete, diente<br />
der Inspiration. Seine Untauglichkeit für die Ehe erklärte er mit der ödipalen Angst vor dem Vater; jedoch wäre für Kafka eine Ehe eine untragbare<br />
Last, weil die Einsamkeit für ihn die unentbehrliche Voraussetzung des Schreibens war.<br />
In einem Brief an Max Brod spricht er über die Unmöglichkeiten im Leben eines deutsch-jüdischen Autors: die Unmöglichkeit nicht zu schreiben, die<br />
Unmöglichkeit auf deutsch zu schreiben, die Unmöglichkeit, anders als auf Deutsch zu schreiben und hier fügt er noch eine vierte dazu – die<br />
Unmöglichkeit zu schreiben überhaupt. (2) Am 5. Juli 1922 schrieb Kafka in einem Brief an Max Brod: „Was der naive Mensch sich manchmal<br />
wünscht: 'Ich wollte sterben und sehn, wie man mich beweint', das verwirklicht ein solcher [wie Kafka selbst] Schriftsteller fortwährend, er stirbt<br />
(oder er lebt nicht) und beweint sich fortwährend. [...] Die Gründe für die Todesangst lassen sich in zwei Hauptgruppen teilen. Erstens hat er Angst<br />
zu sterben, weil er noch nicht gelebt hat. Damit meine ich nicht, daß zum Leben Weib und Kind und Feld und Vieh nötig ist. Nötig zum Leben ist nur,
auf Selbstgenuß zu verzichten; einziehn in das Haus, statt es zu bewundern und zu bekränzen. [...] Der zweite Hauptgrund [...] ist die Überlegung:<br />
'Was ich gespielt habe, wird wirklich geschehn. Ich habe mich durch das Schreiben nich losgekauft. Mein Leben lang bin ich gestorben und nun werde<br />
ich wirklich sterben. [...] Ich selbst aber kann nicht weiterleben, da ich ja nicht gelebt habe, ich bin Lehm geblieben, den Funken habe ich nicht zum<br />
Feuer gemacht, sondern nur zur Illuminierung meines Leichnams benutzt.“ (3, 385)<br />
Als Kafka in seinem Sterbebett lag, verglich er sich mit den Blumen, die neben ihm standen: Er meinte, er wäre so wie sie – weder tot noch lebendig.<br />
Seine Krankheit hinderte ihn daran, sich ganz lebendig zu fühlen, wobei sie ihm auch keine Einsicht in das andere, den Tod, verlieh: „Wer einmal<br />
scheintot gewesen ist, kann davon Schreckliches erzählen, aber wie es nach dem Tode ist, das kann er nicht sagen, er ist eigentlich nicht einmal dem<br />
Tode näher gewesen als ein anderer, er hat im Grunde nur etwas Besonderes 'erlebt' und das nicht besondere, das gewöhnliche Leben ist ihm dadurch<br />
wertvoller geworden. (4)<br />
Die "Unmöglichkeit, Kafka zu sein" (5, 80), kam in verschiedensten Identitätsproblemen zum Ausdruck: nie war Kafka ganz Schrifsteller, weil er<br />
Beamter war; assimilierter Jude, schwärmte er für das jiddische <strong>Theater</strong>; trotz seiner Heiratsversuche starb er als Junggeselle; seine vegetarische Diät<br />
machte ihn auch in seinen Essensbräuchen auf Einsamkeit angewiesen; die Tuberkulose vervollständigte seine Ausgeschlossenheit. Kafka weigerte sich,<br />
eine einzige Identität anzunehmen. Er wollte die freie Wahl nicht verlieren, so schwankte er immer zwischen Möglichkeiten, ohne sich entscheiden zu<br />
können. Guy Davenport schreibt: "Reality is the most effective mask of reality. Our fondest wish, attained, ceases to be our fondest wish. Success is the<br />
greatest of dissapointments. The spirit is most alive when it is lost. Anxiety was Kafka's composure." (6, 16) Kafkas Schreiben war sein Un-Leben, das<br />
für ihn die Essenz des Lebens war: eine einsame Expedition an die Grenzen der Existenz, in die Bereiche, wo der sterbliche Körper keine Bedeutung<br />
mehr hat und die Abstraktionen regieren.<br />
II. Funktion statt Figur<br />
Die Gestalten, die Kafkas Oeuvre bewohnen, sind von der seltsamsten Körperlosigkeit. Die Körper sind dermaßen aufgelöst, daß die Figuren oft<br />
ausschließlich von der Kleidung oder dem Ersatz des Namen durch die angewiesene Funktion (wie der Reisende, der Offizier, der Soldat) bestimmt<br />
werden. Diese Figuren sind fast mathematisch trocken deklariert und unterliegen fast mathematischen Operationen: die Kreuzung wie Katzenlamm<br />
kann nur als eine Summe von abstrakten Eigenschaften aufgefaßt werden. Die Katze, das Lamm und der Mensch werden zu einem Ganzen, indem sie<br />
vom Körperhaften befreit werden.<br />
„In der Strafkolonie“ kann als ein Beispiel dieser Körperlosigkeit benutzt werden. Vom ersten Blick scheint es problematisch, zu behaupten, daß eben in<br />
der Erzählung, die von Tortur handelt, die Rede nicht vom Körper ist. Mark M. Anderson schreibt: „[...] the story's vivid, detailed presentation of<br />
torture and execution seemed so gruesome that some protection was felt to be needed against its literal meaning. [...] The story's pornological, sadomasochistic<br />
elements, its grotesquely playful presentation of torture and death [...] have repeatedly been avoided or treated only obliquely by critics
interested in the 'deeper' or 'higher' problems of grace, redemption, justice and the Law.“ (7, 174)<br />
Jedoch ist es nicht zweifellos, daß der sado-masochistische Genuß der wirkliche (oder der einzige) Sinn der Geschichte ist. Alles Leiden, das die<br />
Hinrichtung dem Verurteilten bereitet, wird nur in der Form von Funktionsbeschreibungen der Maschine (fast in der Form von einer<br />
Gebrauchsanweisung, jedoch zu einem höchst ungewöhnlichen Gerät) angedeutet. Als einziger Ausdruck von Schmerz ist das Stöhnen zu vernehmen,<br />
aber es wird durch den speziell dafür eingebauten Filz gedämpft und durch die Geräusche der arbeitenden Maschine verdeckt. Die Körper sind kaum<br />
beschrieben. Vom Verurteilten weiß man nicht, ob er eigentlich ein Mensch oder doch ehe ein Hund ist, da er auf allen Vieren in der Wüste herumläuft,<br />
sich sein Leben lang "von stinkenden Fischen"(9, 161) nährt, und wenn er das einzige Mal den Mund öffnet, um etwas zu sagen, dann heißt es: "Wirf<br />
die Peitsche weg, oder ich fresse dich." (Hervorhebung AG). Der Offizier besteht größtenteils aus seiner Uniform; zieht er sie aus, so verliert er seine<br />
Funktion und ist gleich tot. Die Hauptfiguren wechseln ständig ihre Funktionen untereinander. Zum Beispiel plante Kafka in einer Skizze für „In der<br />
Strafkolonie“, daß der Reisende sich in einen Hund verwandelt: „Der Reisende fühlte sich zu müde, um hier noch etwas zu befehlen oder gar zu tun.<br />
Nur ein Tuch zog er aus der Tasche, machte eine Bewegung als tauche er es in den fernen Kübel, drückte es an die Stirn und legte sich neben die<br />
Grube. So fanden ihn zwei Herren, die der Kommandant ausgeschickt hatte, ihn zu holen. Wie erfrischt sprang er auf, als sie ihn ansprachen. Die<br />
Hand auf dem Herzen, sagte er: 'Ich will ein Hundsfott sein, wenn ich das zulasse.' Aber dann nahm er das wörtlich, und begann auf allen Vieren<br />
umherzulaufen. Nur manchmal sprang er auf, riß sich förmlich los, hängte sich einem der Herren an den Hals und rief in Tränen: 'Warum mir das<br />
alles' und eilte wieder auf seinen Posten.(8) Hier übernimmt der Reisende die Funktion, die am Anfang der Erzählung dem Verurteilten zugewiesen<br />
war: "Übrigens sah der Verurteilte so hündisch ergeben aus, daß er den Anschein hatte, als könnte man ihn frei auf den Abhängen herumlaufen lassen<br />
und müsse bei Beginn der Exekution nur pfeifen, damit er käme." (9, 143) Somit wanderte der "Hund" vom Verurteilten zum Offizier, vom Offizier<br />
zum Reisenden.<br />
Nicht weniger interessant ist der Rollentausch zwischen dem Offizier und dem Apparat. Als der Offizier sich unter die Egge legte, übernahm er die<br />
Rolle des Verurteilten. Der Apparat selbst übernimmt sofort die Rolle des Offiziers – es wäre die Aufgabe des Offiziers, die Maschine zu starten,<br />
diesmal aber fängt sie von selbst an zu arbeiten. Und indem sie arbeitet, plötzlich sehr still, übernimmt sie dem Offizier auch seine Selbstmord-<br />
Absicht. Der Offizier erreicht nicht den erlösenden Freitod, den er sich gewünscht hatte, er ergibt sich der Maschine, und die Maschine erwirbt<br />
plötzlich das Vermögen, Entscheidungen zu treffen, und tötet sich. Der Offizier wird in diesem Augenblick zu einem Detail der Maschine, nicht zum<br />
Objekt, sondern zum Subjekt der Tortur, die Maschine tötet den Offizier nebenbei, als ein Stück von sich selber, in ihrem Selbstmordverfahren. Die<br />
Funktionen (wie Hund oder Hinzurichtender) bestehen, es wechseln sich nur die Variabeln (der Verurteilte, der Offizier, der Reisende) und ihre<br />
Konstellationen aus.<br />
Es gibt viele Beispiele von solchen, ihren Platz wechselnden Funktionen. In „Ein Landarzt“ verschwindet Rosa, das Dienstmädchen, im Haus des<br />
Arztes, um in der Form von einer schrecklichen Wunde auf dem Körper des Patienten aufzutauchen. Der Arzt nennt Rosa "dieses schöne Mädchen,
das jahrelang, von mir kaum beachtet, in meinem Hause lebte" (9, 187) und ist trostlos, daß er sie "hingeben mußte" (ebenda) ; der Patient sagt<br />
verzweifelt: "Mit einer schönen Wunde kam ich auf die Welt; es war meine ganze Ausstattung." (9, 189) Durch Rosa, oder durch die Wunde, fest<br />
aneinander gebunden, liegen der Arzt und der Patient zusammen im Bett. Arnold Weinstein bietet verschiedene Interpretationen dieser Szene an und<br />
erkennt: "The possibilities are endless, and even though none of them is provable, the story seems unmistakably governed by the very dynamics of<br />
displacement and projection." (10, 13)<br />
Was Weinstein als "displacement and projection" bezeichnet, wird vielleicht auf das äußerste in „Das Schloß“ getrieben. "Der Landvermesser" ist<br />
eine Funktion, über deren Inhalt keiner ganz im klaren ist, weder K. noch das Schloß. Daß K. unsicher ist, ob er ein Landvermesser sei, folgt aus dem<br />
folgenden Abschnitt: 'Wer seid ihr?' fragte er und sah von einem zum anderen. 'Euere Gehilfen,' antworteten sie. 'Es sind die Gehilfen,' bestätigte<br />
leise der Wirt. 'Wie?' fragte K. 'Ihr seid meine alten Gehilfen, die ich nachkommen ließ, die ich erwarte?' Sie bejahten es. 'Das ist gut,' sagte K. nach<br />
einem Weilchen, 'es ist gut, daß ihr gekommen seid.' [...] '[V]ersteht ihr etwas von Landvermessung?' 'Nein,' sagten sie. 'Wenn ihr aber meine alten<br />
Gehilfen seid, müßt ihr doch das verstehen,' sagte K. Sie schwiegen. 'Dann kommt also,' sagte K. (11, 22-23)<br />
Heinz Politzer schreibt: "Und dennoch wird er [K.] während des ganzen Romans niemals der Tatsache überführt, daß er lügt und kein Landvermesser<br />
sei. Seine Fähigkeiten werden vielmehr niemals voll anerkannt oder kategorisch bestritten: sie werden lediglich bagatellisiert." (12, 323) Das kommt<br />
davon, daß es auch um kein wirkliches Landvermessen geht: Zum Beispiel wird K. der Platz eines Schuldieners (dieser Ausdruck beinhaltet – ob<br />
zufällig oder nicht – Kafkas Schlagwort Schuld) angeboten, und dabei bleibt er offiziell trotzdem ein Landvermesser und bekommt sogar einen Brief<br />
mit der Anerkennung seiner Leistungen. Während die Funktionen des Reisenden oder des Offiziers in „In der Strafkolonie“ einen bestimmten Inhalt<br />
hatten, ist der "Landvermesser" leer, mit einer oder anderen Funktionen beliebig ausfüllbar.<br />
III. Negation und die Un-Gestalten<br />
Um den Figuren ihre körperliche Substanz zu nehmen, bediente sich Kafka der einfachen Umkehrung des Vorzeichens. Ein Un-Körper ist kein Körper,<br />
aber es ist auch kein Nichts, sondern eine negative Größe - in dem Fall, wenn man von einem sich bewegenden und handelnden Un-Körper spricht.<br />
Ludwig Wittgenstein schreibt: Imagine a language in which, instead of saying 'I found nobody in the room', one said 'I found Mr. Nobody in the<br />
room.' Imagine the philosophical problems which would arise out of such a convention. Some philosophers would probably feel that they didn't like the<br />
similarity of the expressions 'Mr. Nobody' and 'Mr. Smith.' (13, 69)<br />
Ähnlich fällt es Lesern schwer, sich Kafkas Gestalten als Wesen aus Fleisch und Blut vorzustellen. Der Jäger Gracchus ist nicht lebendig, nicht tot, er<br />
ist un-tot, nicht die Auslöschung, sondern ein Produkt der Negation vom Leben. Diese effektive Methode der Entkörperung benutzt Kafka sehr oft.<br />
Seine Schriften sind voll von negierenden Ausdrücken. Wie Heinz Politzer bemerkt, fängt „Die Verwandlung“ mit einer Serie von Negationen an:<br />
"Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt."
(Hervorhebung AG) Die "unirdischen Pferde" aus „Ein Landarzt“ sind himmlisch schön, aber kommen aus dem Schweinestall heraus; das Wort<br />
unirdisch, genau genommen, kann sowohl auf den Himmel als auch auf sein Gegenteil verweisen. Diese Verzicht, positiv zu sprechen, führt Kafka mit<br />
vielen Mitteln aus. Walter Sokel zitiert eine Stelle in „Der Prozeß“: "In Verlegenheit oder Ungeduld rückte der Untersuchungsrichter auf seinem<br />
Sessel hin und her." (14, 59), dann kommentiert er: „Instead of giving us a single authoritative explanation, the author states his ignorance of his<br />
fictional world. […] Together with the protagonist, the reader is thrown into the basic condition of every individual man: He stays imprisoned in the<br />
solitary confinement of a limited and subjective consciousness that can only infer, but can never know, the external world. […] If it was embarassment<br />
that made the Magistrate fidget, Josef K. has scored a victory. If, on the other hand, the Magistrate moved from impatience, K.'s speech has heightened<br />
the threat to himself.“ (3, 10)<br />
Zu diesem könnte man noch hinzufügen, daß jener Untersuchungsrichter folglich außer Achtung bleibt und die weitere Entwicklung des Romans dem<br />
Leser keine weitere Einsicht darin verleiht, ob K.s Rede Erfolg hatte und was genau der Untersuchungsrichter fühlte, also sind diese beiden einander<br />
widerlegenden Komponenten (Verlegenheit oder Ungeduld) in der Funktion des Untersuchungsrichter zur gleichen Zeit vorhanden. Weder kämpfen<br />
die Widersprüche miteinander, noch ko-existieren in Harmonie, sie gehen ineinader über und machen die Realität des Absurden aus. Ein Hybride wie<br />
das Katzenlamm kann sich ein rationaler Denker nicht vorstellen; diese Kreuzung ist die Summe der Abstraktionen: des Katzenhaften, des<br />
Lammhaften und des Menschlichen. Das Absurde (oder das Unheimliche) darin ist das Oszillieren zwischen den verbundenen, unverbindbaren<br />
Bestandteilen. Aus diesem Grunde wehrte sich Kafka gegen einen Illustrationsversuch, wie es Politzer beschreibt: Als 1915 der Verleger Kurt Wolff<br />
Kafka die von Ottomar Stare entworfene Titelseite vorlegte, protestierte der Dichter: 'Das Insekt selbst kann nicht gezeichnet werden. Es kann aber<br />
nicht einmal von der Ferne aus gezeigt werden.' Als Gegenvorschlag regte er die Szene mit den Eltern und der Schwester im beleuchteten Zimmer an,<br />
'während die Tür zum ganz finsteren Nebenzimmer offensteht'". (12, 128)<br />
Daß die Gestalten obskur sind, wird dadurch betont, daß sie nur selten klar zu sehen sind. So kommen in Kafkas Texten verschiedenste Arten von<br />
Visionsstörungen vor: im Fall von Gregors Zimmer ist es die undurchdringliche Dunkelheit, aber er verfügte über mehr Mitteln dafür[iii]: Schnee,<br />
Regen, Schatten, Dunkelheit verschleiern die Sicht, verhindern die Perzeption. Zum Beispiel ist K. der Blick auf das Schloß immer durch Schnee<br />
unmöglich; die Kajüte des Heizers in „Der Verschollene“ schwebt im Dunkeln; die Begegnung zwischen dem Jäger Gracchus und dem Bürgermeister<br />
von Riva wird von einer einzigen Kirchenkerze beleuchtet, die viel mehr "unruhige Schatten" wirft als Licht gibt. Ein spezieller Fall von solchen<br />
Sehensverhinderungen ist „In der Strafkolonie“: Hier ist der störende Faktor das blendende Licht: Der Reisende muß eine Hand als Sonnenschutz vor<br />
die Augen nehmen, um das obere Teil der Maschine, die selbst "fast Strahlen wirft", zu betrachten; trotzdem erkennt er nicht alles deutlich; der<br />
Verurteilte folgt seinem Beispiel, kann sich jedoch mit keinem Schutz versorgen, weil seine Hände verkettet sind. Auf diese Weise bleibt "der<br />
eigentümliche Apparat" doch nicht so klar bestimmt, wie es aufgrund detaillierten Beschreibungen erscheinen könnte. Der obere Teil der Maschine<br />
bleibt dem Reisenden unsichtbar; bemerkenswert ist, daß die Zerstörung der Maschine gerade an diesem Teil anfangen wird.
Der zentralste Punkt „In der Strafkolonie“ ist der stufenweise Übergang aus dem Leben in den Tod. Die Hinrichtung tötet einen Verurteilten sehr<br />
langsam, und anfangs der sechsten Stunde passiert die Wende im Zustand des Menschen: "Die ersten sechs Stunden lebt der Verurteilte fast wie<br />
früher, er leidet nur Schmerzen" (9, 157), dann kommt die Zustandsänderung: "Wie still wird dann der Mann um die sechste Stunde! Verstand geht<br />
dem blödsten auf." (ebenda) Die folgenden sechs Stunden gebraucht der Verurteilte, um die Schrift des Gebotes mit den Wunden zu entziffern. Diese<br />
Schrift verdient besondere Aufmerksamheit; Anderson setzt sich mit den Interpretierungversuchen auseinander, bei denen die Schrift als die<br />
unlesbaren hebräischen Buchstaben des Alten Testaments erklärt wird, und schlägt eine neue Erklärung vor, nämlich, daß die labyrinthischen<br />
Verzierungen den "kunstvollen" Jugendstilornamenten entsprechen (7, 184-185). Wie schon bei Kafka gewöhnt, ist die Schrift kein abgeschlossenes<br />
Ganzes, sondern ein Symbol oder eine Abstraktion, die sich vielfach interpretieren läßt. Der Reisende kann die Schrift nicht entziffren, und dieses mal<br />
ist sein Sichtvermögen durch die vielen "Verzierungen" beeinträchtigt, die den schmalen Band der Buchstaben umgeben: "'Ich kann nicht', sagte der<br />
Reisende, 'ich sagte schon, ich kann diese Blätter nicht lesen.'" (9, 173) Desto schwerer sollte es dem Verurteilten fallen, den Text des Gebots mit dem<br />
eigenen Leib zu entziffern, weil er – aus den miserablen Lebenskonditionen der Strafkolonie ausgehend – höchstwahrscheinlich ein Analphabet ist. Daß<br />
die Hoffnung des Offiziers, des "verklärten" Todes unter der Egge zu sterben, scheitert, liegt vielleicht eben daran, daß er die Schrift vorher lesen<br />
konnte und tatsächlich las. Das Un-Können der Sprache ist die Voraussetzung für die Einsicht in die Schrift.<br />
Dem Offizier blieb der sechsstündige Zustand des Un-Todes, Un-Lebens verweigert: „[...] kein Zeichen der versprochenen Erlösung war zu entdecken;<br />
was alle anderen in der Maschine gefunden hatten, der Offizier fand es nicht; die Lippen waren fest zusammengedrückt, die Augen waren offen, hatten<br />
den Ausdruck des Lebens, der Blick war ruhig und überzeugt, durch die Stirn ging die Spitze des großen eisernen Stachels.“ (9, 180)<br />
Sobald er sich von der ausgezogenen Uniform befreit, die "die Heimat bedeute[t]" (9, 144), ist er schon kein Mensch mehr, sondern eine mechanishe<br />
Fortsetzung der Maschine. Die Maschine und der Offizier, die das alte Gesetz verkörpern, begehen Selbstmord, bewegt von dem Urteil des Reisenden.<br />
Der Offizier legt seine Handlungsfähigkeit ab, und in diesem Moment wird die Maschine lebendiger als er: sie handelt selbst. Die Maschine zerfällt,<br />
Rädchen nach dem Rädchen (ob Odradek aus einem davon gebaut ist?), den Offizier hebt der Reisende von den Nageln ab. Ist er nun ganz tot? In<br />
einem Fragment erscheint er wieder: Der R.[eisende] mußte gewaltsam das ihn überkommende Gefühl abwehren, daß in diesem Fall eine vollkommene<br />
Ordnung geschaffen sei. Er wurde müde und gab den Plan auf, den Leichnam jetzt zu begraben. [...] Hätte sich sein Schiff durch diesen weglosen<br />
Sand hierher zu ihm geschoben, um ihn aufzunehmen, – es wäre am schönsten gewesen. Er wäre eingestiegen, nur von der Treppe aus hätte er noch<br />
dem Offizier einen Vorwurf wegen der grausamen Hinrichtung des Verurteilten gemacht. [...] "Hingerichtet?" hätte daraufhin der Offizier mit Recht<br />
gefragt. "Hier ist er doch" hätte er gesagt und auf des Reisenden Kofferträger gezeigt. Und tatsächlich war dies der Verurteilte, wie sich der R. durch<br />
scharfes Hinschauen und genaues Prüfen der Gesichtszüge überzeugte. "Meine Anerkennung" mußte der R. sagen und sagte es gern. "Ein<br />
Taschenspielerkunststück?" fragte er noch. "Nein" sagte der O. "ein Irrtum ihrerseits ich bin hingerichtet, wie Sie es befahlen. " Noch aufmerksamer<br />
horchten jetzt Kapitän und Matrosen. Und sahen sämtlich wie jetzt der O. über seine Stirn hinstrich und einen krumm aus der geborstenen Stirn<br />
vorragenden Stachel enthüllte. (8)
Es ist nicht klar, warum Kafka diesen Abschnitt unbenutzt ließ. Die Konstruktion der Un-Realität ensteht hier aus der verzerrten Grammatik. Aus<br />
dem, was sich der Reisende erstmals in Konjunktiv vorstellt, bildet sich schließlich eine "wirkliche" Situation. Der Übergang aus "hätte gefragt,<br />
gesagt, gezeigt" in "mußte sagen" und "sahen" ist so selbstverständlich und leicht, daß sich keine Grenze zwischen "wäre" und "war" ziehen läßt.<br />
Und in diesem Augenblick ist es der Offizier, der die Funktion des Reisenden übernimmt, denn er wird zu einem weder Toten, noch Lebendigen, zu<br />
einer Figur wie der Alte Kommandant: begraben unter einem Tisch im Teehaus, wird er "nach einer bestimmten Anzahl von Jahren auferstehen und<br />
aus diesem Hause seine Anhänger zur Wiedereroberung der Kolonie führen." (9, 182) Dieser unruhige, für das ewige Schwanken zwischen Leben und<br />
Tod bestimmte Ewig-Wandernde ist oft bei Kafka zu treffen: der Jäger Gracchus, der Landarzt am Ende der Erzählung, Dr. Bucephalus aus „Der neue<br />
Advokat“ und im gewißen Sinne auch das Un-Ding Odradek.<br />
Der Jäger Gracchus ist tot, jedoch bleibt er für immer unter Lebenden. Der Bürgermeister von Riva, wo Gracchus mit seinem Totenkahn ankommt,<br />
will wissen: "'Sind Sie tot?' 'Ja', sagte der Jäger, 'wie Sie sehn. [...]' " (15, 247) Es wurden viele Versuche unternommen, die Geschichte zu<br />
entschlüsseln: Antony Northey verglich Gracchus mit Ahasver, dem Fliegenden Holländer und Schillers Alpenjäger. (16) Hartmut Binder versuchte<br />
es sogar mit dem Kaiser Franz Joseph, der auf einem Portrait als Gemsenjäger verewigt ist. (17, 194) Guy Davenport sieht im Gracchus eine<br />
theologische Figur: "'The Hunter Gracchus' inquires into the meaning of the word death. If there is an afterlife in an eternal state, then it doesn't<br />
mean death; it means transition, and death as a word is meaningless."[iv] (6, 14) Frank Möbus bietet eine neue Interpretation an, in der er Gracchus<br />
mit dem Ostgotenkönig Theoderich assoziiert. (18) In Verona, nicht weit von Riva, gibt es eine Kirche mit einem Relief, das Theodorich, den Wilden<br />
Jäger, abbildet. Möbus sieht in Kafkas Erzählung weitere Allusionen auf Verona: Julia, die Frau des Bootführers, ist für ihn ein Verweis auf<br />
Shakespeare; jedoch findet er, daß der Jäger selbst viel mehr Gemeinsamkeiten mit Shakespeares Julia zeigt, als die genannte Frau. Schließlich gesteht<br />
Möbus ein, daß diese Entdeckung ihm nicht weiter hilft, denn: "Aber die nun doch zwingend sich stellenden Fragen 'Who is Who?' und 'Was soll's?'<br />
lassen sich nicht schlüssig beantworten." (18, 264) Wie üblich bei Kafka ist es nicht unmöglich, die (möglichen) Motive zu erkennen, sie sind nur alle<br />
miteinander vertauscht und basieren auf der gegenseitigen Negation. Der Jäger ist keine Shakespeares Julia, weil Julia, die Frau des Bottsfahrers, das<br />
ist, und Julia, die Frau des Bottsfahrers, ist keine Shakespeares Julia, weil es der Jäger ist, der "in das Tötenhemd schlüpfte [...] wie ein Mädchen ins<br />
Hochzeitskleid." (15, 249) Es entsteht ein schillerndes Oszillieren von Negationen und Negationen von Negationen, oder, wie Möbus es nennt, das<br />
"erzählerische Palimpsest" (18, 263), oder, wie Michael Bryant schreibt, das Effekt der Kafka Lektüre ist like driving in a strange city on a main street<br />
with detour after detour, and detours from the detours, none of which ever reconnect with the streets of which they are detours, so that one only drifts<br />
helplessly further and further from the intended destination, with neither compass nor atlas to show the way back. (19, 275)<br />
Gracchus ist bestimmt ewig durch die irdischen Gewässer zu fahren, sein unerreichbares Ziel ist das Jenseits, und diesen Weg beschreibt er im<br />
Gespräch mit dem Bürgermeister: 'Und Sie haben keinen Teil am Jenseits?' fragte der Bürgermeister mit gerunzelter Stirne. 'Ich bin,' antwortete der<br />
Jäger, 'immer auf der großen Treppe, die hinaufführt. Auf dieser unendlich weiten Freitreppe treibe ich mich herum, bald oben, bald unten, bald rechts,<br />
bald links, immer in Bewegung. (15, 248)
Das Motiv der Treppe findet sich wieder in „Die Sorge des Hausvaters“. Die ungefähr zur gleichen Zeit geschriebenen Erzählungen „Der Jäger<br />
Gracchus“, „Die Sorge des Hausvaters“ und teilweise „Der neue Advokat“ haben eine Zwischenskizze gemeinsam. Auf dem Dachboden: Die Kinder<br />
hatten ein Geheimnis. Auf dem Dachboden in einem tiefen Winkel inmitten des Gerümpels eines ganzen Jahrhunderts, wohin kein Erwachsener mehr<br />
sich tasten konnte, hatte Hans, der Sohn des Advokaten, einen fremden Mann entdeckt. (20)<br />
Der fremde Mann sieht aus wie ein verwahrloster Wilder Jäger: gespornte Schaftstiefel, seinen Mantel hält ein "Riemenzeug" zusammen, ähnlich dem<br />
"Geschirr eines Pferdes", eine Weinflasche unter dem Fuß. Das Kind, erstmal erschrocken, nähert sich langsam dem Mann und schließlich berührt ihn<br />
sogar.<br />
'So staubig bist Du!' sagte er staunend und zog seine geschwärzte Hand zurück. 'Ja, staubig,' sagte der Fremde, sonst nichts. Es war eine<br />
ungewöhnliche Aussprache, erst im Nachklang verstand Hans die Worte. 'Ich bin Hans', sagte er, 'der Sohn des Advokaten und wer bist Du.' 'So,'<br />
sagte der Fremde, 'ich bin auch ein Hans, heiße Hans Schlag, bin badischer Jäger und stamme von Koßgarten am Neckar. Alte Geschichten.' (ebenda)<br />
Ein Greis, bedeckt mit Staub, ist auf den Dachboden abgestellt, wie ein unnutzes Gerümpel – in eine geheime Ecke, zu der sich nur noch Kinder<br />
"tasten" können. Ein badischer Jäger aus den "alten Geschichten" und das Kind, das in dem Haus lebt und den selben Namen wie der Fremde trägt –<br />
ist es nicht eine Entzweiung einer Figur, wie in Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande? Verena Ehrich-Haefli, Walter Sokels psychoanalytischen<br />
Erklärungen folgend, nennt den Dachboden den "Ort des Verdrängten" (21, 244) Von dieser Perspektive aus, ist der alte Hans das in die Vergessenheit<br />
des Unbewußten geratene Ich-Fremde. Und doch ist es ja wieder falsch, weil die Rollen vertauscht sind: sollte die Geschichte die vergangene,<br />
verdrängte Kindheit symbolisieren, so müßte der alte Hans sich als Kind auf dem Dachboden seines Ich-Zuhause finden. 'Who is Who?' und 'Was<br />
soll's?', wie Möbus sagen würde.<br />
In „Die Sorge des Hausvaters“ werden diese Komponenten, das Gerümpel, das Kind und der ewige Greis, zu einem Odradek verschmolzen: er besteht<br />
haupsächlich aus einer Zwirnspule und einem zusätzlichen Beinchen, so daß er stehen kann; man behandelt ihn wie ein Kind, größtenteils wegen<br />
seiner Winzigkeit; und das alte an ihm sind "abgerissene, alte, aneinander geknotete, aber auch ineinander verfitzte Zwirnstücke von verschiedenster<br />
Art und Farbe." (22) Es ist eine große Verführung, in Odradek das schriftstellerische alter ego Kafkas zu sehen, ähnlich wie die Hinrichtungsmaschine<br />
aus In der Strafkolonie für Heinz Politzer, Gilles Deleuze und Felix Guattari, Elizabeth Boa und Mark Anderson der Mechanismus seines<br />
literarischen Schreibens war. Das ist bestimmt auch richtig, aber nur teilweise – denn es handelt sich wieder um ein "erzählerisches Palimpsest".<br />
Heinz Hillmann stellte die Versuche, Odradek zu identifizieren, zusammen: als Ware im marxistischen Sinn; als Abbild des universellen Sinns; als<br />
Parodie auf Religion; als Sinnbild der Maschine usw. (23) Ganz im Sinne von Tzvetan Todorov, der schreibt, daß "his [Kafkas] narratives must be read<br />
above all as narratives, on the literal level" (24), schlägt Ehrich-Haefli eine Werk-immanente Interpretierung dieses Wortes: Die erste Silbe od-, in<br />
Anlehnung an 'öd' [...] würde soviel bedeuten wie 'verlassen', 'ermangelnd'; die Silbe –rad- bezeichnet das Kreisrund der flachen Zwirnspule; ein –ek,<br />
ein Viereck entsteht durch je rechtwinklige Anfügung der beiden Hölzchen. (21, 242)
Ehrich-Haefli nennt diesen Aufbau eine "Oxymoron-Struktur" (ebenda). Die Bestandteile widersprechen nicht nur einander, sie widerlegen einander.<br />
Odradek besteht nichht nur aus Kind, Greis, Ding – er besteht aus Un-Kind, denn man behandelt ihn nicht als Kind, sondern "wie ein Kind" (22);<br />
aus Un-Greis, denn er soll den Hausvater "auch noch überleben" (ebenda); aus Un-Ding, denn seine verworrene Zwirnstücke sind kein Produkt des<br />
Zerfalls: Man wäre versucht zu glauben, dieses Gebilde hätte früher irgendeine zweckmäßige Form gehabt und jetzt sei es nur zerbrochen. Dies scheint<br />
aber nicht der Fall zu sein; wenigstens findet sich kein Anzeichen dafür; [...] das Ganze erscheint zwar sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen.<br />
(ebenda) Odradek, wie andere Un-Gestalte Kafkas, ist das Produkt der aufeinander prallenden negierenden Kräften. Alle Geschehnisse (besonders am<br />
Beispiel von Das Schloß) sind weder logische Folgen voneinander, noch sind sie beliebige sinnlose Fragmente, sie werden von einem unkausalen<br />
Unzusammenhang reguliert.<br />
IV. Kafka und die bildende Kunst<br />
Kafkas Experimente korrespondieren mit den Prozessen in der bildenden Kunst seiner Zeit. Er wurde mit Paul Klee (Politzer) und Giorgio de Chirico<br />
(Davenport) verglichen. Klee benutzt oft dasselbe Material wie Kafka: es entstehen unmögliche Kreuzungen, wie Zwitschermaschine (Hybride von<br />
Vögeln mit Maschine), die Uhren (Uhr und Pflanze) usw. De Chirico kreiiert die Verbindungen zwischen Objekten, die es sonst nicht gibt. Wieland<br />
Schmied, der Kunstkritiker, schreibt über de Chirico: "The human observer finds himself lost in a world of artefacts which have become strangers to<br />
him. [...] When the connecting principle has been lost, the individual constituent parts - objects - become more and more important. They may be<br />
likened to the fragments of a broken and scattered mosaic, which can never again be put together into a significant whole. If anyone poses the old<br />
questions to these disjointed objects - as De Chirico does in his paintings – they appear mysterious, alien, 'metaphysical.' " (25, 12)<br />
Kafkas Texte, wie De Chiricos "Magischer Realismus", spiegeln das Ende des rationalen, kartesianischen Zeitalters wider. In Kafkas, wie De Chiricos,<br />
Geometrie können sich Parallelen überschneiden. Leib und Seele tauschen ihre Rollen aus. Diese "Wirklichkeit" ist das unfaßbare Unfaßbare, um es<br />
mit Kafkas Worten aus Von den Gleichnissen auszudrücken.<br />
[...] 'Warum wehrt ihr euch? Würdet ihr den Gleichnissen folgen, dann wäret ihr selbst Gleichnisse geworden und schon der täglichen Mühe frei.'<br />
Ein anderer sagte: 'Ich wette, daß auch das ein Gleichnis ist.'<br />
Der erste sagte: 'Du hast gewonnen.'<br />
Der zweite sagte: 'Aber leider nur im Gleichnis.'<br />
Der erste sagte: 'Nein, in Wirklichkeit; im Gleichnis hast du verloren.' (26)<br />
--------------------------------------------------------------------------------
Walter Sokel weist auf den oneiristischen Charakter der Texte Kafkas: "[...] Kafka's writing<br />
conforms to or repeats the activity of the dreaming mind. As Freud has shown in his<br />
Interpretation of Dreams, a work with which Kafka was familiar, dreams speak in the pictorial<br />
language speech once was." (1, 4) Nach Freud, der Analytiker soll die Bildersprache des<br />
Traums lernen, und verfügt er einmal über dieses Wissen, so kann er den Traum in die<br />
altägliche Sprache "übersetzen." Ludwig Wittgenstein kritisierte diesen Gedanken Freuds; für<br />
ihn ist der Traum eine "entwiclungsschwangere Idee" (Wittgenstein, Ludwig. Vermischte<br />
Bemerkungen. Culture and Value, ed. G. H. Von Wright, trans. Peter Winch, Chicago: The<br />
University of Chicago Press, 1980), deren Sprache wie "a series of marks on paper or on sand"<br />
ist (Wittgenstein, Ludwig. Lectures & Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious<br />
Belief, compiled from notes taken by Yorick Smythies, Rush Rhees and James Taylor, ed. Cyril<br />
Barrett. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1967.): diese Zeichen sind<br />
Fragmente davon, was nur scheinbar eine Sprache ist. Entziffern kann man diese Fragmente<br />
nicht, und dadurch nehmen sie einen symbolischen und enigmatischen Charakter an. Kafkas<br />
traumähnliche, fragmentarische Symbolik ist genau dies: "entwicklungsschwanger."<br />
[ii] Deleuze und Guattari sprechen von Kafkas "exaggerated Oedipus" – besonders klar im<br />
Falle des Briefes an den Vater ausgedrückten und in vielen Texten vorkommenden Motivs.<br />
(Deleuze, Gilles, Guattari, Felix. Kafka: Toward a Minor Literature, trans. Dana Polan,<br />
Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.) [iii] Vrgl. Mark M. Anderson, Kafka's<br />
Clothes, S. 173 [iv] Die Idee von dem Übergang in eine andere Welt hat bestimmte<br />
Ähnlichkeiten mit Michael P. Ryants Überlegungen über Gregors "eternal sufferings" in<br />
Samsara, dem Gegenteil von Nirvana. In "Samsa and Samsara: Suffering, Death, and Rebirth<br />
in 'The Metamorphosis'", German Quarterly, 72. 2, 1999.<br />
Literaturverzeichnis<br />
1. Sokel, Walter H. Franz Kafka. New York, London: Columbia University Press, 1966. Kafka,<br />
Franz. Brief an den Vater, Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1994.<br />
2. Kafka, Franz. Briefe, Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1966.<br />
April 2000.<br />
8. Kafka, Franz. "In der Strafkolonie." Meistererzählungen, ed. Winfried Stephan, Zürich:<br />
Diogenes Taschenbuch Verlag, 1995. (143-182)<br />
9. Kafka, Franz. "Ein Landarzt". Meistererzählungen. Zürich: Diogenes Taschenbuch, 1995.<br />
(183-191)<br />
10. Weinstein, Arnold. "The Unruly Text and the Rule of Literaure." Literature and Medicine,<br />
16.1 (1997): 1-22.<br />
11. Kafka, Franz. Das Schloß, Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1958.<br />
12. Politzer, Heinz. Franz Kafka, der Künstler. Güterlsloh: Mohn&Co, 1965.<br />
13. Wittgenstein, Ludwig. The Blue and Brown Books, Oxford: Blackwell, 1958.<br />
14. Kafka, Franz. Der Prozeß. Gesammelte Schriften, Berlin: Schocken Verlag, 1946.<br />
15. Kafka, Franz. "Der Jäger Gracchus." Meistererzählungen, ed. Winfried Stephan, Zürich:<br />
Diogenes Taschenbuch Verlag, 1995. (244-250)<br />
16. Northey, Antony. "Kafka in Riva, 1913". Neue Züricher Zeitung, 24 April 1987. (37)<br />
17. Binder, Hartmut. "Kafka-Kommentar zu sämtlichen Erzählungen." München, 1982.<br />
18. Möbius, Frank. "Theoderich, Julia und die Jakobsleiter. Kafkas 'Jäger Gracchus'."<br />
Zeitschrift für Deutsche Philologie, 109. 2 (1990): 253-271<br />
19. Bryant, Michael S. "I Say Coffee, You Say Inkwell: Normalizing the Abnormal in Kafka's<br />
The Castle". Transforming the center, eroding the margins : essays on ethnic and cultural<br />
boundaries in German-speaking countries, ed. Lorenz, Dagmar C.G. and Renate S. Posthofen.<br />
Columbia: Camden House, 1998. 268-284<br />
20. Kafka, Franz. "Unpublished texts 1916-1918. Oktavheft A. 'Auf dem Dachboden'." The<br />
Kafka Projekt, ed. Mauro Nervi, 1999, 2000. 4 Mai 2000.<br />
21. Ehrich-Haefli, Verena. "Bewegungsenergien in Psyche und Text. Zu Kafkas 'Odradek'."<br />
Zeitschrift für Deutsche Philologie, 109. 2 (1990): 238-253<br />
22. Kafka, Franz. "Die Sorge des Hausvaters." Ein Landarzt – Kleine Erzählungen. The Kafka<br />
Project. Ed. Mauro Nervi. 4 Mai 2000<br />
23. Hillmann, Heinz. "Das Sorgenkind Odradek." Zeitschrift für Deutsche Philologie, 86<br />
3. Kafka, Franz. "Tagebücher 1917/18-1922." The Kafka Projekt, ed. Mauro Nervi, 1999, 2000.<br />
16 April 2000.<br />
(1967): 197-210<br />
4. Ozick, Cynthia. "The Impossibility of Being Kafka". The New Yorker, 11 January 1999 (80- 24. Todorov, Tzvetan. The fantastic: A structural Approach to a Literary Genre, Ithaca: Cornell<br />
85)<br />
University Press, 1973.<br />
5. Davenport, Guy. The Hunter Gracchus and Other Papers on Literature and Art, 25. Schmied, Wieland. Neue Sachlichkeit and the German Realism of the Twenties, trans.<br />
Washington: Counterpoint, DC, 1996.<br />
David Britt and Frank Whitford. Neue Sachlichkeit und magischer Realismus in Deutschland.<br />
6. Anderson, Mark M. Kafka's Clothes. Oxford: Clarendon Press, 1992.<br />
1918-1933, Hannover: Fackelträger-Verlag, 1969.<br />
7. Kafka, Franz. "Tagebücher, Heft 11." The Kafka Projekt, ed. Mauro Nervi, 1999, 2000. 16 26. Kafka, Franz. "Unpublished texts 1922-1924.." The Kafka Projekt, ed. Mauro Nervi, 1999,<br />
2000. 4 Mai 2000.<br />
Revision: 2011/01/08 - 00:18 - © Mauro Nervi / http://www.kafka.org/index.php?aid=229
Liebeserklärung an Franz Kafka von Nicole Strecker<br />
Gegen die eigene Ehrfurcht hat Alois Prinz die Lebensgeschichte Franz Kafkas aufgeschrieben. Sein Talent als Biograf hatte Alois Prinz davor schon mit<br />
Darstellungen über die Philosophin Hannah Arendt und den Schriftsteller Hermann Hesse bewiesen. Im vergangenen Jahr bekam er für die Lebensgeschichte<br />
der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof den Jugendliteraturpreis. "Auf der Schwelle zum Glück" heißt seine Biografie über Kafka.<br />
Er ist eine der mysteriösesten Figuren der Literaturgeschichte: Franz Kafka. Wer sich ihm nähert, hat es immer mit einem Phänomen zu tun:<br />
der Angst – nicht nur dem existenziellen Gefühl von Lebensangst, sondern auch ganz schlicht dem von der Angst des Lesers: Kann ich das<br />
verstehen? Kafka ist zum Modellfall für das Scheitern diverser Interpretationsmethoden geworden, egal ob psychologisierend und autobiografisch,<br />
strukturalistisch und ästhetisch oder sozialgeschichtlich – nichts greift so richtig. "Kafkaesk" lautet die Kapitulationsformel der<br />
Germanistik vor diesem Phänomen. Doch jetzt kommt einer daher, der so gar nicht mit Interpretationswut an Kafka herantritt. Alois Prinz,<br />
selbst von Hause aus Literaturwissenschaftler, doch hier vor allem – wie er selbst sagt – Liebhaber. "Ich habe nichts getan, was Kafka auch nie<br />
getan hätte, und das ist für mich eine Voraussetzung von Biografie, dass man denjenigen, den man biografiert, auch zum Maßstab bringt, wie<br />
der über Leute denkt, wie der darüber denkt, wie nahe man Leuten kommen kann. Und bei Kafka, der hatte auch ganz großen Respekt vor<br />
seinen Figuren, die er auftreten lässt, und da gibt es keine Innenansichten, sondern die werden immer nur beschrieben. Und ich habe etwas<br />
Ähnliches auch versucht: Kafka einfach nur zu zeigen, wie er ist, wie er sich kleidet, welche Schrullen er hat, welche Eigenheiten er hat,<br />
sozusagen auf die Bühne zu bringen." Im April des Jahres 1910 beginnt der von Prinz inszenierte erste Akt im Leben des Schriftstellers. Der<br />
Halleysche Komet sollte eigentlich die Welt vernichten, doch der prognostizierte Einschlag blieb aus, und so ist der 26-jährige Kafka an diesem<br />
Donnerstagmorgen unbehelligt von der Apokalypse auf dem Weg in eine persönliche Katastrophe: Sein Chef, der Präsident der Arbeiter-<br />
Unfall-Versicherungsanstalt für das Königreich Böhmen, möchte Kafka besondere Ehre zuteil werden lassen und empfängt ihn anlässlich einer<br />
Beförderung. Und Kafka, der sonderbare Mensch, bekommt einen Lachanfall, den – so ist es nun einmal typisch für ihn – niemand, nicht<br />
einmal er selbst, wirklich versteht. "Natürlich lachte ich dann, da ich nun schon einmal im Gange war, nicht mehr bloß über die gegenwärtigen<br />
Späßchen, sondern auch über die vergangenen und die zukünftigen und über alle zusammen, und kein Mensch wusste mehr, worüber ich<br />
eigentlich lache." So reflektiert Kafka Jahre später diese Begebenheit in einem Brief und solche Selbstaussagen vor allem sind es, auf die sich<br />
Alois Prinz in seiner Lebensgeschichte stützt. 1910 beginnt Kafkas Tagebuch, was für seinen Biografen den Ausschlag gab, hier auch mit seiner<br />
Lebensgeschichte einzusetzen. Von diesem Fixpunkt aus skizziert Prinz knapp die Kindheit und Kafkas ungeliebtes Jurastudium. Vor allem<br />
aber nähert er sich von diesem Punkt rasch einem zentralen Ereignis: Kafkas Begegnung mit Felice Bauer. "Wie lange er um die Felice<br />
gekämpft hat, das waren ja viele Jahre lang, das hat ihn einfach am stärksten geprägt. Das waren seine produktivsten Jahre und es war sein<br />
härtester Kampf, den er geführt hat. Und wenn man bedenkt, dass er mit dieser Frau 500 oder mehr Briefe gewechselt hat, dann weiß man<br />
schon, was an Textmaterial ist und es sind nicht nur Liebesbriefe, sondern er erzählt viel von seinem Alltag, von seinen Eltern, seinem Leben,<br />
über seine Arbeit und das ist ein Kaleidoskop seines Lebens, so kann man natürlich als Leser sehr viel erfahren über seine Ansichten und<br />
Meinungen." Es war eine tragische Liebe, deren anstrengendes Hin und Her Prinz detailreich aufschlüsselt: Heiratsanträge und Entlobungen,<br />
Liebesschwüre und Liebesverrat, Lavieren, Zurückweisen, Anziehen und letztlich Scheitern. Aber parallel zu den Herzenswirren geschieht
noch etwas: Kafka schreibt einige seine bedeutsamsten Texte: Erzählungen wie "Das Urteil" oder "In der Strafkolonie", den "Amerika"-Roman,<br />
den "Prozess". "Kafka ist für mich einer der unglaublich tief gesehen hat, was dem entgegensteht zu ändern. Er hat sich ja fast nicht geändert in<br />
seinem Leben. Er wollte immer von Prag weg, hat das nicht geschafft, er wollte immer heiraten, hat das nicht geschafft, er konnte nicht über<br />
das hinweg, was ihn daran gehindert hat, nämlich seine eigene Verfasstheit. Und das ist für mich eine ganz tiefe Einsicht, die er bis zum letzten<br />
radikal ausgelebt und ausformuliert hat. Und auch in seinen Büchern: Diese Vergeblichkeit, dieses Etwas-machen-wollen-und-doch-nichtkönnen<br />
- und das ist für mich eine ganz große Wahrheit." "Warum Menschen ändern wollen, Felice? Ändern kann man sie nicht, höchstens in<br />
ihrem Wesen stören. Der Mensch besteht doch nicht aus Einzelheiten, so dass man jede für sich herausnehmen und durch etwas anderes<br />
ersetzen könnte. Vielmehr ist alles ein Ganzes, und ziehst du an einem Ende, zuckt auch gegen deinen Willen das andere." Wie schon in seinen<br />
früheren Biografien geht es Alois Prinz auch bei Kafka darum, eine Lebensphilosophie darzustellen. Fragen, die andere Biografen so quälen, -<br />
ob Kafka wirklich sein gesamtes Schaffen vernichtet haben wollte, wie authentisch seine Selbstzeugnisse überhaupt sind, ob er nicht übertrieb<br />
und ob er literarisch formte, welche Ursachen seine Ängste, sein Leiden am Vater, an den Frauen hatte, inwiefern sein Judentum ihn prägte –<br />
all diese unlösbaren Rätsel beschweren Alois Prinz nicht wirklich. Für ihn besteht eine klare Korrespondenz zwischen Leben und Schreiben,<br />
das Werk gibt Aufschlüsse über den Autor – und von dieser Prämisse aus vermittelt er vor allem die Atmosphäre im Kafka-Kosmos: das<br />
Weltempfinden dieses sonderbaren Prager Versicherungsbeamten - der nachts schreibend sein Leben zu bewältigen versuchte, sich nie<br />
wirklich von seiner Familie und einem übermächtigen Vater lösen konnte und der schließlich im Alter von nur 40 Jahren an Kehlkopftuberkulose<br />
starb. So wächst, wer diese Biografie liest, mit jeder Seite mehr hinein in den unbenennbaren Schmerz, das Fremdsein, die<br />
Schuldgefühle – in ein Dasein auf der Schattenseite des Lebens. Aber zugleich zeigt Prinz mit seinem Kafkaporträt auch das Licht – dass im<br />
Bewusstsein der eigenen Unzulänglichkeiten auch das Potenzial zu Toleranz und Humanismus stecken kann. "Gerade Kafka zeichnet sich aus,<br />
dass er überhaupt nicht moralisch an die Dinge herangeht, sondern alles, was da ist, was Wirklichkeit ist, was Unwirklichkeit ist, und das sind<br />
oft ganz gewalttätige Träume und Gefühle, dass er die einfach ausbreiten will und an die Luft kommen lassen will. Und da gibt es keine<br />
moralischen Vorsätze. Und so ist es auch wenn ich jetzt über Kafka schreibe." Wie immer ist Alois Prinz' Sprache luzide, manchmal vielleicht<br />
ein wenig zu betulich, aber offen genug, um wie selbstverständlich Zitatfetzen von Kafka in seine Sätze einfließen zu lassen. Am Ende dieser<br />
Biografie bleibt vor allem eine Erkenntnis: Dass es gar nicht immer um das Begreifen gehen muss. Manchmal reicht auch das Erfühlen. So<br />
werden die Kafka-Experten noch weiter nach der Dechiffrierbarkeit der Texte und den intellektuellen Letztbegründungen forschen. Alois Prinz<br />
dagegen gestattet sich in seiner Biografie eine Liebeserklärung an Franz Kafka ohne den Zwang zur Interpretation und begnügt sich ganz im<br />
Sinne seines Autors mit einem Verstehen jenseits der Begriffe: mit der emotionalen Wahrheit. "Wenn du vor mir stehst und mich ansiehst, was<br />
weißt du von den Schmerzen, die in mir sind, und was weiß ich von deinen. Und wenn ich mich vor dir niederwerfen würde und weinen und<br />
erzählen, was wüsstest du von mir mehr als von der Hölle, wenn dir jemand erzählt, sie ist heiß und fürchterlich. Schon darum sollten wir<br />
Menschen voreinander so ehrfürchtig, so nachdenklich, so liebend stehn wie vor dem Eingang zur Hölle."<br />
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/buechermarkt/492983/
Laughing with Kafka<br />
By David Foster Wallace<br />
Harper's Magazine, July 1998<br />
From a speech given by David Foster Wallace in March at "Metamorphosis: A New Kafka," a symposium sponsored by the PEN<br />
American Center in New York City to celebrate the publication of a new translation of "The Castle" by Schocken Books. Wallace is a<br />
contributing editor of Harper's Magazine; his short story "The Depressed Person" appeared in the January issue.<br />
One reason for my willingness to speak publicly on a subject for which I am sort of underqualified is that it affords me a chance to<br />
declaim for you a short story of Kafka's that I have given up teaching in literature classes and miss getting to read aloud. Its English title<br />
is "A Little Fable": "Alas," said the mouse, "the world is growing smaller every day. At the beginning it was so big that I was afraid, I kept<br />
running and running, and I was glad when at last I saw walls far away to the right and left, but these long walls have narrowed so<br />
quickly that I am in the last chamber already, and there in the corner stands the trap that I must run into," "You only need to change your<br />
direction," said the cat, and ate it up. For me, a signal frustration in trying to read Kafka with college students is that it is next to<br />
impossible to get them to see that Kafka is funny...Nor to appreciate the way funniness is bound up with the extraordinary power of his<br />
stories. Because, of course, great short stories and great jokes have a lot in common. Both depend on what communication -theorists<br />
sometimes call "exformation," which is a certain quantity of vital information _removed from_ but _evoked by_ a communication in such<br />
a way as to cause a kind of explosion of associative connections within the recipient. This is probably why the effect of both short stories<br />
and jokes often feels sudden and percussive, like the venting of a long-stuck valve. It's not for nothing that Kafka spoke of literature as "a<br />
hatchet with which we chop at the frozen seas inside us." Nor is it an accident that the technical achievement of great short stories is<br />
often called "compression" -- for both the pressure and the release are already inside the reader. What Kafka seems able to do better than<br />
just about anyone else is to orchestrate the pressure's increase in such a way that it becomes intolerable at the precise instant it is released.<br />
The psychology of jokes helps account for part of the problem in reading Kafka. We all know that there is no quicker way to empty a joke<br />
of its peculiar magic than to try to explain it -- to point out, for example, that Lou Costello is mistaking the proper name "Who" for the<br />
interrogative pronoun "who," etc. We all know the weird antipathy such explanations arouse in us, a feeling not so much of boredom as<br />
offense, like something has been blasphemed. This is a lot like the teacher's feeling at running a Kafka story through the gears of your<br />
standard undergrad-course literary analysis -- plot to chart, symbols to decode, etc. Kafka, of course, would be in a unique position to<br />
appreciate the irony of submitting his short stories to this kind of high-efficiency critical machine, the literary equivalent of tearing the
petals off and grinding them up and running the goo through a spectrometer to explain why a rose smells so pretty. [1] Franz Kafka, after<br />
all, is the writer whose story "Poseidon" imagines a sea-god so overwhelmed with administrative paperwork that he never gets to sail or<br />
swim, and whose "In the Penal Colony" conceives description as punishment and torture as edification and the ultimate critic as a<br />
needled harrow whose _coup de grâce_ is a spike through the forehead. Another handicap, even for gifted students, is that -- unlike, say,<br />
Joyce's or Pound's -- the exformative associations Kafka's work creates are not intertextual or even historical. Kafka's evocations are,<br />
rather, unconscious and almost _sub_-archetypal, the little-kid stuff from which myths derive; this is why we tend to call even his<br />
weirdest stories _nightmarish_ rather than _surreal_. Not to mention that the particular sort of funniness Kafka deploys is deeply alien to<br />
kids whose neural resonances are American. The fact is that Kafka's humor has almost none of the particular forms and codes of<br />
contemporary U.S. amusement. There's no recursive word-play or verbal stunt-pilotry, little in the way of wisecracks or mordant<br />
lampoon. There is no body-function humor in Kafka, nor sexual entendre, nor stylized attempts to rebel by offending convention. No<br />
Pynchonian slapstick with banana peels or rapacious adenoids. No Rothish satyriasis or Barthish metaparody or arch Woody-Allenish<br />
kvetching. There are none of the ba-bing ba-bang reversals of modern sit-coms; nor are there precocious children or profane<br />
grandparents or cynically insurgent co-workers. Perhaps most alien of all, Kafka's authority figures are never just hollow buffoons to be<br />
ridiculed, but are always absurd and scary and sad all at once, like "In the Penal Colony"'s Lieutenant. My point is not that his wit is too<br />
subtle for U.S. students. In fact, the only halfway effective strategy I've come up with for exploring Kafka's funniness in class involves<br />
suggesting to students that much of his humor is actually sort of unsubtle, or rather _anti_-subtle. The claim is that Kafka's funniness<br />
depends on some kind of radical literalization of truths we tend to treat as metaphorical. I opine to them that some of our deepest and<br />
most profound collective intuitions seem to be expressible only as figures of speech, that that's why we call these figures of speech<br />
"expressions." With respect to "The Metamorphosis," then, I might invite students to consider what is really being expressed when we<br />
refer to someone as "creepy" or "gross" or say that somebody was forced to "eat shit" in his job. Or to reread "In the Penal Colony" in light<br />
of expressions like "tonguelashing" or "She sure tore me a new asshole" or the gnomic "By a certain age, everybody has the face he<br />
deserves." Or to approach "A Hunger Artist" in terms of tropes like "starved for attention" or "love-starved" or the double entendre in the<br />
term "self-denial," or even as innocent a factoid as that the etymological root of "anorexia" happens to be the Greek word for longing. The<br />
students usually end up engaged here, which is great, but the teacher still sort of writhes with guilt, because the comedy – as –<br />
literalization – of – metaphor tactic doesn't begin to countenance the deeper alchemy by which Kafka's comedy is always also tragedy,<br />
and this tragedy always also an immense and reverent joy. This usually leads to an excruciating hour during which I backpedal and<br />
hedge and warn students that, for all their wit and exformative voltage, Kafka's stories are not fundamentally jokes, and that the rather<br />
simple and lugubrious gallows humor which marks so many of Kafka's personal statements -- stuff like his "There is hope, but not for us"<br />
-- is _not_ what his stories have got going on. What Kafka's stories have, rather, is a grotesque and gorgeous and thoroughly modern
complexity. Kafka's humor -- not only not neurotic but _anti_-neurotic, heroically sane -- is, finally, a religious humor, but religious in the<br />
manner of Kierkegaard and Rilke and the Psalms, a harrowing spirituality against which even Ms. O'Connor's bloody grace seems a little<br />
bit easy, the souls at stake pre-made. And it is this, I think, that makes Kafka's wit inaccessible to children whom our culture has trained<br />
to see jokes as entertainment and entertainment as reassurance. [2] It's not that students don't "get" Kafka's humor but that we've taught<br />
them to see humor as something you get -- the same way we've taught them that a self is something you just have. No wonder they<br />
cannot appreciate the really central Kafka joke -- that the horrific struggle to establish a human self results in a self whose humanity is<br />
inseparable from that horrific struggle. That our endless and impossible journey toward home is in fact our home. It's hard to put into<br />
words up at the blackboard, believe me. You can tell them that maybe it's good they don't "get" Kafka. You can ask them to imagine his<br />
art as a kind of door. To envision us readers coming up and pounding on this door, pounding and pounding, not just wanting admission<br />
but needing it, we don't know what it is but we can feel it, this total desperation to enter, pounding and pushing and kicking, etc. That,<br />
finally, the door opens...and it opens outward: we've been inside what we wanted all along. _Das ist komisch_.<br />
__________<br />
[1] A more grad-schoolish literary-theory-type machine, on the other hand, is designed to yield the conclusion that one has been deluded<br />
into imagining there was any scent in the first place.<br />
[2] There are probably whole Johns Hopkins U. Press books to be written on the particular lallating function humor serves at this point in<br />
the U.S. psyche. Nonetheless, a crude but concise way to put the whole thing is that our present culture is, both developmentally and<br />
historically, "adolescent." Since adolescence is pretty much acknowledged to be the single most stressful and frightening period of human<br />
development -- the stage when the adulthood we claim to crave begins to present itself as a real and narrowing system of responsibilities<br />
and limitations [2a] -- it's not difficult to see why we as a culture are so susceptible to art and entertainment whose primary function is to<br />
"escape." Jokes are a kind of art, and since most of us Americans come to art essentially to forget ourselves -- to pretend for a while that<br />
we're not mice and all walls are parallel and the cat can be outrun -- it's no accident that we're going to see "A Little Fable" as not all that<br />
funny, in fact as maybe being the exact sort of downer-type death-and-taxes thing for which "real" humor serves as a respite.<br />
[2a] You think it's a coincidence that it's inn college that most Americans do their most serious falling-down drinking and drugging and<br />
reckless driving and rampant fucking and mindless general Dionysian-type reveling? It's not. They're adolescents, and they're terrified,<br />
and they're dealing with their terror in a distinctively American way. Those naked boys hanging upside down out of their frat-house's<br />
windows on Friday night are simply trying to get a few hours' escape from the stuff that any decent college has forced them to think<br />
about all week.<br />
©1998 Harper's Magazine
Elf Söhne von Franz Kafka<br />
Ich habe elf Söhne.<br />
Der erste ist äußerlich sehr unansehnlich, aber ernsthaft und klug; trotzdem schätze ich ihn, wiewohl ich ihn als Kind wie alle andern<br />
liebe, nicht sehr hoch ein. Sein Denken scheint mir zu einfach. Er sieht nicht rechts noch links und nicht in die Weite; in seinem kleinen<br />
Gedankenkreis läuft er immerfort rundum oder dreht sich vielmehr.<br />
Der zweite ist schön, schlank, wohlgebaut; es entzückt, ihn in Fechterstellung zu sehen. Auch er ist klug, aber überdies welterfahren; er<br />
hat viel gesehen, und deshalb scheint selbst die heimische Natur vertrauter mit ihm zu sprechen als mit den Daheimgebliebenen. Doch<br />
ist gewiß dieser Vorzug nicht nur und nicht einmal wesentlich dem Reisen zu verdanken, er gehört vielmehr zu dem Unnachahmlichen<br />
dieses Kindes, das zum Beispiel von jedem anerkannt wird, der etwa seinen vielfach sich überschlagenden und doch geradezu wild<br />
beherrschten Kunstsprung ins Wasser ihm nachmachen will. Bis zum Ende des Sprungbrettes reicht der Mut und die Lust, dort aber statt<br />
zu springen, setzt sich plötzlich der Nachahmer und hebt entschuldigend die Arme. – Und trotz dem allen (ich sollte doch eigentlich<br />
glücklich sein über ein solches Kind) ist mein Verhältnis zu ihm nicht ungetrübt. Sein linkes Auge ist ein wenig kleiner als das rechte und<br />
zwinkert viel; ein kleiner Fehler nur, gewiß, der sein Gesicht sogar noch verwegener macht als es sonst gewesen wäre, und niemand wird<br />
gegenüber der unnahbaren Abgeschlossenheit seines Wesens dieses kleinere zwinkernde Auge tadelnd bemerken. Ich, der Vater, tue es.<br />
Es ist natürlich nicht dieser körperliche Fehler, der mir weh tut, sondern eine ihm irgendwie entsprechende kleine Unregelmäßigkeit<br />
seines Geistes, irgendein in seinem Blut irrendes Gift, irgendeine Unfähigkeit, die mir allein sichtbare Anlage seines Lebens rund zu<br />
vollenden. Gerade dies macht ihn allerdings andererseits wieder zu meinem wahren Sohn, denn dieser sein Fehler ist gleichzeitig der<br />
Fehler unserer ganzen Familie und an diesem Sohn nur überdeutlich.<br />
Der dritte Sohn ist gleichfalls schön, aber es ist nicht die Schönheit, die mir gefällt. Es ist die Schönheit des Sängers: der geschwungene<br />
Mund; das träumerische Auge; der Kopf, der eine Draperie hinter sich benötigt, um zu wirken; die unmäßig sich wölbende Brust; die<br />
leicht auffahrenden und viel zu leicht sinkenden Hände; die Beine, die sich zieren, weil sie nicht tragen können. Und überdies: der Ton<br />
seiner Stimme ist nicht voll; trügt einen Augenblick; läßt den Kenner aufhorchen; veratmet aber kurz darauf – Trotzdem im allgemeinen<br />
alles verlockt, diesen Sohn zur Schau zu stellen, halte ich ihn doch am liebsten im Verborgenen; er selbst drängt sich nicht auf, aber nicht<br />
etwa deshalb, weil er seine Mängel kennt, sondern aus Unschuld. Auch fühlt er sich fremd in unserer Zeit; als gehöre er zwar zu meiner<br />
Familie, aber überdies noch zu einer andern, ihm für immer verlorenen, ist er oft unlustig und nichts kann ihn aufheitern.<br />
Mein vierter Sohn ist vielleicht der umgänglichste von allen. Ein wahres Kind seiner Zeit, ist er jedermann verständlich, er steht auf dem<br />
allen gemeinsamen Boden und jeder ist versucht, ihm zuzunicken. Vielleicht durch diese allgemeine Anerkennung gewinnt sein Wesen<br />
etwas Leichtes, seine Bewegungen etwas Freies, seine Urteile etwas Unbekümmertes. Manche seiner Aussprüche möchte man oft
wiederholen, allerdings nur manche, denn in seiner Gesamtheit krankt er doch wieder an allzu großer Leichtigkeit. Er ist wie einer, der<br />
bewundernswert abspringt, schwalbengleich die Luft teilt, dann aber doch trostlos im öden Staube endet, ein Nichts. Solche Gedanken<br />
vergällen mir den Anblick dieses Kindes.<br />
Der fünfte Sohn ist lieb und gut; versprach viel weniger, als er hielt; war so unbedeutend, daß man sich förmlich in seiner Gegenwart<br />
allein fühlte; hat es aber doch zu einigem Ansehen gebracht. Fragte man mich, wie das geschehen ist, so könnte ich kaum antworten.<br />
Unschuld dringt vielleicht doch noch am leichtesten durch das Toben der Elemente in dieser Welt, und unschuldig ist er. Vielleicht allzu<br />
unschuldig. Freundlich zu jedermann. Vielleicht allzu freundlich. Ich gestehe: mir wird nicht wohl, wenn man ihn mir gegenüber lobt. Es<br />
heißt doch, sich das Loben etwas zu leicht zu machen, wenn man einen so offensichtlich Lobenswürdigen lobt, wie es mein Sohn ist.<br />
Mein sechster Sohn scheint, wenigstens auf den ersten Blick, der tiefsinnigste von allen. Ein Kopfhänger und doch ein Schwätzer.<br />
Deshalb kommt man ihm nicht leicht bei. Ist er am Unterliegen, so verfällt er in unbesiegbare Traurigkeit; erlangt er das Obergewicht, so<br />
wahrt er es durch Schwätzen. Doch spreche ich ihm eine gewisse selbstvergessene Leidenschaft nicht ab; bei hellem Tag kämpft er sich<br />
oft durch das Denken wie im Traum. Ohne krank zu sein – vielmehr hat er eine sehr gute Gesundheit – taumelt er manchmal, besonders<br />
in der Dämmerung, braucht aber keine Hilfe, fällt nicht. Vielleicht hat an dieser Erscheinung seine körperliche Entwicklung schuld, er ist<br />
viel zu groß für sein Alter. Das macht ihn unschön im Ganzen, trotz auffallend schöner Einzelheiten, zum Beispiel der Hände und Füße.<br />
Unschön ist übrigens auch seine Stirn; sowohl in der Haut als in der Knochenbildung irgendwie verschrumpft.<br />
Der siebente Sohn gehört mir vielleicht mehr als alle andern. Die Welt versteht ihn nicht zu würdigen; seine besondere Art von Witz<br />
versteht sie nicht. Ich überschätze ihn nicht; ich weiß, er ist geringfügig genug; hätte die Welt keinen anderen Fehler als den, daß sie ihn<br />
nicht zu würdigen weiß, sie wäre noch immer makellos. Aber innerhalb der Familie wollte ich diesen Sohn nicht missen. Sowohl Unruhe<br />
bringt er, als auch Ehrfurcht vor der Überlieferung, und beides fügt er, wenigstens für mein Gefühl, zu einem unanfechtbaren Ganzen.<br />
Mit diesem Ganzen weiß er allerdings selbst am wenigsten etwas anzufangen; das Rad der Zukunft wird er nicht ins Rollen bringen,<br />
aber diese seine Anlage ist so aufmunternd, so hoffnungsreich; ich wollte, er hätte Kinder und diese wieder Kinder. Leider scheint sich<br />
dieser Wunsch nicht erfüllen zu wollen. In einer mir zwar begreiflichen, aber ebenso unerwünschten Selbstzufriedenheit, die allerdings<br />
in großartigem Gegensatz zum Urteil seiner Umgebung steht, treibt er sich allein umher, kümmert sich nicht um Mädchen und wird<br />
trotzdem niemals seine gute Laune verlieren.<br />
Mein achter Sohn ist mein Schmerzenskind, und ich weiß eigentlich keinen Grund dafür. Er sieht mich fremd an, und ich fühle mich<br />
doch väterlich eng mit ihm verbunden. Die Zeit hat vieles gut gemacht; früher aber befiel mich manchmal ein Zittern, wenn ich nur an<br />
ihn dachte. Er geht seinen eigenen Weg; hat alle Verbindungen mit mir abgebrochen; und wird gewiß mit seinem harten Schädel, seinem<br />
kleinen athletischen Körper – nur die Beine hatte er als Junge recht schwach, aber das mag sich inzwischen schon ausgeglichen haben –<br />
überall durchkommen, wo es ihm beliebt. Öfters hatte ich Lust, ihn zurückzurufen, ihn zu fragen, wie es eigentlich um ihn steht, warum
er sich vom Vater so abschließt und was er im Grunde beabsichtigt, aber nun ist er so weit und so viel Zeit ist schon vergangen, nun mag<br />
es so bleiben wie es ist. Ich höre, daß er als der einzige meiner Söhne einen Vollbart trägt; schön ist das bei einem so kleinen Mann<br />
natürlich nicht.<br />
Mein neunter Sohn ist sehr elegant und hat den für Frauen bestimmten süßen Blick. So süß, daß er bei Gelegenheit sogar mich verführen<br />
kann, der ich doch weiß, daß förmlich ein nasser Schwamm genügt, um allen diesen überirdischen Glanz wegzuwischen. Das Besondere<br />
an diesem Jungen aber ist, daß er gar nicht auf Verführung ausgeht; ihm würde es genügen, sein Leben lang auf dem Kanapee zu liegen<br />
und seinen Blick an die Zimmerdecke zu verschwenden oder noch viel lieber ihn unter den Augenlidern ruhen zu lassen. Ist er in dieser<br />
von ihm bevorzugten Lage, dann spricht er gern und nicht übel; gedrängt und anschaulich; aber doch nur in engen Grenzen; geht er<br />
über sie hinaus, was sich bei ihrer Enge nicht vermeiden läßt, wird sein Reden ganz leer. Man würde ihm abwinken, wenn man<br />
Hoffnung hätte, daß dieser mit Schlaf gefüllte Blick es bemerken könnte.<br />
Mein zehnter Sohn gilt als unaufrichtiger Charakter. Ich will diesen Fehler nicht ganz in Abrede stellen, nicht ganz bestätigen. Sicher ist,<br />
daß, wer ihn in der weit über sein Alter hinausgehenden Feierlichkeit herankommen sieht, im immer festgeschlossenen Gehrock, im<br />
alten, aber übersorgfältig geputzten schwarzen Hut, mit dem unbewegten Gesicht, dem etwas vorragenden Kinn, den schwer über die<br />
Augen sich wölbenden Lidern, den manchmal an den Mund geführten zwei Fingern – wer ihn so sieht, denkt: das ist ein grenzenloser<br />
Heuchler. Aber, nun höre man ihn reden! Verständig; mit Bedacht; kurz angebunden; mit boshafter Lebendigkeit Fragen durchkreuzend;<br />
in erstaunlicher, selbstverständlicher und froher Übereinstimmung mit dem Weltganzen; eine Übereinstimmung, die notwendigerweise<br />
den Hals strafft und den Körper erheben läßt. Viele, die sich sehr klug dünken und die sich, aus diesem Grunde wie sie meinten, von<br />
seinem Äußern abgestoßen fühlten, hat er durch sein Wort stark angezogen. Nun gibt es aber wieder Leute, die sein Äußeres gleichgültig<br />
läßt, denen aber sein Wort heuchlerisch erscheint. Ich, als Vater, will hier nicht entscheiden, doch muß ich eingestehen, daß die letzteren<br />
Beurteiler jedenfalls beachtenswerter sind als die ersteren.<br />
Mein elfter Sohn ist zart, wohl der schwächste unter meinen Söhnen; aber täuschend in seiner Schwäche; er kann nämlich zu Zeiten<br />
kräftig und bestimmt sein, doch ist allerdings selbst dann die Schwäche irgendwie grundlegend. Es ist aber keine beschämende<br />
Schwäche, sondem etwas, das nur auf diesem unsern Erdboden als Schwäche erscheint. Ist nicht zum Beispiel auch Flugbereitschaft<br />
Schwäche, da sie doch Schwanken und Unbestimmtheit und Flattern ist? Etwas Derartiges zeigt mein Sohn. Den Vater freuen natürlich<br />
solche Eigenschaften nicht; sie gehen ja offenbar auf Zerstörung der Familie aus. Manchmal blickt er mich an, als wollte er mir sagen: ›Ich<br />
werde dich mitnehmen, Vater.‹ Dann denke ich: ›Du wärst der Letzte, dem ich mich vertraue.‹ Und sein Blick scheint wieder zu sagen:<br />
›Mag ich also wenigstens der Letzte sein.‹<br />
Das sind die elf Söhne.
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn<br />
Er sprach aber: Ein gewisser Mensch hatte zwei Söhne; und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens,<br />
der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein<br />
fernes Land, und daselbst vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Als er aber<br />
alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu<br />
leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seine<br />
Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Träbern 1 , welche die<br />
Schweine fraßen; und niemand gab ihm. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner<br />
meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen<br />
und zu meinem Vater gehen, und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und<br />
vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen; mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und<br />
er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde<br />
innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn aber sprach<br />
zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein<br />
Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten: Bringet das beste Kleid her und ziehet es<br />
ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße; und bringet das gemästete Kalb<br />
her und schlachtet es, und lasset uns essen und fröhlich sein; denn dieser mein Sohn war tot und ist<br />
wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an fröhlich zu sein.<br />
Es war aber sein älterer Sohn auf dem Felde; und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er<br />
Musik und Reigen. Und er rief einen der Knechte herzu und erkundigte sich, was das wäre. Der aber<br />
sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er<br />
ihn gesund wieder erhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber<br />
ging hinaus und drang in ihn. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene<br />
ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten; und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, auf dass ich mit meinen Freunden<br />
fröhlich wäre; da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren verschlungen hat, hast du ihm das gemästete Kalb<br />
geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist allezeit bei mir, und all das Meinige ist dein. Es geziemte sich aber fröhlich zu sein und sich<br />
zu freuen; denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden.<br />
(Übersetzung: Eberfelder Bibel 1905)<br />
1 Träber: (ohne Singular) die Hülsen von dem ausgebrautem Malz, (auch Sei, Seihe, von seihen, Aut, oder Aat genannt); mitunter auch Reste und Überbleibsel aller<br />
ausgepressten Dinge, z. B. den Weinhülsen, vom ausgepressten Weine, den Überresten der ausgepressten Ölbeeren.
Heimkehr* von Franz Kafka<br />
Ich bin zurückgekehrt, ich habe den Flur durchschritten und blicke mich um. Es ist meines Vaters alter Hof. Die Pfütze in der Mitte.<br />
Altes, unbrauchbares Gerät, ineinander verfahren, verstellt den Weg zur Bodentreppe. Die Katze lauert auf dem Geländer. Ein<br />
zerrissenes Tuch, einmal im Spiel um eine Stange gewunden, hebt sich im Wind. Ich bin angekommen. Wer wird mich empfangen? Wer<br />
wartet hinter der Tür der Küche? Rauch kommt aus dem Schornstein, der Kaffee zum Abendessen wird gekocht. Ist dir heimlich, fühlst<br />
du dich zu Hause? Ich weiß es nicht, ich bin sehr unsicher. Meines Vaters Haus ist es, aber kalt steht Stück neben Stück, als wäre jedes<br />
mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, die ich teils vergessen habe, teils niemals kannte. Was kann ich ihnen nützen, was bin<br />
ich ihnen und sei ich auch des Vaters, des alten Landwirts Sohn. Ich wage nicht an der Küchentüre zu klopfen, nur von der Ferne horche<br />
ich, nur von der Ferne horche ich stehend, nicht so, dass ich als Horcher überrascht werden könnte. Und weil ich von der Ferne horche,<br />
erhorche ich nichts, nur einen leichten Uhrenschlag höre ich oder glaube ihn vielleicht nur zu hören, herüber aus den Kindertagen. Was<br />
sonst in der Küche geschieht, ist das Geheimnis der dort Sitzenden, das sie vor mir wahren. Je länger man vor der Tür zögert, desto<br />
fremder wird man. Wie wäre es, wenn jetzt jemand die Tür öffnete und mich etwas fragte. Wäre ich dann nicht selbst wie einer, der sein<br />
Geheimnis wahren will.<br />
*Der Titel des Textes stammt von Max Brod, dem Freund und Herausgeber der Werke Franz Kafkas, der den Text erstmals 1936 in dem Buch "Beschreibung eines<br />
Kampfes" (erweiterte Ausgaben davon 1946 und 1954) veröffentlicht. Entstanden ist der Text nach Franz Kafkas Rückkehr von einem mehrwöchigen Kuraufenthalt<br />
im südtirolischen Meran nach Prag. Zunächst wohnt er dort bei seiner Schwester Elli, danach jedoch wieder in der Wohnung seiner Eltern am Altstädter Ring.
Kafkas Werk als Paradigma der modernen arabischen Literatur<br />
Josef K. und seine arabischen Söhne von Atef Botros (CNMS <strong>Marburg</strong>)<br />
Franz Kafkas Protagonisten, die sich unvermittelt in den Rädern eines unverständlichen, dabei aber nicht minderzermalmenden offiziösen Apparats<br />
finden, sind zu Ikonen moderner Befindlichkeit geworden. Ganz besonders im arabischen Raum bieten sie ein – freilich nicht konfliktfreies –<br />
Identifikationspotenzial.<br />
«Zwischen Chile und China gibt es immer irgendeinen verleumdeten Josef K., der verhaftet wird, ohne dass er etwas Böses getan hätte»,<br />
schreibt der irakische Exildichter Farouq Yusuf im Juli 2005. Josef K. ist viel mehr als die literarische Figur aus Kafkas Roman «Der<br />
Process», dessen erster Satz – «Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines<br />
Morgens verhaftet» – zu den berühmtesten und meistzitierten Sätzen der Weltliteratur zählt. Tatsächlich sind die Eben- und Nachbilder<br />
Josef K.s oder des K. aus «Das Schloss» überall dort zu finden, wo eine Realität vorherrscht, die man als kafkaesk zu bezeichnen pflegt.<br />
Vor allem in der arabischen Welt scheinen sie zu Hause zu sein. Kein Wunder. Ein Blick auf die irakische oder palästinensische<br />
Lebenswirklichkeit, auf die in Syrien oder Libyen allgegenwärtigen Kontroll- und Überwachungssysteme genügt, um festzustellen, dass<br />
die Menschen dort einem von Absurditäten diktierten Alltag und unfassbaren Mächten ausgeliefert sind. Vor diesem Hintergrund sind<br />
Kafka und sein K. für die arabischen Intellektuellen zu einer Ikone der arabischen postkolonialen Realität geworden. Der Erfinder K.s<br />
wird in der Not angerufen, wie der deutsch-irakische Schriftsteller Najem Wali 2007 schreibt: «Unabhängig von Hautfarbe, Religion,<br />
Sprache und Ort spürt jeder Mensch die Nähe eines kranken jüdischen Freundes, der in Prag lebte, seine Werke auf Deutsch verfasste<br />
und dessen Botschaft trotz des verfrühten Todes alle Zeiten überlebte; sein Name ist Franz Kafka.»<br />
Grenzüberschreitend<br />
Kafkas literarische Figuren überdauern aufgrund ihrer aussergewöhnlichen symbolischen Kraft die Zeit und überschreiten den Raum.<br />
Ihre Wirkung ist so mächtig und universal, dass sie Menschen verschiedener Zugehörigkeiten und Kontexte miteinander verbindet. In<br />
der jüdischen Kafka-Rezeptionsgeschichte lautet der K.-Satz etwa: «Jemand musste die europäischen Juden verleumdet haben, denn<br />
ohne dass sie etwas Böses getan hätten, wurden sie vernichtet und vertrieben.» Hat Kafka, dessen Schwestern in Vernichtungslagern<br />
ermordet wurden, den Holocaust prophezeit? Im Kontext des blutigen Befreiungskrieges in Algerien, der eine Million Menschenleben<br />
forderte, wurde der Satz folgendermassen umformuliert: «Jemand musste Algerien verleumdet haben, denn ohne dass es etwas Böses<br />
getan hätte, wurde es von den Franzosen 130 Jahre lang vergewaltigt.» Dem deutsch schreibenden palästinensischen Autor Wadi Sodah<br />
reicht es nicht, die palästinensischen Geschichten als kafkaesk zu bezeichnen – er reklamiert den Schriftsteller gleich für sein eigenes<br />
Volk: «Kafka und andere palästinensische Geschichten.» Warum mischt sich der Prager Jurist immer wieder in solche arabischen<br />
«Processe» ein – und warum tauchen die K.s allenthalben auf? «Kafka ist überall, er liegt in der arabischen Luft», sagt Firyal Ghazoul,<br />
eine irakische Literaturwissenschafterin an der amerikanischen Universität in Kairo. Vielleicht liegt das aber auch ebenso sehr an der
Qualität der arabischen Luft wie an der Besonderheit von Kafkas Literatur. Denn riecht nicht diese Luft nach alten,<br />
aufeinandergestapelten und verstaubten Akten wie denjenigen im «Schloss»-Roman? Habe man beispielsweise Erfahrungen mit der<br />
ägyptischen Staatsbürokratie gemacht, dann müsse man nicht Kafka gelesen haben, um so schreiben zu können, erklärt der<br />
zeitgenössische ägyptische Schriftsteller Sonallah Ibrahim gegenüber Kritikern, die behaupten, sein Werk sei von Kafka inspiriert<br />
worden. Der Protagonist in Ibrahims Roman «Der Prüfungsausschuss» muss sich einem anonymen Ausschuss stellen und wird am Ende<br />
dazu verurteilt, sich selbst zu verspeisen! Unter allen westlichen Autoren sei es Kafka, mit dem arabische Intellektuelle sich auf Anhieb<br />
identifizierten, schrieb der ägyptische Surrealist Georges Henein im Vorwort zu einer 1967 auf Französisch erschienenen Anthologie<br />
arabischer Literatur. «Eine Methodologie des Wartens ohne Objekt», nannte Henein die arabische Realität, «ein System, in welchem die<br />
Kausalität nicht mehr oder nur nach unbekannten Regeln funktioniert.» Eine der traumatischsten Erfahrungen in der modernen<br />
Geschichte der Araber ist die Niederlage von 1967, die im europäischen Kontext als Sechstagekrieg, im arabischen als Naksa<br />
(Rückschlag) bezeichnet wird. Mit seiner stürmischen Propaganda für den panarabischen Nationalismus hob Nasser die arabischen<br />
Völker in den Himmel – um sie dann im Juni 1967 abrupt fallen zu lassen. Tagelange Medienberichte über den baldigen grossen Sieg und<br />
die mächtigen arabischen Armeen, die kurz vor Tel Aviv stünden, täuschten die Massen über die Niederlage. Bis die Menschen dann<br />
erfahren mussten, dass Israel die ägyptische Luftwaffe in wenigen Stunden vernichtet hatte, dass die Sinai-Halbinsel, Cisjordanien und<br />
Gaza vollständig erobert wurden und schätzungsweise 70 000 ägyptische Soldaten in wenigen Tagen umgekommen waren. In diesem<br />
Zusammenhang schrieb der ägyptische Literaturnobelpreisträger Nagib Machfus 1984: «Gekannt habe ich Kafka schon vor mehr als<br />
vierzig Jahren, aber begegnet bin ich ihm vor allem nach der Niederlage von 1967.»<br />
Die grosse Desillusionierung<br />
Ihre Blütezeit erlebte die arabische Kafka-Rezeption in den 1960er Jahren; allein die arabische Übersetzung seiner drei Romane entstand<br />
im kurzen Zeitraum zwischen 1968 und 1971. Spätestens in den sechziger Jahren wurde es den arabischen Intellektuellen bewusst, dass<br />
sie nach dem Dekolonisierungsprozess unter ihren eigenen repressiven Regimen in eine neue Krise geraten waren. Diese Erfahrung<br />
kulminierte im Moment der Niederlage von 1967 und manifestierte sich in der literarischen Bewegung der Sechziger. Das grosse Projekt,<br />
an das die arabischen Massen geglaubt hatten, war mit der Naksa endgültig beendet. Vor diesem Hintergrund rückte die Literatur der<br />
Entfremdung und des Absurden ins Zentrum des Interesses. Die arabischen Intellektuellen entdeckten in Sartre, Camus und Kafka<br />
Möglichkeiten und Formen des literarischen Ausdrucks, die ihnen halfen, ihre komplexe Situation darzustellen. Sie konnten sich mit der<br />
Situation des verurteilten K. Identifizieren. Derjenige, der auf die Notwendigkeit der Übersetzung von Kafkas Werk aufmerksam machte,<br />
war der Denker Mahmoud Amin al-Alim, der in der arabischen Krise der 1960er Jahre als eine herausragende Figur galt. Al-Alim<br />
gehörte einer marxistischen Organisation in Ägypten an und hatte sich am antikolonialen Kampf beteiligt. Nach der Machtergreifung<br />
durch Nassers Bewegung der «Freien Offiziere» wurden 1954 zahlreiche Kommunisten ausgeschaltet. Auch al-Alim wurde ein Opfer
dieses Regimes: Er wurde vom Dienst als Dozent der Philosophie suspendiert und sass jahrelang, von 1959 bis 1964, im Gefängnis. Ein<br />
Prototyp also der arabischen Liebhaber Kafkas, die selbst zu Inkarnationen K.s wurden. Während Kafka in den sechziger Jahren diese<br />
besondere Bedeutung unter arabischen Intellektuellen erlangte, verschärfte sich die osteuropäische Polemik gegen ihn im Kontext des<br />
Kalten Krieges. Man bezeichnete ihn als dekadenten Autor, dessen Literatur im Dienste imperialistischer und zionistischer Zwecke<br />
stand. Angeregt durch diese Polemik und im Zuge des aufsteigenden arabischen Antizionismus nach 1967, stellte sich auch in der<br />
arabischen Welt plötzlich die Frage nach Kafkas Haltung zum Zionismus. Seine Rezeption als jüdischer Schriftsteller, der sich<br />
überwiegend in Kreisen des Prager Zionismus bewegt hatte, wurde nach der Verschärfung des Nahostkonfliktes entscheidend<br />
erschwert; und die Frage nach seiner Einordnung stellte sich angesichts seiner Bedeutung und Beliebtheit nur umso dringlicher.<br />
Die arabischen Intellektuellen fanden sich in einem eigentlichen Dilemma: Einerseits war Kafka eine zentrale Identifikationsfigur im<br />
Zusammenhang mit der arabischen Krise, anderseits erschien er nun auch als «Sohn des Zionismus» – der Ideologie, die letztlich als<br />
Hauptursache dieser arabischen Krise betrachtet wurde. Diese gespaltene Wahrnehmung führte zu Verwerfungen, lenkte von<br />
literarischen Interessen ab und brachte Kafka unter die Lupe politisch interessierter Kritiker, die vor allem die Kafka-Rezeption im<br />
Rahmen der marxistischen Kritik des Kalten Krieges aufgriffen und sie in den Kontext des arabisch-israelischen Konfliktes<br />
transformierten. Daraufhin kam es zu einer Polarisierung zwischen Gegnern und Fürsprechern, die durch biografische<br />
(Re-)Konstruktion oder literaturkritische Auslegung versuchten, Kafka eine politische Identität als Zionist oder Antizionist<br />
zuzuschreiben. Beide Gruppen nutzten diese Debatte als Schaubühne der politischen Auseinandersetzung mit dem Zionismus. Andere<br />
Kommentatoren hingegen distanzierten sich davon und behaupteten, die Zugehörigkeit Kafkas zum Judentum sei für das Verständnis<br />
seines Werkes gänzlich irrelevant.<br />
Ein Koffer in Palästina<br />
Mahmud Galal, ein Autor der auf Nagib Machfus folgenden Schriftstellergeneration, schrieb im Oktober 1985: «Unsere ganze Generation<br />
schlüpfte aus Nagib Machfus' Gewand [. . .] Aber was die westlichen Autoren betrifft, war es Kafka, der mir den Schlaf raubte. Von ihm<br />
bezaubert, streifte ich fassungslos die Strassen entlang.» Die Söhne Josef K.s machen in der arabischen Welt Geschichte. Vielleicht auch<br />
deshalb, weil einst Kafkas Freund Max Brod die Manuskripte des Verstorbenen in letzter Hast vor dem deutschen Einmarsch in Prag in<br />
einen Koffer packte und nach Palästina floh. Sind dort die K.s dem Koffer entronnen und haben sich unkontrolliert im Nahen Osten und<br />
in der gesamten arabischen Welt zerstreut? Sie sind heute ägyptisch, algerisch und irakisch. Sie sind sicherlich sehr jüdisch, aber<br />
vielleicht nicht minder palästinensisch. So palästinensisch, dass der grosse palästinensische Dichter Mahmud Darwish in einem seiner<br />
Gedichte schrieb: «Unter meiner Haut fand ich Kafka schlafend / heimisch in unserem Alptraumgewand, vertraut mit der Polizei in uns.»<br />
2010, http://mobile.nzz.ch/kultur/literatur/josef_k_und_seine_arabischen_soehne_1.5914579
Franz Kafka von Hannah Arendt<br />
Als Franz Kafka, ein Jude deutscher Sprache aus Prag einundvierzigjährig im Sommer des Jahres 1924 an der Schwindsucht starb, war<br />
sein Werk nur einem kleinen Kreis von Schriftstellern und einem noch kleineren Kreis von Lesern bekannt. Seither ist sein Ruf langsam<br />
und stetig gewachsen; in den zwanziger Jahren war er bereits einer der wichtigsten Autoren der Avantgarde in Deutschland und<br />
Österreich; in den dreißiger und vierziger Jahren erreichte sein Werk genau die gleichen Leser- und Schriftstellerschichten in Frankreich,<br />
England und Amerika. Die spezifische Qualität seines Ruhmes änderte sich in keinem Lande und in keinem Jahrzehnt: immer wieder<br />
stand die Auflagenhöhe seiner Werke in keinem Verhältnis zu der immer noch anwachsenden Literatur über ihn oder zu dem immer<br />
noch sich vertiefenden und verbreiternden Einfluß, den dieses Werk auf die Schriftsteller der Zeit ausübt. Es ist durchaus<br />
charakteristischfür die Wirkung der Kafkaschen Prosa, daß die verschiedensten «Schulen« ihn für sich in Anspruch zu nehmen suchen;<br />
es ist, als ob niemand, der sich für »modern« hält, an diesem Werke vorbeigehen könnte, weil hier so offenbar etwas spezifisch Neues am<br />
Werk ist, was nirgendwo sonst in der gleichen Intensität und mit der gleichen rücksichtslosen Einfachheit bisher zutage getreten ist.<br />
Dies ist sehr überraschend, weil Kafka im Gegensatz zu anderen modernen Autoren sich von allen Experimenten und allen Manierismen<br />
ferngehalten hat. Seine Sprache ist klar und einfach wie die Sprache des Alltags, nur gereinigt von Nachlässigkeit und Jargon. Zu der<br />
unendlichen Vielfal mog icher Sprachstile verhält sich das Kafkasche Deutsch wie Wasser sich verhält zu der unendlichen Vielfalt<br />
möglicher Getränke. Seine Prosa scheint durch nichts Besonderes ausgezeichnet, sie ist nirgends in sich selbst bezaubernd oder betörend;<br />
sie ist vielmehr reinste Mitteilung, und ihr einziges Charakteristikum ist, daß – sieht man genauer zu – es sich immer wieder herausstellt,<br />
daß man dies Mitgeteilte einfacher und klarer und kürzer keinesfalls hätte mitteilen können. Der Mangel an Manieriertheit ist hier fast<br />
bis an die Grenze der Stillosigkeit, der Mangel an Verliebtheit in Worte als solche fast bis an die Grenze der Kälte getrieben. Kafka kennt<br />
keine Lieblingsworte, keine bevorzugten syntaktischen Konstruktionen. Das Resultat ist eine neue Art der Vollkommenheit, die von allen<br />
Stilen der Vergangenheit gleich weit entfernt zu sein scheint. Es gibt in der Geschichte der Literatur kaum ein überzeugenderes Beispiel<br />
für die Verkehrtheit der Theorie vom »verkannten Genie« als die Tatsache des Kafkaschen Ruhmes. In diesem Werk gibt es nicht eine<br />
Zeile und nicht eine einzige Geschichtskonstruktion, die dem Leser, so wie er sich im Verlauf des vorigen Jahrhunderts herausgebildet<br />
hat, in einer Suche nach »Unterhaltung und Belehrung« (Broch) entgegenkäme. Das einzige, was den Leser in Kafkas Werk lockt und<br />
verlockt, ist die Wahrheit selbst, und diese Verlockung ist Kafka in seiner stillosen Vollkommenheit – jeder »Stil« würde durch seinen<br />
eigenen Zauber von der Wahrheit ablenken – bis zu dem unglaublichen Grade geglückt, daß seine Geschichten auch dann in Bann<br />
schlagen, wenn der Leser ihren eigentlichen Wahrheitsgehalt erst einmal nicht begreift. Kafkas eigentliche Kunst besteht darin, daß der<br />
Leser eine unbestimmte, vage Faszination, die sich mit der unausweichlich klaren Erinnerung an bestimmte, erst scheinbar sinnlose<br />
Bilder und Begebenheiten paart, so lange aushält und sie so entscheidend in sein Leben mitnimmt, daß ihm irgendwann einmal, auf<br />
Grund irgendeiner Erfahrung plötzlich die wahre Bedeutung der Geschichte sich enthüllt mit der zwingenden Leuchtkraft der Evidenz.<br />
»Der Prozeß«, über den eine kleine Bibliothek von Auslegungen in den zwei Jahrzehnten, die seit seinem Erscheinen verstrichen sind,<br />
veröffentlicht worden ist, ist die Geschichte des Mannes K., der angeklagt ist, ohne zu wissen, was er getan hat, dem ein Prozeß gemacht<br />
wird, ohne daß er herausfinden kann, nach welchen Gesetzen der Prozeß und das Urteil gehandhabt werden, und der schließlich<br />
hingerichtet wird, ohne je erfahren zu haben, worum es sich eigentlicn gehandelt hat. Auf der Suche nach dem wahre Grund dieser
Begebenheit findet er erst einmal heraus, daß hinter seiner Verhaftung »eine große Organisation sich befindet. Eine Organisation, die<br />
nicht nur bestechliche Wächter, läppische Aufseher und Untersuchungsrichter die günstigstenfalls bescheiden sind, beschäftigt, sondern<br />
die weiterhin jedenfalls eine Richterschaft hohen und höchsten Grades unterhält, mit dem zahllosen, unumgänglichen Gefolge von<br />
Dienern, Schreibern, Gendarmen und anderen Hilfskräften, vielleicht sogar Henkern .. . Und der Sinn dieser großen Organisation ...? Er<br />
besteht darin, daß unschuldige Personen verhaftet werden und gegen sie ein sinnloses und meistens, wie in meinem Fall, ergebnisloses<br />
Verfahren eingeleitet wird«.<br />
Als K. merkt, daß solche Verfahren trotz ihrer Sinnlosigkeit nicht unbedingt ergebnislos zu verlaufen brauchen, nimmt er sich einen<br />
Rechtsanwalt, der ihm in langen Reden auseinandersetzt, auf welche Weise man sich den bestehenden Zuständen anpassen kann und<br />
wie unvernünftig es sei sie zu kritisieren. K., der sich nicht fügen will und seinen Advokaten entläßt, trifft mit dem Gefängnisgeistlichen<br />
zusammen, der ihm die verborgene Größe des Systems predigt und ihm anrät, nicht mehr nach der Wahrheit zu fragen, denn »man muß<br />
nicht alles für wahr halten, man muß es nur für notwendig halten«. Mit anderen Worten, wenn der Advokat sich nur bemühte zu<br />
demonstrieren: So ist die Welt, hat der von dieser Welt angestellte Geistliche die Aufgabe zu erweisen: Dies ist die Weltordnung. Und da<br />
K. dies für eine »trübselige Meinung« hält und erwidert: »Die Lüge wird zur Weltordnung gemacht«, ist es klar, daß er seinen Prozeß<br />
verlieren wird; da andererseits dies nicht »sein Endurteil« war und er versuchte, die »ungewohnten Gedankengänge« als »unwirkliche<br />
Dinge«, die ihn im Grunde nichts angingen, abzuweisen, verliert er nicht nur den Prozeß, sondern verliert ihn auf eine schmähliche<br />
Weise, so daß er schließlich der Hinrichtung nichts entgegenzusetzen hat als seine Scham.<br />
Die Macht der Maschine, die K. ergreift und umbringt, ist nichts anderes als der Schein der Notwendigkeit, der sich realisieren kann<br />
durch die Bewunderung der Menschen für<br />
Notwendigkeit. Die Maschine kommt in Gang, weil Notwendigkeit für etwas Erhabenes gehalten wird und weil ihr Automatismus, der<br />
nur von Willkür unterbrochen wird, für das Sinnbild der Notwendigkeit genommen wird. Die Maschine wird in Gang gehalten durch<br />
die Lügen um der Notwendigkeit willen, so daß in voller Konsequenz ein Mann, der sich nicht dieser »Weltordnung«, dieser Maschine<br />
unterwerfen will, als Verbrecher gegen eine Art örtlicher Ordnung angesehen wird. Solche Unterwerfung ist dann erreicht, wenn die<br />
Frage nach Schuld und Unschuld völlig verstummt und an ihre Stelle die Entschlossenheit getreten ist, die von der Willkür befohlene<br />
Rolle im Spiel der Notwendigkeit zu spielen. Im Falle des »Prozesses« wird die Unterwerfung nicht durch Gewalt erreicht, sondern<br />
einfach durch das wachsende Schuldgefühl, das die unbegründete leere Anschuldigung im angeklagten K. erweckt. Dieses Gefühl<br />
beruht natürlich letzten Endes auf der Tatsache, daß kein Mensch frei von Schuld ist. Im Falle des K„ der, ein vielbeschäftigter<br />
Bankbeamter, nie Zeit gehabt hat, über solche Allgemeinheiten sich den Kopf zu zerbrechen, wird dies Schuldgefühl zum eigentlichen<br />
Verhängnis; es führt ihn nämlich in jene Verwirrung, in welcher er das organisierte und bösartige Übel seiner Umwelt verwechselt mit<br />
dem Ausdruck jener allgemein menschlichen Schuld, die harmlos und eigentlich unschuldig ist verglichen mit dem bösen Willen, der<br />
»die Lüge zur Weltordnung« macht und für diese Weltordnung selbst des Menschen berechtigte Demut brauchen und<br />
mißbrauchen kann.<br />
Das Funktionieren der bösartig bürokratischen Maschine, in die der Held unschuldig sich verfangen hat, wird also begleitet durch eine<br />
innere Entwicklung, welche durch das Schuldgefühl ausgelöst worden ist. In dieser Entwicklung wird er »erzogen«, verändert und<br />
gebildet, bis er in die Rolle, die ihm zugemutet wurde, hineinpaßt und befähigt ist, in der Welt der Notwendigkeit, der Ungerechtigkeit
und der Lüge schlecht und recht mitzuspielen. Dies ist seine Art, sich den herrschenden Zuständen anzupassen. Die innere Entwicklung<br />
des Helden und das Funktionieren der Maschine treffen schließlich in der letzten Szene der Hinrichtung zusammen, als K. sich ohne<br />
Sträuben, ja ohne Widerrede abführen und töten läßt. Um der Notwendigkeit willen wird er ermordet, um der Notwendigkeit willen<br />
und in der Verwirrung des Schuldbewußtseins unterwirft er sich. Und die einzige Hoffnung, die am äußersten Ende der<br />
Romanhandlung blitzartig auftaucht, ist: »Es war als sollte; die Scham ihn überleben.« Die Scham nämlich, daß dies die Weltordnung ist<br />
und er, Josef K., wenn auch als ihr Opfer, ein gehorsames Glied derselben. Daß der »Prozeß« eine Kritik der bürokratischen<br />
Regierungsform des alten Österreich impliziert, dessen zahlreiche und sich bekämpfende Nationalitäten durch eine uniforme<br />
Beamtenhierarchie regiert wurden, wurde gleich bei Erscheinen des Romans erkannt. Kafka, Angestellter einer<br />
Arbeitsversicherungsgesellschaft und Freund osteuropäischer Juden, denen er die Aufenthaltserlaubnis in Österreich zu verschaffen<br />
hatte, kannte die politischen Zustände seines Landes sehr genau. Er wußte, daß, hatte sich einer erst einmal in den Maschen des<br />
bürokratischen Apparates verfangen, er auch schon verurteilt war. Die Herrschaft der Bürokratie brachte es mit sich, daß die Auslegung<br />
des Gesetzes zum Instrument der Gesetzlosigkeit wurde, wobei die chronische Aktionsunfähigkeit der Gesetzinterpreten durch einen an<br />
sich sinnlosen Automatismus in der niederen Beamtenhierarchie kompensiert wurde, dem alle eigentlichen Entscheidungen überlassen<br />
waren. Da aber in den zwanziger Jahren, als der Roman zum ersten Mal erschien, das eigentliche Wesen der Bürokratie in Europa noch<br />
nicht hinlänglich bekannt war, beziehungsweise nur einer verschwindend kleinen Schicht von europäischen Menschen wirklich zum<br />
Verhängnis geworden war, schien das Entsetzen und der Schrecken, die im Roman zum Ausdruck kommen, unerklärlich, seinem<br />
eigentlichen Inhalt gleichsam nicht adäquat. Man erschrak mehr vor dem Roman als vor der Sache selbst. So begann man nach anderen,<br />
scheinbar tieferen Auslegungen zu suchen und fand sie, der Mode der Zeit folgend, in einer kabbalisieren-den Darstellung religiöser<br />
Realitäten, gleichsam einer satanischen Theologie. Daß solche Irrtümer möglich waren – und dies Mißverständnis ist nicht weniger<br />
fundamental, wenn auch weniger<br />
vulgär, als das Mißverständnis der psychoanalytischen Auslegungen Kafkas selber. Kafka beschreibt wirkIich eine Gesellschaft, die sich<br />
für die Stellvertretung Gottes auf Erden hält und schildert Menschen, welche die Gesetze solch einer Gesellschaft als göttliche Gebote<br />
betrachten – unwandelbar durch menschlichen Willen. Das Böse der Welt, in die Kafkas Helden sich verstricken, ist gerade die<br />
Vergottung, ihre Anmaßung, einge göttliche Notwendigkeit darzustellen. Kafka ist darauf aus, diese Welt zu zerstören, indem er ihre<br />
scheußliche Struktur überdeutlich nachzeichnet und so Wirklichkeit und Anspruch einander gegenüberstellt. Aber der Leser der<br />
zwanziger Jahre, bezaubert von Paradoxen, verwirrt von dem Spiel der Gegensätze als solchen, wollte auf Vernunft nicht hören. Seine<br />
Auslegungen von Kafka offenbarten mehr über ihn selbst als über Kafka; in seiner naiven Bewunderung der Welt. Die Kafka in solcher<br />
Überdeutlichkeit als unerträglich scheußlich dargestellt hatte, enthüllte er seine eigene Eignung für die »Weltordnung«, enthüllte er, wie<br />
eng die sogenannte Elite und Avantgarde dieser Weltordnung verbunden waren. Die sarkastisch-bittere Bemerkung Kafkas über die<br />
verlogene Notwendigleit und das notwendige Lügen, die zusammen die »Göttlichkeit« dieser Weltordnung ausmachen, und welche so<br />
deutlich den eigentlichen Schüssel zu der Konstruktion der Romanhandlung darstellt, wurde einfach übersehen.<br />
Kafkas zweiter großer Roman, »Das Schloß«, führt uns in gleiche Welt, die aber diesmal nicht durch die Augen eines Menschen gesehen<br />
wird, der sich um seine Regierung und andere Fragen allgemeiner Natur nie gekümmert hat und daher hifllos dem Schein der<br />
Notwendigkeit ausgeliefert ist, sondern durch die Augen eines anderen K., der aus
freiem Willen zu ihr kommt, als Fremder, und in ihr ein bestimmtes Vorhaben ausführen will: sich niederlassen, ein Mitbürger werden,<br />
sich sein Leben aufbauen, heiraten,<br />
Arbeiten, kurz, ein nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft werden.<br />
Das Charakteristische für die Handlung im »Schloß« ist, daß der Held nur an dem Allerallgemeinsten interessiert ist und nur um Dinge<br />
kämpft, die eigentlich dem Menschen von Geburt garantiert scheinen. Aber während er nicht mehr verlangt als das Minimum<br />
menschlicher Existenz, wird doch gleich zu Beginn klar, daß er dies Minimum als Recht verlangt und nichts weniger als sein Recht<br />
akzeptieren wird. Er ist bereit, alle nötigen Eingaben zu machen, um die Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, aber als Gnadengeschenk<br />
will er sie nicht; er ist bereit, seinen Beruf zu wechseln, aber auf »geregelte Arbeit« kann er nicht verzichten. All dies hängt von den<br />
Entscheidungen des Schlosses ab, und die Schwierigkeiten K.s beginnen, als sich; herausstellt, daß das Schloß Rechte nur als<br />
Gnadengeschenke vergibt oder als Vorrechte. Und da K. Recht will und nicht Vorrechte, Mitbürger der Dorfbewohner werden und<br />
»möglichst weit den Herren vom Schloß entrückt« sein möchte, lehnt er beides ab, das Gnadengeschenk und die auszeichnenden<br />
Beziehungen zum Schloß: so, hofft er, werden »sich ihm gewiß mit einem Schlage alle Wege erschließen, die ihm, wenn es nur auf die<br />
Herren oben und ihre Gnade angekommen wäre, für immer nicht nur versperrt, sondern unsichtbar geblieben wären«.<br />
An dieser Stelle treten die Dorfbewohner in das Zentrum der Handlung. Sie sind erschreckt, daß K. einfach einer der ihren werden will,<br />
ein einfacher »Dorfarbeiter«, daß er es ablehnt, ein Glied der herrschenden Gesellschaft zu werden. Wieder und wieder suchen sie ihm<br />
klarzumachen, daß es ihm an allgemeiner Welt- und Lebenserfahrung fehle, daß er nicht wisse, wie es um das Leben bestellt sei, das<br />
nämlich wesentlich von Gnade und Ungnade abhänge, Segen oder Fluch sei, und daß kein wirklich wichtiges und entscheidendes<br />
Ereignis verständlicher oder weniger zufällig sei als Glück und Unglück. K. will nicht verstehen, daß für die Dorfbewohner auch Recht<br />
und Unrecht, beziehungsweise im Recht oder im Unrecht sein, noch Teil des Schicksals ist, das man hinzunehmen hat, das man erfüllen<br />
kann aber nicht ändern.<br />
Von hier ab erscheint die Fremdheit des zugereisten Landvermessers K., der kein Dorfbewohner ist und kein Schloßbeamter und daher<br />
außerhalb der Herrschaftsverhältnisse der ihn umgebenden Welt steht, erst in ihrer eigentlichen Bedeutung. In seinem Insistieren auf<br />
den Sachenrechten erweist sich der Fremde als der einzige, der noch einen Begriff von einem einfach menschlichen Leben in der Welt<br />
hat. Die spezifische Welterfahrung der Dorfbewohner hat sie gelehrt, all dies, Liebe und Arbeit und Freundschaft, als eine Gabe<br />
anzusehen, die sie »von oben« aus den Regionen des Schlosses empfangen mögen, deren sie selbst aber keinesfalls mehr Herr sind. So<br />
haben sich die einfachsten Beziehungen ins geheimnisvoll Dunkle gehüllt was im Prozeß die Weltordnung war, tritt hier als Schicksal<br />
auf, als Segen oder Fluch, dem man sich mit Furcht und Ehrfurcht interpretierend unterwirft. K.s Vorsatz, sich auf einem Rechtsboden<br />
selbst das zu schaffen und zu verschaffen, was zu einem menschlichen Leben gehört, wirkt daher keineswegs als selbstverständlich,<br />
sondern ist in dieser Welt ganz und gar eine Ausnahme, und als solche ein Skandal K. wird darum gezwungen, für ein Minimum<br />
menschlicher Forderungen so zu kämpfen, als wäre in ihnen ein wahnwitziges Maximum menschlicher Wunsche überhaupt beschlossen,<br />
und die Dorfbewohner rucken von ihm ab, weil sie in seinem Verlangen nur eine alles und alle bedrohende Hybris zu vermuten<br />
vermögen. K. ist ihnen fremd, nicht weil er der Menschenrechte als Fremder beraubt ist, sondern weil er kommt und sie verlangt. Trotz<br />
der Furcht der Dorfbewohner, die jeden Augenblick eine Katastrophe für K. befürchten, passiert ihm eigentlich gar nichts. Er erreicht<br />
allerdings auch nichts, und der nur mündlich von Kafka mitgeteilte Schluß sah seinen Tod aus Erschöpfung – also einen völlig
natürlichen Tod – vor. Das einzige, was K. erreicht, erreicht er ohne Absicht; es gelingt ihm, nur durch seine Haltung und seine<br />
Beurteilung der um ihn herum vorgehenden Dinge, einigen der Dorfbewohner die Augen zu öffnen: »Du hast einen erstaunlichen<br />
Überblick . . . manchmal hilfst du mir mit einem Wort, es ist wohl, weil du aus der Fremde kommst. Wir dagegen, mit unseren traurigen<br />
Erfahrungen und fortwährenden Befürchtungen erschrecken ja, ohne uns dagegen zu wehren, schon über jedes Knacken des Holzes,<br />
und wenn der eine erschrickt, erschrickt auch gleich der andere und weiß nun nicht einmal den richtigen Grund. Auf solche Weise kann<br />
man zu keinem richtigen Urteil kommen … Was für ein Glück ist es für uns, daß du gekommen bist.« K. wehrt sich gegen diese Rolle; er<br />
ist nicht als »Glücksbringer« gekommen, er hat keine Zeit und keine überflüssige Kraft, um andern zu helfen; wer solches von ihm<br />
geradezu verlangt, »verwirrte seine Wege« 1 . Er will nichts als sein eigenes Leben in Ordnung bringen und in Ordnung halten. Da er im<br />
Verfolg dieses Vorhabens, anders als der K. im »Prozeß«, sich nicht dem scheinbar Notwendigen unterwirft, wird nicht Scham, sondern<br />
Erinnerung der Dorfbewohner ihn überleben.<br />
Kafkas Welt ist zweifellos eine furchtbare Welt. Daß sie mehr als ein Alptraum ist, daß sie vielmehr strukturell der Wirklichkeit, die wir<br />
zu erleben gezwungen wurden, unheimlich adäquat ist, wissen wir heute vermutlich besser als vor zwanzig Jahren. Das Großartige<br />
dieser Kunst liegt darin beschlossen, daß sie heute noch so erschütternd wirken kann wie damals, daß der Schrecken der »Strafkolonie«<br />
durch die Realität der Gaskammern nichts an Unmittelbarkeit eingebüßt hat. Wäre Kafkas Dichtung wirklich nichts als Prophezeiung<br />
eines kommenden Schreckens, so wäre sie genauso billig wie alle andern Untergangsprophetien, mit denen wir seit Beginn unseres<br />
Jahrhunderts oder vielmehr seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts heimgesucht worden sind. Charles Peguy, der selbst oft die<br />
zweifelhafte Ehre gehabt hat, unter die Propheten gerechnet zu werden, bemerkte einmal: »Der Determinismus, sofern er überhaupt<br />
vorgestellt werden kann, ist vielleicht nichts anderes als das Gesetz def Rückstände.« Hierin liegt eine sehr präzise Wahrheit. Insofern<br />
Leben ohnehin unausweichlich und natürlicherweise vom Tod beschlossen wird, kann sein Ende allerdings immer vorausgesagt werden.<br />
Der natürliche Weg ist immer der Weg des Untergangs, und eine Gesellschaft, die sich blind der Notwendigkeit der in ihr selbst<br />
beschlossenen Gesetze anheimgibt, kann immer nur untergehen. Propheten sind notwendigerweise immer Ungluckspropheten, weil die<br />
Kastrophe immer vorausgesagt werden kann. Das Wunder ist immer die Rettung und nicht der<br />
Untergang; denn nur die Rettung, und nicht der Untergang, hängt von der Freiheit des Menschen ab und seiner Kapazität, die Welt und<br />
ihren natürlichen Ablauf zu ändern. Der in Kafkas wie unserer Zeit so verbreitete Wahn, daß es die Aufgabe des Menschen sei, sich<br />
einem von gleich welchen Mächten vorherbestimmten Prozeß zu untrwerfen, kann den natürlichen Untergang nur beschleunigen, weil<br />
in solchem Wahn der Mensch mit seiner Freiheit der Natur und ihrer Untergangstendenz gleichsam zu Hilfe kommt.<br />
Die Worte des Gefängniskaplans im »Prozeß« enthüllen die geheime Theologie und den innersten Glauben der Beamten als Glauben an<br />
Notwendigkeit überhaupt, und die Beamten sind letztlich die Funktionäre der Notwendigkeit – als ob es der Funktionäre überhaupt<br />
bedürfte, um den Untergang und das Verderben zum Funktionieren zu bringen.<br />
Als Funktionär der Notwendigkeit wird der Mensch der höchst überflüssige Funktionär des natürlicben Gesetzes des Vergehens, und da<br />
er mehr als Natur ist, erniedrigt er sich dadurch zum Werkzeug aktiver Zerstörung. Denn so sicher wie ein von Menschen nach<br />
menschlichen Gesetzen erbautes Haus verfallen wird, sobald der Mensch es verläßt und seinem natürlichen Schicksal überläßt, so<br />
1 Mitgeteilt im Anhang der dritten Ausgabe von „Das Schloß“, New York 1946 (Frankfurt a.M. 1951)
sicher wird die von Menschen erbaute und nach menschlichen funktionierende Welt wieder ein Teil der Natur zu werden und ihrem<br />
katastrophalen Untergang anheimgegeben sein, wenn der Mensch beschließt, selbst wieder ein Teil der Natur zu werden - ein blindes<br />
aber mit höchster Präzision arbeitendes Werkzeug der Naturgesetze. Für diesen Sachzusammenhang ist es verhältnismäßig gleichgültig,<br />
ob der notwendigkeitsbesessene Mensch an Untergang glaubt oder an Fortschritt. Wäre Fortschritt wirklich notwendig«, wirklich ein<br />
unvermeidliches, übermenschliches Gesetz, welches alle Zeiten unserer Geschichte gleichermaßen umspannt, und in dessen Netz die<br />
Menschheit unentrinnbar gefangen ist, dann konnte man allerdings die Macht und den Gang des Fortschritts nicht besser und exakter<br />
beschreiben als in den folgenden Zeilen aus Walter Benjamins »Geschichtsphilosophischen-Thesen«:<br />
»Der Engel der Geschichte ... hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da<br />
sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl<br />
verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln<br />
verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt unaufhaltsam in die Zukunft, der er den<br />
Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.«<br />
Vielleicht ist der beste Beweis dafür, daß Kafka nicht in die Reihe der neueren Weissager gehört, die Tatsache, daß uns beim Lesen seiner<br />
grauenhaftesten und grausamsten Geschichten, die doch alle von der Wirklichkeit inzwischen erfüllt, wenn nicht übertroffen worden<br />
sind, immer noch das Gefühl der Unwirklichkeit überkommt. Da sind seine Helden, die oft nicht einmal einen Namen haben, sondern<br />
nur mit Anfangsbuchstaben geführt werden. Aber selbst wenn diese verführerische Anonymität nur dem Zufall der Unvollendetheit der<br />
Erzählungen geschuldet wäre - diese Helden sind keinesfalls wirkliche Menschen, Personen, die wir in der wirklichen Welt treffen<br />
könnten; trotz eingehender Schilderungen fehlen ihnen gerade jene einzelnen und einmaligen Eigenschaften, jene kleinen und oft<br />
überflüssigen Charakterzüge, die alle zusammen erst einen wirklichen Menschen ausmachen. Sie bewegen sich in einer Gesellschaft, in<br />
der jedem eine ganz bestimmte Rolle zugewiesen wird, in der jeder durch seinen Beruf gewissermaßen definiert ist; und sie<br />
unterscheiden sich von dieser Gesellschaft und nehmen die zentrale Stelle in der Handlung nur dadurch ein, daß sie keinen bestimmten<br />
Platz in dieser Welt der Berufstätigen haben, daß ihre Rolle schlechthin unbestimmbar ist. Dies aber heißt, daß auch die<br />
Nebenpersonen nicht wirkliche Menschen sind. Mit Realität im Sinne der realistiscnen Romane haben diese Erzahlungen nichts zu tun.<br />
Wenn die Kafkasche Welt auf diesen der äußeren Wirklichkeit abgelauschten Realitätscharakter des realistischen Romans gänzlich<br />
verzichtet, so verzichtet sie vielleicht noch radikaler auf jenen der inneren Wirklichkeit abgelauschten Realitätscharakter des<br />
psychologischen Romans. Die Menschen unter denen sich die Kafkaschen Helden bewegen, haben keine psychologischen Eigenschaften,<br />
weil sie außerhalb ihrer Rollen, außerhalb ihrer Stellungen und Berufe gar nicht existieren; und seine Helden haben keine psychologisch<br />
definierbaren Eigenschaften, weil sie von ihrem jeweiligen Vorhaben - dem Gewinnen eines Prozesses, der Erreichung von Aufenthalts-<br />
und Arbeitserlaubnis und so weiter - vollkommen und bis zum Rande ihrer Seele ausgefüllt sind. Diese eigenschaftslose Abstraktheit der<br />
Kafkaschen Menschen kann leicht verführen, sie für Exponenten von Ideen, für Repräsentanten von Meinungen zu halten, und alle<br />
zeitgenössischen Versuche, in das Kafkasche Werk eine Theologie hineinzuinterpretieren, hängen faktisch mit diesem Mißverständnis<br />
zusammen. Sieht man sich demgegenüber die Kafkasche Romanwelt unbefangen und ohne vorgefaßte Meinungen an, so wird schnell<br />
klar, daß seine Personen gar nicht die Zeit und gar nicht die Möglichkeit haben individuelle Eigenschaften auszubilden. Wenn sich zum<br />
Beispiel in »Amerika« die Frage erhebt, ob der Oberportier des Hotels nicht vielleicht den Helden mit einer anderen Person versehentlich
verwechselt hat, so lehnt der Portier diese Möglichkeit mit der Begründung ab, daß, könnte er Leute miteinander verwechseln, er ja nicht<br />
mehr Oberportier bleiben könne; sein Beruf besteht ja gerade darin Menschen nicht miteinander zu verwechseln. Die Alternative ist<br />
ganz klar: entweder ist er ein Mensch, behaftet mit der Fehlbarkeit menschlicher Wahrnehmung und Erkenntnis, oder er ist ein<br />
Oberportier und hat dann zum mindesten eine Art übermenschlicher Vollkommenheit in dieser seiner Funktion zu prätendieren.<br />
Angestellte, die die Gesellschaft zwingt, mit der Präzision der Unfehl barkeit zu arbeiten, werden darum noch nicht unfehlbar. Kafkas<br />
Beamte, Angestellte, Arbeiter und Funktionäre sind weit davon entfernt, unfehlbar zu sein; aber sie alle handeln unter der<br />
Voraussetzung einer übermenschlicheen universal-kompetenten Tüchtigkeit. Der Unterschied zwischen der Kafkaschen und der<br />
üblichen Romantechnik besteht darin, daß Kafka den ursprünglichen Konflikt eines Funktionärs zwischen seiner Privatexistenz und<br />
seiner Funktion nicht mehr beschreibt, daß er sich nicht mehr dabei aufhält zu erzählen, wie das Amt das Privatleben des Betreffenden<br />
und Betroffenen aufgefressen hat, oder wie seine private Existenz, seine Familie zum Beispiel, ihn gezwungen hat, unmenschlich zu<br />
werden und sich mit seiner Funktion permanent so zu identifizieren, wie sonst nur der Schauspieler sich mit seiner Rolle identifiziert für<br />
die kurze Dauer des Spiels. Kafka konfrontiert uns sofort mit dem Ergebnis einer solchen Entwicklung, denn nur das Ergebnis ist für ihn<br />
relevant. Das Vorgeben einer universalen Kompetenz, der Schein einer übermenschlichen Tüchtigkeit ist der verborgene Motor, der die<br />
Maschinerie der Vernichtung, in welcher Kafkas Helden gefangen sind, bedient und für den reibungslosen Ablauf des in sich Sinnlosen<br />
verantwortlich ist. Das Hauptthema der Kafkaschen Romane ist der Konflikt zwischen einer Welt, die in der Form einer solchen<br />
reibungslos funktionierenden Maschinerie dargestellt ist, und einem Helden, der versucht, sie zu zerstören. Diese Helden wiederum sind<br />
nicht einfach Menschen, wie wir ihnen täglich in der Welt begegnen, sondern variierende Modelle eines Menschen überhaupt, dessen<br />
einzig unterscheidende Qualität eine, unbeirrbare Konzentration auf allgemeinst Menschliches ist. Seine Funktion in der<br />
Romanhandlung ist immer die gleiche: er entdeckt, daß die Welt und Gesellschaft der Normalität faktisch anormal sind, daß die Urteile<br />
der von allen akzeptierten Wohlanständigen faktisch verrückt sind, und daß die Handlungen, welche den Regeln dieses Spiels konform<br />
gehen, faktisch alle ruinieren. Der Antrieb der Kafkaschen Helden sind nicht irgendwelche revolutionäre Überzeugungen; er ist einzig<br />
und allein der gute Wille, der, fast ohne es zu wissen oder zu wollen, die geheimen Strukturen dieser Welt bloßlegt. Der Effekt von<br />
Unwirklichkeit und Neuartigkeit in der Kafkaschen Kunst des Erzählens ist hauptsächlich seinem Interesse an diesen verdeckten<br />
Strukturen und seiner radikalen Desinteressiertheit an den Fassaden, an den Aspekten und dem rein Phänomenalen der Welt geschuldet.<br />
Es ist darum ganz falsch, Kafka zu den Surrealisten zu zählen, während der Surrealist versucht, so viele und widersprechende Aspekte<br />
und Ansichten der Wirklichkeit als möglich zu zeigen, erfindet Kafka solche Aspekte völlig frei, verläßt sich hier nie auf die Wirklichkeit,<br />
weil sein eigentliches Anliegen nicht Wirklichkeit, sondern Wahrheit ist. Im Gegensatz zu der bei allen Surrealisten so beliebten Technik<br />
der Photomontage könnte man Kafkas Technik noch am ehesten mit der Konstruktion von Modellen vergleichen. So wie ein Mann, der<br />
ein Haus bauen oder eines Hauses Stabilität beurteilen will, sich einen Grundriß des Gebäudes anfertigen wird, so konstruiert sich Kafka<br />
gleichsam die Grundrisse der bestehenden Welt. Mit einem wirklichen Haus verglichen ist sein Grundriß natürlich etwas sehr<br />
»Unwirkliches«; aber ohne ihn hätte man das Haus nicht bauen können, ohne ihn kann man die Grundmauern und Pfeiler nicht<br />
erkennen, die allein ihm in der wirklichen Welt Bestand verleihen. Aus diesem von der Wirklichkeit her konstruierten Grundriß, dessen<br />
Auffindung natürlich sehr viel eher das Ergebnis eines Denkprozesses als einer Sinneserfahrung ist, baut Kafka seine Modelle. Zu ihrem<br />
Verständnis bedarf der Leser der gleichen Einbildungskraft, die am Werke war, als sie entstanden, und er kann dies Verständnis aus der
Einbildungskraft her leisten, weil es sich hier nicht um freie Phantasie, sondern um Resultate des Denkens selbst handelt, die als<br />
Elemente für die Kafkaschen Konstruktionen benutzt werden. Zum ersten Male in der Geschichte der Literatur verlangt ein Künstler von<br />
seinem Leser das Wirken der gleichen Aktivität, die ihn und sein Werk trägt, Und diese ist nichts anderes als jene Einbildungskraft, die<br />
nach Kant »sehr mächtig (ist) in Schaffung gleichsam einer anderen Natur aus dem Stoffe, den ihr die wirkliche gibt«. So können auch<br />
Grundrisse nur von denen verstanden werden, die fähig und willens sind, sich die Absichten des Architekten und die zukünftigen<br />
Aspekte des Gebäudes lebendig vorzustellen.<br />
Es ist diese Anstrengung einer realen Einbildungskraft die Kafka überall vom Leser verlangt. Deshalb kann der rein passive Leser, wie er<br />
von der Tradition des Romans erzogen und gebildet wurde, und dessen einzige Aktivität in der Identifikation mit einer der<br />
Romanfiguren besteht, mit Kafka so wenig anfangen. Das gleiche gilt für den neugierigen Leser, der aus Enttäuschung über sein eigene<br />
Leben Umschau hält nach einer Ersatzwelt, in der Dinge geschehen, die in seinem Leben durchaus nicht vorkommen wollen, oder der<br />
aus echter Wissensbegierde nach Belehrung ausschaut. Kafkas Erzählungen werden ihn noch mehr enttäuschen als sein eigenes Leben;<br />
sie enthalten keinerlei Elemente von Tagträumen, und sie bieten weder Rat, noch Belehrung, noch Trost. Nur der Leser, der, aus welchen<br />
Gründen und in welcher Unbestimmtheit auch immer selbst auf der Suche nach Wahrheit ist, wird mit Kafka und seinen Modellen etwas<br />
anzufangen wissen, und er wird dankbar sein, wenn manchmal auf einer einzigen Seite oder sogar in einem einzigen Satz plötzlich die<br />
nackte Struktur ganz banaler Ereignisse sichtbar wird. Charakteristisch für diese abstrahierende und nur das Wesentliche<br />
bestehenlassende Kunst ist die folgende kleine Erzählung, die noch dazu von einer besonders einfachen und häufigen Begebenheit<br />
handelt:<br />
Eine alltägliche Verwirrung<br />
Ein alltäglicher Vorgang: sein Ertragen eine alltägliche Verwirrung. A. hat mit B. aus H. ein wichtiges Geschäft abzuschließen. Er geht zur<br />
Vorbesprechung nach H., legt den Hin- und Herweg in je zehn Minuten zurück und rühmt sich zu Hause dieser besonderen<br />
Schnelligkeit. Am nächsten Tag geht er wieder nach H., diesmal zum endgültigen Geschäftsabschluß. Da dieser voraussichtlieh mehrere<br />
Stunden erfordern wird, geht A. sehr früh morgens fort. Obwohl aber alle Nebenumstände, wenigstens nach A.s Meinung, völlig die<br />
gleichen sind wie am Vortag, braucht er diesmal zum Weg nach H, zehn Stunden. Als er dort ermüdet abends ankommt, sagt man ihm,<br />
daß B., ärgerlich wegen A.s Ausbleiben, vor einer halben Stunde zu A. in sein Dorf gegangen s,ei und sie sich eigentlich unterwegs hätten<br />
treffen müssen. Man rät A. zu warten. A. aber in Angst wegen des Geschäftes macht sich sofort auf und eilt nach Hause. Diesmal legt er<br />
den Weg, ohne besonders darauf zu achten, geradezu in einem Augenblick zurück. Zu Hause erfährt er, B. sei doch schon gleich früh<br />
gekommen -gleich nach dem Weggang A.s, ja er habe A. im Haustor getroffen, ihn an das Geschäft erinnert, aber A, habe gesagt, er habe<br />
jetzt keine Zeit, er müsse jetzt eiligst fort. Trotz dieses unverständlichen Verhaltens A.s sei aber B. doch hiergeblieben, um auf A. zu<br />
warten. Er habe zwar schon oft gefragt, ob A. Nicht schon wieder zurück sei, befinde sich aber noch oben in A.s Zimmer. Glücklich<br />
darüber, B. jetzt noch zu sprechen und ihm alles erklären zu können, läuft A. die Treppe hinauf. Schon ist er fast oben, da stolpert er,<br />
erleidet eine Sehnenzerrung und fast ohnmächtig vor Schmerz, unfähig sogar zu schreien, nur winselnd im Dunkel hört er, wie B. -<br />
undeutlich ob in großer Ferne oder knapp neben ihm - wütend die Treppe hinunterstampft und endgültig verschwindet.<br />
Kafkas Konstruktionstechnik ist hier fast überdeutlich. Da sind erst einmal alle wesentlichen Faktoren, die gewöhnlich bei mißglückten<br />
Verabredungen ins Spiel kommen: Übereifer - A. geht zu früh fort und ist dennoch so hastig, daß er B. auf der Treppe übersieht;
Ungeduld - A. wird der Weg ungeheuer lang, was zur Folge hat, daß er sich um den Weg mehr kümmert als um sein Ziel, nämlich B. zu<br />
treffen; Angst und Nervosität - was A. zu der unbedachten Überaktivität des Rückwegs verleitet, wo er doch ruhig die Rückkehr des B.<br />
hätte abwarten können; all dies bereitet schließlich jene wohlbekannte Tücke des Objekts vor, die vollkommenes Mißlingen immer<br />
begleitet, und das endgültige Zerfallen des Verärgerten mit der Welt überhaupt anzeigt und besiegelt. Aus diesen allgemeinen Faktoren,<br />
und nicht. eigentlich aus dem Erlebnis eines spezifischen Ereignisses, konstruiert Kafka die Begebenheit. Da keine Wirklichkeit<br />
gleichsam mildernd der Konstruktion im Wege steht, können die einzelnen Elemente die ihnen innewohnende komisch-gigantische<br />
Größe annehmen, so daß auf den ersten Blick die Geschichte sich wie eine jener phantastischen Münchhausen-Geschichten liest, die<br />
Seeleute einander zu erzählen lieben. Der Eindruck der Übertreibung verschwindet erst, wenn wir die Geschichte nicht mehr als Report<br />
einer wirklichen Begebenheit lesen, nicht als den Bericht über irgendein Ereignis, das durch Verwirrung zustande kam, sondern als das<br />
Modell der Verwirrung selbst, dessen grandiose Logik unsere eigenen begrenzten Erfahrungen mit verwirrten Ereignissen gleichsam<br />
verzweifelt nachzuahmen versuchen. Diese überaus kühne Umkehrung von Vorbild und Nachahmung, in der, einer jahrtausendealten<br />
Tradition zum Trotz, das Gedichtete plötzlich als Vorbild und die Realität als die zur Rechenschaft gezogene Nachahmung erscheint, ist<br />
eine der wesentlichen Quellen des Kafkaschen Humors und macht auch diese Geschichte so unbeschreiblich erheiternd, daß sie einen<br />
fast über alle bereits verfehlten und noch zu verfehlenden Verabredungen im Leben hinwegzutrosten vermag. Denn Kafkas Lachen ist<br />
ein unmittelbarer Ausdruck jener menschlichen Freiheit und Unbekümmertheit, die versteht, daß der Mensch mehr ist als sein Scheitern,<br />
schon weil er sich eine Verwirrung ausdenken kann, die verwirrter ist als alle wirkliche Konfusion. Aus dem Gesagten dürfte klar sein,<br />
daß der Erzähler Kafka kein Romancier im Sinne des klassischen Romans des 19. Jahrhunderts ist. Die Grundlage des klassischen<br />
Romans war ein Lebensgefühl, das die Welt und die Gesellschaft grundsätzlich akzeptierte, das sich dem Leben, so wie es gegeben war,<br />
unterwarf und das die Größe des Schicksals als jenseits von Gut und Böse empfand. Die Entwicklung des klassischen Romans entsprach<br />
dem langsamen Niedergang des Citoyen, der in der Französischen Revolution und in der Kantschen Philosophie zum ersten Mal<br />
versucht hatte, die Welt mit von Menschen erfundenen Gesetzen zu regieren. Seine Blüte war begleitet von der vollen Entfaltung des<br />
bürgerlichen Individuums, das die Welt und das Leben als einen Schauplatz von Ereignissen betrachtete und das mehr Sensationen und<br />
Geschehnisse zu »erleben« wünschte, als der gewöhnlich enge und gesicherte Rahmen seines eigenen Lebens ihm bieten konnte. Alle<br />
diese Romanciers, ob sie realistisch die Welt abmalten oder phantastisch sich andere Welten erträumten, standen in ständiger<br />
Konkurrenz mit der Wirklichkeit. Dieser klassische Roman hat heute in einer besonders in Amerika außerordentlich hochentwickelten<br />
Form des Reportageromans geendet, was nur konsequent ist, wenn man bedenkt, daß mit der Realität heutiger Ereignisse und Schicksale<br />
wohl keine Phantasie mehr in Konkurrenz zu treten vermag.<br />
Das Pendant zu der ruhigen Sekurität der bürgerlichen Welt, in welcher das Individuum dem Leben seinen ihm zukommenden Anteil<br />
abverlangte und dennoch nie ganz genug bekommen konnte an Ereignissen und Sensationen, waren die großen Männer, die Genies und<br />
die Ausnahmen, die in den Augen der gleichen bürgerlichen Individuen die herrliche und geheimnisvolle Inkarnation von etwas<br />
Übermenschlichem repräsentierten, das man »Schicksal« nennen konnte, wie im Falle Napoleons, oder »Geschichte«, wie im Falle<br />
Hegels, oder den Willen Gottes, wie im Falle Kierkegaards, der behauptete, Gott habe an ihm ein Exempel statuieren wollen, oder<br />
»Notwendigkeit«, wie im Falle Nietzsches, der sich »eine Notwendigkeit« nannte. Die höchste Sensation des Erlebnishungrigen war das<br />
Erlebnis des Schicksals selber, und der höchste Typus des Menschen war daher der Mensch, der ein Schicksal, eine Mission, eine
Berufung hatte, der er nur diente, beziehungsweise deren Vollzug er war. Groß war daher nicht mehr eigentlich ein Werk oder eine<br />
Leistung; groß wurde der Mensch selbst, nämlich als Inkarnation von etwas Übermenschlichem. Genie war nicht mehr eine Gabe der<br />
Götter, verliehen an Menschen, die doch deshalb immer noch menschlich blieben; die gesamte Person wurde eine einzige Verkörperung<br />
von Genie und konnte daher nicht länger ein gewöhnlicher Sterblicher sein. Daß diese Vorstellung vom Genie als einer Art<br />
übermenschlichen Monsters durchaus dem 19, Jahrhundert und keiner früheren Epoche eigen war, kann man noch deutlich in Kants<br />
Definition des Genies sehen. Für ihn ist Genie die Gabe, durch die »Natur der Kunst die Regel vorschreibt«; man kann mit dieser<br />
Naturkonzeption heute streiten, und man mag meinen, daß im Genie die Menschheit selbst der »Kunst die Regel vorschreibt«; wesentlich<br />
ist hier nur, daß in dieser Definition des 18. Jahrhunderts noch nichts von der leeren Größe, die unmittelbar nach Kant in der Romantik<br />
bereits ihr Unwesen trieb, zu spüren ist.<br />
Was Kafka persönlich so modern und zu gleicher Zeit so fremdartig unter seinen Zeitgenossen und in seinem Milieu der Prager und<br />
Wiener Literaten erscheinen läßt, ist gerade, daß er so offensichtlich nicht ein Genie oder die Verkörperung irgendeiner objektiven Größe<br />
sein wollte und daß er andererseits so leidenschaftlich sich weigerte, sich irgendwelchem Schicksal einfach zu unterwerfen. Er war in<br />
keiner Weise mehr in die Welt verliebt, so wie sie uns gegeben ist, und selbst von der Natur meinte er, daß ihre Überlegenheit über den<br />
Menschen nur so lange bestehe, »als ich euch in Ruhe lasse«. Ihm ging es um eine mögliche, von Menschen erbaute Welt, in der des<br />
Menschen Handlungen von nichts abhängen als von ihm selbst, seiner eigenen Spontaneität, und in der die menschliche Gesellschaft<br />
durch von Menschen vorgeschriebene Gesetze regiert wird, und nicht durch geheimnisvolle Mächte, gleich ob sie als höhere oder<br />
niedere Mächte interpretiert werden, Und in einer solchen, nicht mehr erträumten, sondern unmittelbar zu konstruierenden Welt wollte<br />
er, Kafka, bei Leibe keine Ausnahme sein, sondern ein Mitbürger, ein »Gemeindemitglied«.<br />
Dies heißt natürlich nicht, daß er, wie manchmal angenommen wird, bescheiden gewesen sei. Immerhin hat er einmal in seine<br />
Tagebücher mit echtem Erstaunen notiert, daß jeder Satz, wie er ihn zufällig niederschreibe, auch schon vollkommen sei - was der<br />
einfachen Wahrheit entspricht. Kafka war nicht bescheiden, sondern demütig.<br />
Um wenigstens im Entwurf Mitbürger einer solchen, von allem blutigen Spuk und mörderischen Zauber befreiten Welt zu werden - wie<br />
er sie versuchsweise in »Amerika«, dem Happy-end von »Amerika« zu beschreiben suchte - mußte er notwendigerweise die Zerstörung<br />
der gegenwärtigen Welt antizipieren. Seine Romane sind eine solche antizipierte Destruktion, durch deren Ruinen er das erhabne Bild<br />
des Menschen als eines Modells des guten Willens trägt, der wahrhaft Berge versetzen kann und Welten erbauen, der die Zerstörung<br />
aller Fehlkonstruktionen und die Trümmer aller Ruinen ertragen kann, weil ihm die Götter, wenn er nur guten Willens ist, ein<br />
unzerstörbares Herz gegeben haben. Und da diese Kafkaschen Helden nicht wirkliche Personen sind, mit denen es hybrid wäre sich zu<br />
identifizieren, da sie nur Modelle sind und belassen in Anonymität, auch wenn sie beim Namen genannt werden, scheint es uns, als sei<br />
jeder von uns angerufen und aufgerufen. Denn dieser, der guten Willens ist, kann irgendeiner sein und jedermann, vielleicht sogar du<br />
und ich.
Die aufgeklärte Welt im Zeichen ihres Unheils: Verdinglichung im Werk Kafkas<br />
von Marcus Hawel<br />
"Stets noch jedoch schleppt die Menschheit wie in den Plastiken Barlachs und in Kafkas Prosa<br />
sich dahin, ein endloser Zug gebeugt aneinander Geketteter, die den Kopf nicht mehr heben<br />
können unter der Last dessen, was ist."<br />
I.<br />
Th. W. Adorno<br />
Kafka schrieb am 25. Dezember 1911 in sein Tagebuch, daß die Literatur Angelegenheit des Volkes sei.[1] Dieser Satz mag den Leser<br />
auffordern, Kafkas Texte für sich zu gewinnen; sie sind nicht l'art pour l'art. Die schlichteste Deutung seiner Kritzeleien aber, daß diese<br />
nicht zu deuten seien, macht es sich zu einfach und verwechselt die Erschwernis eines Zugangs mit dem Bedeutungsgehalt der Texte.[2]<br />
Kunst ist nur dem Schein nach autonom und unmittelbar, ihr Wesen ist ein gesellschaftlich vermitteltes und schöpft nicht allein aus sich<br />
selbst heraus; sie muß ihren Gehalt messen lassen an dem, was über das bloß Subjektive hinausgeht und nicht nur im Kunstwerk als<br />
dessen Entäußerung sondern bereits im Künstler als gesellschaftliches Individuum vermittelt ist. Darum ist Kunst Angelegenheit des<br />
Volkes. Deutung ist möglich, wo individuelle Entäußerung korrespondiert mit der Allgemeinheit und dahin zurückkehrt. Einem Dictum<br />
Walter Benjamins zufolge habe man sich Kunstwerken interpretativ auf zwei Ebenen anzunähern: zunächst über den Begriff des Werkes<br />
und der Autorenschaft; schließlich aber solle man von diesen abstrahieren und das Kunstwerk als geschichtsphilosophische Chiffre<br />
betrachten. So könne man sich dem Zeitalter - als Text verstanden - vermöge der Deutung der Chiffren nähern, wobei die Autorenschaft<br />
und das Biographische so belanglos werden wie der Urheber eines pragmatisch-historischen Zeugnisses, etwa einer Inschrift.[3]<br />
Wie aber sollte man sich dem Werk Kafkas im allgemeinen nähern? "Man sollte sich der Einsicht nicht verschließen", heißt es, "daß wir es<br />
bei Kafkas Texten mit einem Typ Kunstwerk zu tun haben, 'das sich in seiner Funktion als Sinn und Bedeutungsganzes nur im Akt<br />
individueller oder subjektiver Sinn- und Bedeutungszuerkennung' erfüllt."[4] Aus diesem Grund scheint es geboten, dem Drang der<br />
stilistischen Einordnung nicht allzusehr nachzugeben. Jene "rückhaltlose, monadologische Versenkung ins je eigene Formgesetz", wie<br />
Adorno es bezeichnete,[5] das ästhetisch vermittelt zwar Ausdruck gesellschaftlichen Substrates ist und damit verhandelbar als deutbare<br />
Kunst, sperrt sich gegen das systematische Objektivieren, gegen das Einordnen etwa in den Expressionismus, Surrealismus oder<br />
Existentialismus, ohne das zugleich Deutung kaum möglich ist. Anstatt Kafka in etablierte Denkrichtungen einzuordnen, müßte man bei<br />
dem verweilen, "was die Einordnung erschwert und eben darum die Deutung erheischt."[6] Kafkas Werk läßt sich nicht ohne weiteres
einordnen, ohne daß es auf ein Partikulares reduziert würde, in dem es als Ganzes nicht mehr aufginge. Kafka ist weder einzig der letzte<br />
Prophet Israels, zu welchem jüdische Theologen ihn machen wollten, noch "Bruder" Kierkegaards oder ein Verfechter negativer<br />
Theologie. Er ist kein Mystiker, Existentialist oder Revolutionär.[7] Unbestritten gingen aufgrund der Tatsache, daß Kafka Jude war,<br />
jüdische Themen in sein Werk ein. Auch hatte er die Schriften Kierkegaards gelesen und in jener Existentialphilosophie den begrifflichen<br />
Ausdruck seiner eigenen Entfremdung und Angst, seines Leidens gefunden. Ebenso aber wurde er inspiriert durch Pascal, Dostojewski<br />
und andere Personen - müßig, die alle im einzelnen auseinanderzuhalten.<br />
Kafkas innere Welt, die in nahtloser Korrespondenz mit der äußeren sein Sujet darstellt, ist die<br />
eines Schlachtfeldes, auf dem er unausgesetzt den Kampf gegen Entfremdung und Verdinglichung<br />
führt und die zahlreichen Widersprüche seiner Existenz verarbeitet, ohne daß er sich jemals von<br />
Entfremdung und Verdinglichung erfolgreich befreit hätte. "Kafka erlebte diese Welt als Konflikt.<br />
Als Jude unter Deutschen, als Deutschsprechender unter Tschechen, als Dichter, der auf seinen<br />
Vater-Geschäftsmann stieß, als Beamter unter Bürokraten, gegen die er nur Widerwillen empfand,<br />
und schließlich als Mensch, der Leben und Gesundheit leidenschaftlich liebte und von seiner<br />
Krankheit zermürbt wurde. Kafka erlebte die Welt als verlängerte Erfahrung der Spaltung und als<br />
Tragödie."[8]<br />
Kafkas literarische Texte besitzen häufig die Logik eines Traumes. Es erklärt allerdings nichts,<br />
Kafkas Kunst als Projektionen des Unbewußten zu bezeichnen, sondern denunziert vielmehr Kafka<br />
als Neurotiker. Psychoanalyse erlangt als Hilfsmittel der Deutung nur dort Bedeutung, wo sie den realen Grund findet für das Fliehen<br />
der Menschen aus der Realität, der wiederum mehr über die Irrationalität des Bestehenden aussagen dürfte als über das rationale<br />
Bedürfnis, aus einer solchen zu fliehen.[9] Wenn Realität so irrational geworden ist, daß irreale Kunst ihr zum adäquaten Ausdruck wird,<br />
so ist diese Kunst rational geworden: als "radikal verdunkelte."[10] Das verbietet, Kafka als Neurotiker zu pathologisieren; dagegen wäre<br />
auch einzuwenden, daß Kafkas sprachlicher Ausdruck klar und prägnant ist, frei von jeglichen unkontrollierbaren Affekten in der<br />
Sprache, die vielmehr logisch und präzise ist. Kafka benutzt Sprache intensiv.[11] - "Jeder Satz spricht: deute mich, und keiner will es<br />
dulden."[12] - Man muß Kafkas Sätze wortwörtlich nehmen.[13]<br />
Kafkas Texte sind keine Gleichnisse; sie handeln von den Dingen, mit denen der Mensch sich jeden Tag abmüht, und wollen sagen, daß<br />
das Faßbare faßbar ist.[14] Kafka erfaßt die Welt und arbeitet mit den Gegenständen, mit Personen und Geschehnissen mitten in der<br />
Wirklichkeit, nicht mit deren Gleichungen. Statt die Wirklichkeit metaphorisch zu entstellen, zerstört diese Anti-Ästhetik<br />
(Deleuze/Guattari) alles Metaphorische,[15] um Wirklichkeit freizulegen - selbst dort, wo Kafkas Bericht sich verdichtet: als "Negativ der
Wahrheit" ist der Bericht aber nicht wirklich verdunkelt, sondern vielmehr die Welt, deren vermeintlich verdunkelter Niederschlag in der<br />
Kunst erhellend ist. Kafka selbst bat darum, seine Stücke nicht als Gleichnisse zu bezeichnen.[16] - Sicher steht der letzte Satz im Bericht<br />
für eine Akademie stellvertretend für sein gesamtes Werk: "ich will nur Kenntnisse verbreiten, ich berichte nur."[17] Kafka berichtet von<br />
seinen alltäglichen Erfahrungen, dem "Kehricht der Realität"[18], ohne ihrer Bedeutung allzusehr nachzugehen. Es sind naiv anmutende<br />
Schilderungen, die wegen ihrer Einfachheit eine magische Ausstrahlung besitzen und unmittelbares Staunen hervorrufen;[19] sie<br />
gleichen Clownerien, die wie eine Falle aufgebaut sind:[20] zugleich tragisch und komisch.<br />
Kafka beschreibt die unabänderliche Reproduktion eines auf Herrschaft beruhenden stark durchhierarchisierten Immergleichen: eine<br />
ewige Ordnung des Bestehenden, aus dessen Bann nicht auszubrechen ist. Das ist die Invariante des Mythos der Gegenwart, die sich<br />
selbst als aufgeklärte, moderne Welt bezeichnet. Die Handlungen in Kafkas Texten weisen den Charakter von Verhängnis auf, "die Welt<br />
wird als so absurd enthüllt, wie sie dem intellectus archetypus wäre."[21]<br />
Der Dialektik der Aufklärung zufolge erkauften sich die Menschen im mythischen Opfer ihre Sicherheit gegen die Angst. Damit<br />
anerkannten sie Herrschaft als das Prinzip aller Beziehungen.[22] Der Mythos versprach die Erlösung von unmittelbarer<br />
Naturbedrohung, setzte aber eine qualitativ neue Bedrohung in die Welt: die Herrschaft der Götter und ihrer Stellvertreter, den Königen,<br />
Priestern, Vätern und Beamten. Der Mythos, der die Welt eindeutig und vor allen Dingen hierarchisch strukturiert, beißt sich allerdings<br />
absichtlich mit jener von Kafka angelegten Willkür, beinahe anarchistischen Unterwanderung von Hierarchie und Ordnung, wo kein<br />
Oben und kein Unten als beständiges Prinzip für Sicherheit sorgen.<br />
II.<br />
In einem Brief an Max Brod aus dem Jahre 1922 schrieb Kafka: "Ich könnte leben und lebe nicht."[23] Es ist, als könne er nirgends<br />
existieren, ohne Angst vor der Wirklichkeit zu empfinden - als sei es ein Kampf, in dem ängstlich, sehnsüchtig und dabei gelähmt er auf<br />
das Leben stiere und darüber es vergesse.[24] Kafkas Angst vor der Außenwelt, die in seine eigene Wirklichkeit einbrechen könnte,[25]<br />
ist Ausdruck eines kulturellen Unbehagens, das im Gegensatz zur psychotischen Angst der gesellschaftlichen Kritik fähig bleibt. Kafka<br />
spürt die Entfremdung seiner Zeit am eigenen Körper: "er selbst kann nirgends existieren, oder wenn er existiert, dann nur in einem<br />
absurden Zwischenreich, in dem er das Wirkliche lebt und zugleich verneint, und das Unwirkliche aber Wahre bejaht, aber nicht<br />
lebt."[26] Seine Texte sind deswegen aber weder pessimistisch noch weinerlich; er selbst ist nicht der Inbegriff einer bloß leidenden oder<br />
gar selbstbemitleidenden Person. Deleuze und Guattari betonen, daß Kafka ein lachender Autor war, "erfüllt von einer tiefen<br />
Fröhlichkeit, trotz oder gerade wegen seiner Clownerien, die er wie eine Falle aufbaut oder wie einen Zirkus vorführt."[27]<br />
Wie Sisyphos den Stein, wälzt Kafka den Felsblock geschichtlichen Geschehens (Benjamin). Die untere Seite, die dabei ans Licht kommt,
ist eine Welt des Grauens.[28] "Sie ist nicht angenehm zu sehen. Doch Kafka ist imstande, ihren Anblick zu ertragen."[29] - Er sieht wie<br />
Benjamins Engel der Geschichte in der Kette geschichtlichen Geschehens ein Verhängnis;[30] Fortschritt hat es nicht wirklich gegeben.[31]<br />
Kafkas Thema ist das der Vereinzelung und Verdinglichung des Individuums in der Spätphase der kapitalistischen Gesellschaft. Er<br />
benennt die Wunden, die eine abstrakt gewordene Gesellschaft den Menschen schlägt.[32] Die Gestalten Kafkas - Sumpfgestalten<br />
zwischen Mensch, Ding und Tier - sind die "Chiffren der gesellschaftlichen Unwahrheit"[33] Die Gestalten sind das Resultat einer<br />
gesellschaftlichen Zurichtung; sie sind unwahr, weil die Verhältnisse unwahr sind; sie träumen nicht mehr, weil die Verhältnisse einem<br />
Alptraum gleichen.[34] Sicher wären sie gerne befreit aus dem Sumpf und unversehrt - das wäre Schönheit. Aber der Alptraum der<br />
Wirklichkeit – die Versachlichung des Geistes – ist so mächtig, daß selbst das Wünschen und Begehren vor diesem weichen müssen; an<br />
ihrer statt verhalten die Menschen sich so automatisch wie Maschinen, als wären sie programmiert. "Nicht bloß mit der Entfremdung der<br />
Menschen von den beherrschten Objekten wird für die Herrschaft bezahlt: mit der Versachlichung des Geistes wurden die Beziehungen<br />
der Menschen selber verhext, auch die jedes Einzelnen zu sich. Er schrumpft zum Knotenpunkt konventioneller Reaktionen und<br />
Funktionsweisen zusammen, die sachlich von ihm erwartet werden."[35] In Kafkas Prosastück Schweigen der Sirenen[36] wird in diesem<br />
Sinne Odysseus als Prototyp des verdinglichten Individuums vorgestellt, der weniger als ein epischer Held ist: ein naiver Wicht, der zu<br />
absurden und unsinnigen Handlungen neigt; der dem Gesang der Sirenen zuhören möchte, aber sich die Ohren mit Wachs zustopft; der<br />
von den Wendungen ihrer Hälse annimmt, sie seien bereits Gesang;[37] der sich in seiner Freude ergeht, aus eigenen Kräften vor den<br />
mythischen Mächten sich bewahrt zu haben, aber nicht erkennt, zu welchem Preis er seine Rettung bezahlte: daß er sich ganz auf sich<br />
einschränkte, unrettbar an seine Mittelchen sich verlor und selbst die Schicksalsgöttin in die Schranken wies. Odysseus wäre gar nicht<br />
verführbar gewesen bei so viel Leidenschaft für die Mittel - Fetischisierung der Technik - und Rancune gegen die wirkliche Leidenschaft,<br />
die im Genuß des Sirenengesangs entfacht worden wäre. Die Abschaffung des Zufalls durch Technik verschafft dem Menschen<br />
Sicherheit und Kontrolle über sein eigenes Leben. Im Gegenzug verödet das Leben. Ordnung birgt Langeweile. Wer den Geschicken des<br />
Zufalls (oder magisch-mythisch: der Schicksalsgöttin) sich überläßt, lebt intensiv aber gefährlich, weil die Extreme zersetzende Kräfte<br />
sind.[38]<br />
Horkheimer/Adorno bezeichnen das Fühlhorn der Schnecke als das Wahrzeichen der Intelligenz,[39] weil es auf Gefahren sensibel reagiert<br />
und die Schnecke vorsichtig macht. Dennoch wird das Tier "in der Richtung, aus der es endgültig verscheucht ist, scheu und dumm."[40]<br />
Dummheit ist ein Wundmal gesellschaftlicher Verstümmelung. Die Schnecke tauscht Sicherheit auf Kosten der Lebendigkeit ein; sie<br />
verkriecht sich in ihr Haus, eingedenk monadenhaft in sich selbst und macht die Schotten dicht: mit gewaltsam verschlossenen Sinnen -<br />
fensterlos.[41] Daraus resultiert Erfahrungsarmut in der Schnecke, und übertragbar: im Subjekt. Die Abschaffung des Zufalls durch<br />
Technik kommt der Stillegung des Lebens gleich.<br />
Der Verlauf der europäischen Zivilisation: vermeintlicher Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit, Zunahme der Selbstbestimmung des
Subjektes, erweist sich als unabdingbar gebunden an die Vermehrung der Entfremdung des Selbst von Natur, die Vermehrung der<br />
Unfreiheit. "Jeder Versuch, den Naturzwang zu brechen, indem Natur gebrochen wird, gerät nur um so tiefer in den Naturzwang hinein.<br />
So ist die Bahn der europäischen Zivilisation verlaufen."[42]<br />
Es scheint, als identifiziere Kafka ein bißchen sich mit diesem entfremdeten Odysseus, der genießen möchte, aber nicht genießt. Um<br />
objektive Entfremdung erkennbar zu machen, bedient Kafka sich des Mittels der Verfremdung. Es ist nicht Mitleid gegenüber Odysseus,<br />
das den Text bestimmt, sondern Anklage des gesellschaftlich prototypischen Unvermögens, mit allen Sinnen wahrhaftig Mensch zu sein.<br />
"Sein Werk fingiert einen Ort, von dem her die Schöpfung so durchgefurcht und beschädigt erscheint, wie nach ihren eigenen Begriffen<br />
die Hölle sein müßte."[43] Kafka stellt verhängnisvolle Geschichte als hermetisches Geschehen vor, das zuletzt die scheinhaft autonome<br />
aber tatsächlich "vollendet entfremdete Subjektivität"[44] hervorbrachte: kein Fortschreiten der Freiheit in der Wirklichkeit; keine<br />
Menschwerdung, aber dafür Dingwerdung des Menschen.[45] Kafka verwischt die Grenze zwischen Menschlichem und Dinghaftem.<br />
Seine literarischen Gestalten sind allgemein keine Helden;[46] sie tragen Lasten auf ihren Schultern, ihre Erscheinungen sind düsterer<br />
Art: kreatürlich; ihr Gang ist verhängnisvoll, vom Schicksal besiegelt; sie sind sprunghaft, inkonsistent, variant, inkonsequent -<br />
menschlich zwischen Tier und Mensch, menschlich auch zwischen Ding und Tier, zwischen Ding und Mensch. "Keine hat ihre feste<br />
Stelle, ihren festen, nicht eintauschbaren Umriß: keine die nicht im Steigen oder Fallen begriffen ist; keine die nicht mit ihrem Feinde<br />
oder Nachbarn tauscht; keine welche nicht ihre Zeit vollbracht und dennoch unreif, keine welche nicht tief erschöpft und dennoch erst<br />
am Anfang einer langen Dauer wäre."[47]<br />
Der Wunsch nach einem Ausweg drängt sich sehnsüchtig auf. Solcher Realität möchte man aus wahrhaftigen Gründen fliehen. So wie<br />
der Affe im Bericht für eine Akademie keinen Ausweg hatte und sich diesen erst verschaffen mußte, weil er ohne nicht leben konnte,[48] so<br />
dringend brauchte auch Kafka den Ausweg.[49] Und der Affe spricht absichtlich von Ausweg und nicht von Freiheit; "damit betrügt man<br />
sich unter Menschen allzuoft." Was als Menschenfreiheit gilt, ist die "Verspottung der heiligen Natur".[50] Die Menschwerdung des<br />
Menschen beruht bei Kafka auf dem Eingedenken der Natur im Subjekt[51] - im Bericht: auf der Erinnerung der Affennatur im Menschen.<br />
Der Mensch, der sich selbst mit der Peitsche beaufsichtigt,[52] verhöhnt seine eigene Natur, indem er solches als Freiheit bezeichnet.<br />
Solche Menschenfreiheit scheidet für den Affen ganz aus. Im Bericht für eine Akademie stellt Kafka Kunst als Ausweg dar: Als der Affe die<br />
zwei Möglichkeiten für sich erkannte - zoologischer Garten oder Varieté - zögerte er keine Sekunde. "Ich sagte mir: setze alle Kraft an,<br />
um ins Varieté zu kommen; das ist der Ausweg; zoologischer Garten ist nur ein neuer Gitterkäfig; kommst du in ihn, bist du<br />
verloren."[53]<br />
Die Ähnlichkeit der literarischen Gestalten Kafkas mit Tieren, die mit menschlichen Verhaltensweisen ausgestattet sind, verweist<br />
genauso auf das Motiv des heilsamen Eingedenkens in die Tierähnlichkeit: rettendes Erwachen als Tier,[54] wie es auch die fluchtartige
Regression des Menschen, seine Verlorenheit im Tierhaften zum Ausdruck bringt. Der Künstler ist allerdings vermöge seiner Distanz<br />
zum Betrieb, die Kunst überhaupt erst möglich macht, dem heilsamen Eingedenken noch am nächsten.<br />
Auch die Sirenen sind solche tierähnlichen Gestalten: sie gelten als Mädchen mit Vogelleibern. Ihr Gesang verheißt tellurisches Allwissen<br />
- wohltuende Wahrheit -, die heißes Verlangen entfacht. Der Gesang der Sirenen mag die Vermittlung sein zwischen Natur und Kunst: er<br />
ist nicht mehr bloße Natur, weil das Chaotische der Natur in ihm als Mythos gebannt ist. Zum einen sind die Sirenen als allegorische<br />
Personifikation des Naturschönen von allgemeiner Natur differenziert und zum anderen bereits als Bezeichnendes nicht mehr<br />
unmittelbar identisch mit Natur; sie sind von bloßer Natur bereits abstrahiert und damit entfremdet (Distanz). Und ihr Gesang kann<br />
noch nicht Kunst sein, weil es den Sirenen an Bewußtsein mangelt; ihre archaische Übermacht kollidiert mit Kultur. - Kunst will befreien,<br />
nicht wüten.<br />
Der befreite Mensch hat nicht Kultur in sich negiert und ist zum Tier zurückgekehrt, auch wenn der Eindruck bei Kafka zunächst<br />
entstehen mag, sondern dieser Mensch hat Denken und Begehren in Einklang miteinander gebracht, wie es im Bildungsbegriff bei<br />
Schiller einmal vorgesehen war. - Odysseus müßte lernen, den Wachs aus den Ohren zu nehmen und die Fesseln zu lösen, während den<br />
Sirenen zum Bewußtsein zu verhelfen wäre. - Ihre archaische Übermacht ist durch Technik besiegt; damit die Menschen nicht<br />
untergehen, benötigen die Sirenen Bewußtsein.<br />
Odysseus' Schicksal ist unterdessen, um in der allegorischen Sprache des Berichts zu bleiben, im zoologischen Garten besiegelt worden:<br />
gut dressiert wußte er seine "Mittelchen" einzusetzen; er dürfte jenen "Irrsinn des verwirrten Tieres im Blick"[55] gehabt haben, weshalb<br />
die Sirenen in Kafkas Schilderung vielleicht voller Neugierde den Glanz seiner Augenpaare erhaschen wollten.<br />
Vom Standpunkt der aufgeklärten Welt möchte man sehr gerne annehmen, daß der Gesang der<br />
Sirenen heute mehr zu tun habe mit Kunst als mit mythisch gebannter Naturbedrohung. Die<br />
Versprechen der Sirenen sind zur Kunst neutralisiert: für bloß genießerische Kontemplation. Der<br />
Besucher eines Konzertes beaufsichtigt sich selbst mit der Peitsche und bedarf der Fesseln nicht<br />
mehr; "sein begeisterter Ruf nach Befreiung verhallt schon als Applaus."[56] Kafkas Allegorie der<br />
schweigenden Sirenen verstärkt diese Annahme noch dadurch, daß er sehr wohl die Sirenen mit<br />
Bewußtsein ausstattet, woran sie aber - gemäß der immanenten Logik des Textes - zugrunde<br />
gegangen sein müßten.<br />
Die Frage, warum die Sirenen bei Kafka schweigen, drängt sich der Betrachtung auf. Ihre Antwort<br />
ist von zentraler Bedeutung, die vermutlich über Das Schweigen der Sirenen hinausgeht und auch für
das gesamte Werk Kafkas wichtig ist. Wenn Kunst bisher einen Ausweg anzubieten hatte, verweist das Schweigen der Sirenen hingegen<br />
auf die nunmehr gewordene Ausweglosigkeit der Kunst, die deshalb schweigt, weil der mögliche Ausweg vernunmöglicht wurde.[57]<br />
Benjamins Vermutung muß zugestimmt werden, daß Kafkas Vorliebe für Musik und Gesang als "Ausdruck oder wenigstens ein Pfand<br />
des Entrinnens"[58] der Schlüssel ist für das rätselhafte Schweigen der Sirenen: Kunst als "Pfand der Hoffnung, das wir aus jener kleinen,<br />
zugleich unfertigen und alltäglichen, zugleich tröstlichen und albernen Mittelwelt haben, in welcher die Gehilfen zu Hause sind."[59] Wo<br />
Hoffnung schwindet, weil es keinen Ausweg gibt, wird der unausgesetzte Einsatz einmal adäquater Mittel selbst absurd, kindisch und<br />
degradiert das Mittel zum Mittelchen. Es scheint, als wollte Kafka die Sirenen vor einem albernen Odysseus retten. Aber nicht, weil die<br />
Kunst eitel sei. - Die Sängerin Josefine mag aus diesem Grund nicht mehr singen. Im Schweigen der Sirenen geht es hingegen um viel mehr:<br />
die Kunst läuft Gefahr, sich als Verschleierung und Affirmation barbarischer Verhältnisse zu erniedrigen - selbst wo sie ausdrücklich<br />
kritisiert. Indem sie als die Allegorie des Naturschönen in der aufgeklärten aber zugleich unvernünftigen Welt neben Gewalt und<br />
Herrschaft sich einrichtet und solche Schönheit möglich macht,[60] verschönert sie Herrschaft und Gewalt - "erscheinende Natur will<br />
schweigen"[61] aus diesem Grund.<br />
In jener albernen Mittelwelt trifft man stumme untergeordnete Personen an, die zu ersticken drohen an der Enge der versteinerten<br />
Verhältnisse. Ihre stumme, unmusikalisch klappernde Sprache ist das Resultat eines gegenüber dem stummen Zwang des stahlharten<br />
Gehäuses der Hörigkeit (Weber) im Spätkapitalismus mimikryschen Verhaltens.[62] Davon bleiben auch die Künstler nicht verschont. Die<br />
Sprache der Beherrschten ist weder bezeichnend noch musikalisch; sie ist jener "aus Schweigen geborene Tonfall",[63] den Kafka<br />
aufspürt, weil er Ausdruck eines gemeinsamen Leidens ist, das die Verhältnisse nicht mehr zum Tanz auffordern kann, indem man<br />
diesen ihre eigene Melodie vorspielt, weil jenes hermetische Prinzip totaler Vergesellschaftung eben keine Melodie mehr hat; es<br />
vollstreckt Vergesellschaftung ohne Ton. Zuletzt hat Kunst in der verwalteten Welt nichts besonderes mehr auszudrücken und hört auf,<br />
Kunst zu sein; sie wird entkunstet nach der Seite der Belanglosigkeit des Immergleichen.[64]<br />
Das revolutionäre Moment an Kafka besteht darin, daß er "die Axt (...) für das gefrorene Meer in uns"[65] (Verdinglichung) anbietet:<br />
Indem er das Tempo der Verdinglichung und Entfremdung in seiner literarischen Welt beschleunigt, gleichsam als müsse man die<br />
Entfremdung aufheben darüber, daß man total entfremde, rückt er sein Werk in die Nähe eines marxschen Theorems, daß man den<br />
Druck der Verhältnisse zum Zwecke ihrer Aufhebung stärker machen müsse, indem man das Bewußtsein darüber noch hinzufüge.[66]
Anmerkungen<br />
[1] Franz Kafka: GW, Tagebücher 1910-1923, hrsg. v. Max Brod, Frankfurt a.M. 1983, S. 152.<br />
[2] Vgl. Theodor W. Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka, in: Prismen, Kulturkritik und<br />
Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1976, S. 251.<br />
[3] Vgl. Walter Benjamin: Briefe, Frankfurt a.M. 1966, S. 220.<br />
[4] Hans-Gerd Koch:Ein Bericht für eine Akademie, in: Michael Müller (Hg.), a.a.O., S. 193<br />
f. - Dieser Aufsatz nimmt genau dies für sich in Anspruch; seine Deutung ist zum Teil<br />
sicher wagemutig und stellt verschiedene Texte Kafkas zum Teil unmittelbar in<br />
Zusammenhang. Die einzige Rechtfertigung für ein solches Vorgehen besteht darin, daß<br />
der Autor nicht ungewillt ist, sich Kafkas Texten gegenüber so zu verhalten, wie Kafka zu<br />
den Träumen. - Vgl. Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka, a.a.O., S. 254.<br />
[5] Theodor W. Adorno: Erpreßte Versöhnung, in: Noten zur Literatur, Frankfurt a.M. 1981,<br />
S. 268.<br />
[6] Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka, a.a.O., S. 250.<br />
[7] Vgl. Roger Garaudy: Kafka, die moderne Kunst und wir, in: Fritz J. Raddatz (Hg.):<br />
Marxismus und Literatur, Eine Dokumentation in drei Bänden, Bd. III, Hamburg 1969, S.<br />
214 f.<br />
[8] Garaudy, a.a.O., S. 213.<br />
[9] "Hat Kunst psychoanalytische Wurzeln, dann die der Phantasie in der von Allmacht. In<br />
ihr ist aber auch der Wunsch am Werk, eine bessere Welt herzustellen. Das entbindet die<br />
Symbolismen ergebe sich keinerlei Sinn mehr. Solche Aussage vereinnahmt<br />
unzulässigerweise Kafka für die Postmoderne.- Vgl. Deleuze/Guattari, a.a.O., S. 32.<br />
[16] "Gleichnisse bitte ich die Stücke nicht zu nennen, es sind nicht eigentlich Gleichnisse." -<br />
Zit.n. Koch, a.a.O., S. 175. - Kafka meint in diesem Zusammenhang eigentlich zwei<br />
bestimmte Stücke (Schakale und Araber und Ein Bericht für eine Akademie), die er für eine<br />
Veröffentlichung bereitgestellt hatte. Man kann aber diese Aussage für alle seine Stücke<br />
geltend machen.<br />
[17] Franz Kafka: Ein Bericht für eine Akademie, in: GW, Erzählungen, hrsg.v. Max Brod,<br />
Frankfurt a.M. 1983, S. 147.<br />
[18] Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka, a.a.O., S. 258.<br />
[19] Vgl. Wagenbach, a.a.O., S. 41.<br />
[20] Vgl. Deleuze/Guattari, a.a.O., S. 58.<br />
[21] Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka, a.a.O., S. 280.<br />
[22] Vgl. Horkheimer/Adorno: Dialektik der Aufklärung, Philosophische Fragmente,<br />
Frankfurt a.M. 1969, S. 15.<br />
[23] Franz Kafka: GW, Briefe 1902-1924, hrsg. v. Max Brod, Frankfurt a.M. 1983, S. 385.<br />
[24] Vgl. Kierkegaard zit.n. Wagenbach, a.a.O., S. 77 f.<br />
[25] Vgl. Wagenbach, a.a.O., S. 76.<br />
[26] Wilhelm Emrich: Nachwort, in: Franz Kafka: Brief an den Vater, Frankfurt a.M. 1975, S.<br />
79.<br />
gesamte Dialektik, während die Ansicht vom Kunstwerk als einer bloß subjektiven Sprache [27] Deleuze/Guattari, a.a.O., S. 58. - "Der andere Aspekt ist die Komik und Freude bei<br />
des Unbewußten sie gar nicht erst erreicht." - Adorno: Ästhetische Theorie, Frankfurt a.M. Kafka. Doch beide sind ein und dasselbe: Politik der Aussage und Freude des Verlangens.<br />
1973, S. 21f.<br />
Und dies noch beim kranken, selbst noch beim sterbenden Kafka, trotz allem Zirkus, den er<br />
[10] Adorno: Ästhetische Theorie, a.a.O., S. 35.<br />
mit dem Gefühl und Begriff der 'Schuld' abzieht. Nicht zufällig insistieren die<br />
[11] Gilles Deleuze/ Félix Guattari: Kafka, Für eine kleine Literatur, Frankfurt a.M. 1976, S. Interpretationen mit neurotischer Tendenz immer auf einem zugleich tragischen und<br />
38 f. und S. 32.<br />
angsterfüllten und auf einem unpolitischen Aspekt. Die Fröhlichkeit Kafkas oder dessen,<br />
[12] Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka, a.a.O., S. 251.<br />
was er geschrieben hat, ist nicht weniger wichtig als seine politische Realität und<br />
[13] Vgl. Klaus Wagenbach: Franz Kafka in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Tragweite." - Ebd., Anm. 16.<br />
Hamburg 1964, S. 56 f.<br />
[28] "Unter der bekannten Geschichte Europas läuft eine unteridische. Sie besteht im<br />
[14] "Wenn der Weise sagt: 'Gehe hinüber', so meint er nicht, daß man auf die andere Seite Schicksal der durch Zivilisation verdrängten und entstellten menschlichen Instinkte und<br />
hinübergehen solle, was man immerhin noch leisten könnte, wenn das Ergebnis des Weges Leidenschaften." - Horkheimer/Adorno: Interesse am Körper, in: Dialektik der Aufklärung,<br />
wert wäre, sondern er meint irgendein sagenhaftes Drüben, etwas, das wir nicht kennen, a.a.O., S. 246.<br />
das auch von ihm nicht näher zu bezeichnen ist und das uns also hier gar nichts helfen [29] Benjamin: Franz Kafka, a.a.O., S. 428.<br />
kann. Alle diese Gleichnisse wollen eigentlich nur sagen, daß das Unfaßbare unfaßbar ist, [30] Vgl. Walter Benjamin: Sprache und Geschichte, Philosophische Essays, ausgewählt von<br />
und das haben wir gewußt. Aber das, womit wir uns jeden Tag abmühen, sind andere Rolf Tiedemann, Stuttgart 1992, S. 146.<br />
Dinge." - Franz Kafka: Von den Gleichnissen, GS, Beschreibung eines Kampfes, Novellen, [31] "An Fortschritt glauben heißt nicht glauben, daß ein Fortschritt schon geschehen ist.<br />
Skizzen, Aphorismen aus dem Nachlaß, hrsg. v. Max Brod, Frankfurt 1983, S. 72.<br />
Das wäre kein Glauben." - Franz Kafka zit. n. Benjamin: Franz Kafka, a.a.O., S. 428.<br />
[15] Vgl. Deleuze/Guattari, a.a.O., S. 96. - Allerdings gehen Deleuze und Guattari zu weit, [32] "Zur Hölle wird bei Kafka die Geschichte, weil das Rettende versäumt ward. Diese<br />
wenn sie wohlwollend unterstellen, nach der bewußten Zerstörung der Metaphern und Hölle hat das späte Bürgertum selber eröffnet. In den Konzentrationslagern des
Faschismus wurde die Demarkationslinie zwischen Leben und Tod getilgt. Sie schufen<br />
einen Zwischenzustand, lebende Skelette und Verwesende, Opfer, denen der Selbstmord<br />
mißrät, das Gelächter Satans über die Hoffnung auf Abschaffung des Todes." - Adorno:<br />
Aufzeichnungen zu Kafka, a.a.O., S. 269.<br />
[33] Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka, a.a.O., S. 258.<br />
[34] Vgl. Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka, a.a.O., S. 270.<br />
[35] Horkheimer/Adorno, a.a.O., S. 34.<br />
[36] Franz Kafka: Das Schweigen der Sirenen (Eintrag aus dem dritten Oktavheft), in: GW,<br />
Hochzeitvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlaß, hrsg.v. Max<br />
Brod, Frankfurt a.M. 1983, S. 58 f.<br />
[37] Odysseus scheint nicht mehr zu wissen, was Gesang eigentlich ist. Ein ähnliches<br />
literarisches Bild findet sich bei Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse. - "Ist es denn<br />
überhaupt Gesang? Trotz unserer Unmusikalität haben wir Gesangsüberlieferungen; in<br />
den alten Zeiten unseres Volkes gab es Gesang; Sagen erzählen davon, und sogar Lieder<br />
sind erhalten, die freilich niemand mehr singen kann." - Franz Kafka: Josefine, die Sängerin fortgeschrittensten Künste innervieren das am Rande des Verstummens." - Adorno:<br />
oder Das Volk der Mäuse, in: GW, Erzählungen, a.a.O., S. 201.<br />
Ästhetische Theorie, a.a.O., S. 65 f.<br />
[38] Vgl. Horkheimer/Adorno, a.a.O., S. 37 f.<br />
[58] Benjamin: Franz Kafka, a.a.O., S. 416.<br />
[39] Vgl. Horkheimer/Adorno: Zur Genese der Dummheit, in: Dialektik der Aufklärung, [59] Ebd.<br />
a.a.O., S. 274.<br />
[60] Vgl. Adorno: Ästhetische Theorie, a.a.O., S. 108.<br />
[40] Ebd.<br />
[61] Ebd.<br />
[41] Solche Dummheit hat seine Nähe zum Idioten (altgriech. idiotes: Privatmensch). [62] "Der Bann der Verdinglichung soll gebrochen werden, indem das Subjekt sich selbst<br />
[42] Horkheimer/Adorno: Begriff der Aufklärung, a.a.O., S. 19.<br />
verdinglicht. Was ihm widerfährt, soll es vollziehen." - Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka,<br />
[43] Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka, a.a.O., S. 280.<br />
a.a.O., S. 281.<br />
[44] Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka, a.a.O., S. 270.<br />
[63] Deleuze/Guattari, a.a.O., S. 90.<br />
[45] "[Kafka] berichtet, wie es eigentlich zugeht, doch ohne Illusion übers Subjekt, das im [64] "Etwas erzählen heißt ja: etwas Besonderes zu sagen haben, und gerade das wird von<br />
äußersten Bewußtsein seiner selbst - seiner Nichtigkeit - sich auf den Schrotthaufen wirft, der verwalteten Welt, von Standardisierung und Immergleichheit verhindert. Vor jeder<br />
nicht anders als die Tötemaschine mit dem ihr Überantworteten verfährt. Er hat die totale inhaltlich ideologischen Aussage ist ideologisch schon der Anspruch des Erzählers, als<br />
Robinsonade geschrieben, in einer Phase, in der jeder Mensch sein eigener Robinson wurde<br />
und auf einem mit zusammengerafftem Zeug beladenen Floß ohne Steuer herumtreibt." -<br />
Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka, a.a.O., S. 276.<br />
[46] "Die Figuren Kafkas sind von einer Fliegenklatsche getroffen, ehe sie nur sich regen;<br />
wer sie als Helden auf die tragische Bühne schleppt, verhöhnt sie bloß." - Adorno:<br />
Aufzeichnungen zu Kafka, a.a.O., S. 272, Fußnote 1.<br />
[47] Benjamin: Franz Kafka, a.a.O., S. 415.<br />
[48] Vgl. Franz Kafka: Ein Bericht für eine Akademie, in: GW, Erzählungen, a.a.O., S. 142.<br />
[49] "Als ich heute in der schlaflosen Nacht alles immer wieder hin- und hergehen ließ<br />
zwischen den schmerzenden Schläfen, wurde mir wieder, was ich in der letzten genug<br />
ruhigen Zeit fast vergessen hatte, bewußt, auf was für einen schwachen oder gar nicht<br />
vorhandenen Boden ich lebe, über einem Dunkel, aus dem die dunkle Gewalt nach ihrem<br />
Willen hervorkommt und, ohne sich an mein Stottern zu kehren, mein Leben zerstört. Das<br />
Schreiben erhält mich, aber ist es nicht richtiger zu sagen, daß es diese Art Leben erhält.<br />
Damit meine ich natürlich nicht, daß mein Leben besser ist, wenn ich nicht schreibe.<br />
Vielmehr ist es dann viel schlimmer und gänzlich unerträglich und muß mit dem Irrsinn<br />
enden." - Kafka: GW, Briefe 1902-1924, a.a.O., S. 384 f.<br />
[50] Kafka: Ein Bericht für eine Akademie, a.a.O., S. 142.<br />
[51] Vgl. Horkheimer/Adorno, a.a.O., S. 47.<br />
[52] Vgl. Kafka: Ein Bericht für eine Akademie, a.a.O., S. 148.<br />
[53] Kafka: Ein Bericht für eine Akademie, a.a.O., S. 146.<br />
[54] Vgl. Adorno: Aufzeichnungen zu Kafka, a.a.O., S. 281.<br />
[55] Kafka: Ein Bericht für eine Akademie, a.a.O., S. 147.<br />
[56] Horkheimer/Adorno, a.a.O., S. 41.<br />
[57] "In der Verarmung der Mittel, welche das Ideal der Schwärze, wenn nicht jegliche<br />
Sachlichkeit mit sich führt, verarmt auch das Gedichtete, Gemalte, Komponierte; die<br />
wäre der Weltlauf wesentlich noch einer der Individuation, als reichte das Individuum mit<br />
seinen Regungen und Gefühlen ans Verhängnis noch heran, als vermöchte unmittelbar das<br />
Innere des Einzelnen noch etwas: die allverbreitete biographische Schundliteratur ist ein<br />
Zersetzungsprodukt der Romanform selber." - Theodor W. Adorno: Form und Gehalt des<br />
zeitgenössischen Romans, in: Gotthard Wunnberg (Hg.): Theorie und Technik des Romans<br />
im 20. Jahrhundert, Tübingen 1979, S. 77.<br />
[65] Kafka zit. n. Wagenbach, a.a.O., S.41.<br />
[66] Bezüglich der abstrakten Kunst Picassos bemerkte Kafka, dieser "notiert (...) die<br />
Verunstaltungen, die noch nicht in unser Bewußtsein eingedrungen sind. Kunst ist ein<br />
Spiegel, der 'vorausgeht' wie eine Uhr - manchmal." - Kafka zit. n. Garaudy, a.a.O., S. 216. -<br />
Was Kafka über Picasso sagt, gilt auch für ihn selbst.<br />
QUELLE: http://www.sopos.org/aufsaetze/39cba5e6a2443/1.phtml
„Es wird gute Arbeit geleistet werden“ – „Kafkas Fabriken“ und sein Vertrauen in den technischen Fortschritt von Uwe Wittstock<br />
Marbach – „Es war spät abend als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schloßberg war nichts zu sehen, Nebel und<br />
Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloß an. Lange stand K. auf der Holzbrücke,<br />
die von der Landstraße zum Dorf führte, und blickte in die scheinbare Leere empor.“ – Einer der berühmtesten Romananfänge<br />
der modernen Literatur, ganz unaufwendig, und doch ist die Bedrohlichkeit des noch unsichtbaren Schlosses sofort wie mit<br />
Händen zu greifen.<br />
Die Versuchung ist groß, sich die Ankunft des jungen Juristen Dr. Franz Kafka, Konzipist der Prager Arbeiter-Unfall-Versicherungs-<br />
Anstalt (AUVA), im Januar/Februar 1911 bei der Kattundruckerei Rolffs & Cie und der Feintuchfabrik Wilhelm Siegmund im<br />
Böhmischen Friedland ähnlich vorzustellen. Denn oberhalb der beiden Fabriken, die Kafka auf seiner Dienstreise auftragsgemäß in die<br />
„Gefahrenklassen“ der AUVA „einzureihen“ und so die Versicherungsbeiträge der Firmen festzulegen hatte, thronte das Schloss<br />
Friedland ein wenig entrückt und in der Nacht gewiss im Dunkel ganz verborgen. Und Besitzer dieses Schlosses war damals zwar nicht<br />
ein Graf Westwest, wie er im späteren Roman hieß, wohl aber ein Graf Clam, dessen Name nur wenig verändert als Klamm, Vorstand<br />
der X. Kanzlei, in Kafkas Buch einging.<br />
Details wie diese sind in der Kafka-Forschung erschöpfend analysiert worden. Die aktuelle Ausstellung des Schiller-Nationalmuseums in<br />
Marbach wendet deshalb den Blick geradezu demonstrativ von Kafkas Schloss ab und dem eigentlichen Grund seiner damaligen Reisen<br />
zu: „Kafkas Fabriken“. Die beiden Ausstellungsmacher, der unermüdliche Klaus Wagenbach („Ich bin die dienstälteste Kafka-Witwe“)<br />
und Hans-Gerd Koch, haben in Kooperation mit Petra Plättner höchst anschauliches Material über Kafkas Arbeitsfelder und<br />
Arbeitsalltag zusammengetragen.<br />
Der empfindsame, gesundheitlich labile Jurist Kafka war in seiner vermeintlich ruhigen Angestelltenexistenz bei der AUVA mit einigen<br />
besonders unschönen Aspekten des industriellen Wachstums konfrontiert. Die Fabrikherren seiner Zeit hielten wenig von<br />
Arbeitsschutzmaßnahmen, wie sie heute selbstverständlich sind. Tagtäglich liefen in AUVA Schadenmeldungen und<br />
Entschädigungsanträge ein, reich an schockierenden Fakten. Allein die oft ungeschützt laufenden Transmissionsriemen der Spinnereien<br />
oder Webereien erwiesen sich als menschenfressende, körperverschlingende Schreckensapparaturen. Die Ausstellung zeigt<br />
zeitgenössische Fotos einer von Transmissionsriemen abgequetschten Hand, zweier regelrecht skalpierter Arbeiterinnen und eines im<br />
Riemenräderwerk vollständig zermalmten Arbeiters. Assoziationen an den gemarterten Gefangenen aus Kafkas Erzählung<br />
„Strafkolonie“ sind unvermeidlich.<br />
Angesichts dieser buchstäblich blutigen Arbeitsrealität rettete sich Kafka gelegentlich in einen sarkastischen Ton, hinter dem sein<br />
Erschrecken dennoch spürbar bleibt. „Denn was ich zu tun habe!“, schreibt er an seinen Freund Max Brod in einem Brief, der entfernt an
Jakob van Hoddis Gedicht „Weltende“ erinnert: „In meinen vier Bezirkshauptmannschaften fallen – von meinen übrigen Arbeiten<br />
abgesehn – wie betrunken die Leute von den Gerüsten herunter, in die Maschinen hinein, alle Balken kippen um, alle Böschungen<br />
lockern sich, alle Leitern rutschen aus, was man hinauf gibt, das stürzt hinunter, was man herunter gibt, darüber stürzt man selbst. Und<br />
man bekommt Kopfschmerzen von diesen jungen Mädchen in den Porzellanfabriken, die unaufhörlich mit Türmen von Geschirr sich auf<br />
die Treppen werfen.“<br />
Kafka bemühte sich mit seinen Mitteln, die Situation der Arbeiter zu bessern. Im Jahresbericht der AUVA 1910 erscheint ein illustrierter<br />
Beitrag zu „Unfallverhütungsmaßnahmen bei Holzhobelmaschinen“, der zwar nicht unterzeichnet, aber offensichtlich von Kafka<br />
verfasst ist. In einer vom Kanzleideutsch des Jahresberichtes angenehm sich abhebenden Sprache beschreibt er die Vorzüge der „runden<br />
Sicherheitswellen“ im Vergleich zu älteren, gefährlichen Kanthobelwellen.<br />
Schon dieses Engagement zeigt, dass Kafka kein pauschaler Gegner der technischen Moderne war, im Gegenteil, dass er gerade im<br />
technischen Fortschritt auch Chancen und Zugewinn sah: „Es wird gute Arbeit geleistet werden“, schreibt er 1909 über die<br />
Zukunftsperspektiven AUVA, „und was innerhalb der heutigen Gesetze an verlangten und nützlichen Reformen möglich ist, es wird<br />
geschehn.“<br />
Doch auch das spielerische, abenteuerliche Element der Technik war Kafka nicht fremd. Von seinem Onkel Siegfried Löwy, Landarzt und<br />
Betriebsarzt dreier Tuchfabriken, lieh er sich gelegentlich dessen Motorrad der tschechischen Firma Laurin & Klement (später Skoda) für<br />
Spritztouren aus. Und seiner Begeisterung für die „Aeroplane in Brescia“ machte er 1910 in einem Artikel für die Zeitung „Bohemia“<br />
Luft. Die Ausstellungsmacher haben ein Laurin & Klement Motorrad im Original, und eines der Flugzeuge von Brescia im Modell<br />
aufgetrieben – beides zweifellos von besonderem Schau-Wert.<br />
Doch besonders anrührend ist eher eine unscheinbare Visitenkarte, die Kafka am 24. September 1912 an seinen Vorgesetzten in die<br />
AUVA schickte und auf der Rückseite notierte: „Sehr geehrter Herr Oberinspektor! Ich habe heute früh einen kleinen Ohnmachtsanfall<br />
gehabt und habe etwas Fieber. Ich bleibe daher zuhause. Es ist aber bestimmt ohne Bedeutung und ich komme bestimmt heute noch,<br />
wenn auch vielleicht erst nach 12 ins Bureau Ihr ergebener Dr. Franz Kafka“.<br />
Der Vorfall war literarisch keineswegs „ohne Bedeutung“, Kafka hatte in der Nacht vom 22. zum 23. September zwischen 10 Uhr abends<br />
und 6 Uhr früh die Erzählung „Das Urteil“ niedergeschrieben. In der Zeit bis zum 6. Dezember entstanden in weiteren nächtlichen<br />
Schreibschüben „Der Verschollene (Amerika)“ und „Die Verwandlung“. Kafka hielt nicht Haus mit seinen Kräften, die AUVA musste<br />
gelegentlich auf ihn verzichten.<br />
Kafka bemühte sich mit seinen Mitteln, die Situation der Arbeiter zu bessern. Im Jahresbericht der AUVA 1910 erscheint ein illustrierter
Beitrag zu „Unfallverhütungsmaßnahmen bei Holzhobelmaschinen“, der zwar nicht unterzeichnet, aber offensichtlich von Kafka<br />
verfasst ist. In einer vom Kanzleideutsch des Jahresberichtes angenehm sich abhebenden Sprache beschreibt er die Vorzüge der „runden<br />
Sicherheitswellen“ im Vergleich zu älteren, gefährlichen Kanthobelwellen.<br />
Schon dieses Engagement zeigt, dass Kafka kein pauschaler Gegner der technischen Moderne war, im Gegenteil, dass er gerade im<br />
technischen Fortschritt auch Chancen und Zugewinn sah: „Es wird gute Arbeit geleistet werden“, schreibt er 1909 über die<br />
Zukunftsperspektiven AUVA, „und was innerhalb der heutigen Gesetze an verlangten und nützlichen Reformen möglich ist, es wird<br />
geschehn.“<br />
Doch auch das spielerische, abenteuerliche Element der Technik war Kafka nicht fremd. Von seinem Onkel Siegfried Löwy, Landarzt und<br />
Betriebsarzt dreier Tuchfabriken, lieh er sich gelegentlich dessen Motorrad der tschechischen Firma Laurin & Klement (später Skoda) für<br />
Spritztouren aus. Und seiner Begeisterung für die „Aeroplane in Brescia“ machte er 1910 in einem Artikel für die Zeitung „Bohemia“<br />
Luft. Die Ausstellungsmacher haben ein Laurin & Klement Motorrad im Original, und eines der Flugzeuge von Brescia im Modell<br />
aufgetrieben – beides zweifellos von besonderem Schau-Wert.<br />
Doch besonders anrührend ist eher eine unscheinbare Visitenkarte, die Kafka am 24. September 1912 an seinen Vorgesetzten in die<br />
AUVA schickte und auf der Rückseite notierte: „Sehr geehrter Herr Oberinspektor! Ich habe heute früh einen kleinen Ohnmachtsanfall<br />
gehabt und habe etwas Fieber. Ich bleibe daher zuhause. Es ist aber bestimmt ohne Bedeutung und ich komme bestimmt heute noch,<br />
wenn auch vielleicht erst nach 12 ins Bureau Ihr ergebener Dr. Franz Kafka“.<br />
Der Vorfall war literarisch keineswegs „ohne Bedeutung“, Kafka hatte in der Nacht vom 22. zum 23. September zwischen 10 Uhr abends<br />
und 6 Uhr früh die Erzählung „Das Urteil“ niedergeschrieben. In der Zeit bis zum 6. Dezember entstanden in weiteren nächtlichen<br />
Schreibschüben „Der Verschollene (Amerika)“ und „Die Verwandlung“. Kafka hielt nicht Haus mit seinen Kräften, die AUVA musste<br />
gelegentlich auf ihn verzichten.<br />
© Die Welt, 13 Dezember 2002, http://www.kafka.org/index.php?aid=254 (im Rahmen einer Ausstellung)
12.09.2012 Würth<br />
"Schraubenkönig" schockiert Mitarbeiter mit Drohbrief<br />
DPA, "Schraubenkönig" Reinhold Würth: Rüffel für den Außendienst<br />
"Sind Sie um 7.30 Uhr beim ersten Kunden?" In ungewöhnlich scharfem Ton hat der als "Schraubenkönig" bekannte Unternehmer<br />
Reinhold Würth seine Außendienstler gerüffelt. Er gedenke ja nicht, die Abteilung abzuschaffen, appelliere "aber an Sie alle, die<br />
Geduld der Zentrale nicht zu überfordern".<br />
Schwäbisch-Hall - Die IG Metall hat verärgert auf einen Brandbrief von "Schraubenkönig" Reinhold Würth reagiert. In dem<br />
siebenseitigen Brief, aus dem die "Stuttgarter Zeitung" und die Nachrichtenagentur dpa zitieren, liest der Vorsitzende des<br />
Stiftungsaufsichtsrates der Künzelsauer Würth-Gruppe seinen Außendienstmitarbeitern kräftig die Leviten.<br />
Im ersten Halbjahr 2012 hätten sie nur 3,3 Prozent Wachstum erzielt. Dabei wolle der Konzern bis zum Jahr 2020 20 Milliarden Umsatz<br />
erwirtschaften, ihn also in den kommenden acht Jahren verdoppeln. Wegen der "miserablen Umsatzzuwachsrate" des ersten Halbjahrs<br />
könne der Firmengewinn so unter Druck geraten, "dass wir uns von Außendienstlern, die vielleicht nicht mehr als ihre eigenen Kosten<br />
verdienen, trennen müssten", hieß es in dem Schreiben.<br />
Würth zitiert die Weisheit "Morgenstund' hat Gold im Mund" und legt den Außenmitarbeitern nahe, sich ein Beispiel am Innendienst zu<br />
nehmen. Die Angestellten in der Zentrale seien mit Mittagspause von 7.30 bis 17.15 Uhr im Dienst. "Sind Sie um 7.30 Uhr beim ersten<br />
Kunden?"
"Ich sehe meine Kinder auch nur im Urlaub."<br />
Seine 63-jährige Berufserfahrung sage ihm, dass ein großer Teil der Außendienstmitarbeiter die Arbeitszeit nur zu 60 bis 70 Prozent<br />
nutze. "Ausdrücklich: Ich denke nicht daran, den Außendienst abzuschaffen, appelliere aber an Sie alle, die Geduld der Zentrale nicht zu<br />
überfordern."<br />
"Wenn man nur ein bisschen kratzt, ist gleich der Lack ab"<br />
Die IG Metall zeigte sich entsetzt: "Eine solche Schärfe, was den Vertrieb angeht, kenne ich nur aus dem Betrieb Würth", sagte Heide<br />
Scharf, Bevollmächtigte der Gewerkschaft für Schwäbisch Hall. Sie habe das Unternehmen schon länger im Blick: "Nach außen hin ist<br />
alles super, aber wenn man nur ein bisschen kratzt, ist gleich der Lack ab."<br />
Trotz der knapp 66.000 Mitarbeiter weltweit und mehreren tausend in der Region gebe es bei Würth keinen Betriebsrat - nur einen<br />
Vertrauensrat ohne jegliche rechtliche Grundlage. Es sei höchste Zeit, einen Betriebsrat zu wählen, forderte sie. Auch müssten die<br />
Gehälter der Mitarbeiter mit einem Tarifvertrag geregelt werden. Die Initiative müsse allerdings von den Mitarbeitern kommen. "Doch<br />
die Leute haben einfach Angst und trauen sich nicht."<br />
Norbert Heckmann, Vorsitzender der Würth-Geschäftsführung, antwortete schriftlich auf die Veröffentlichung des Briefs: Ziel sei es, die<br />
Kunden zu begeistern. "Daher ist die Führung leistungsbezogen und darauf aus, eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit zu generieren,<br />
getreu unserer Kulturregel 'Je größer der Erfolg, umso höher die Freiheitsgrade'." In jährlichen, anonymisierten Mitarbeiterbefragungen<br />
werde ihnen eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit im Außendienst bestätigt.<br />
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ig-metall-rueffelt-brandbrief-von-wuerth-a-855418.html
Von Kafka zu Gorbatschow<br />
NEW YORK – Am 2. August 1914 schrieb Franz Kafka in sein Tagebuch: „Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. – Nachmittag<br />
Schwimmschule.“ Trotz seiner offenkundigen Distanz zur Unwirklichkeit dieses Tages, war dieser zurückgezogene und visionäre<br />
mitteleuropäische Schriftsteller jener Mann, der seinem Jahrhundert das Attribut „kafkaesk“ verlieh. Fünfundsiebzig Jahre mussten nach<br />
Kafkas Schwimmausflug für Mittel- und Osteuropa vergehen, bis sie in die größere europäische Zivilisation zurückkehrten. Eine<br />
kafkaeske Pause, könnte man sagen.<br />
Dieses Mittel- und Osteuropa war nicht nur ein Ort rechter und linker Diktaturen, des Ethnozentrismus und der Fremdenfeindlichkeit,<br />
der immer wiederkehrenden und festgefahrenen Konflikte, wie dies von manchen momentan verzerrt dargestellt wird. Es war auch die<br />
Geburtsstätte eines spirituellen Erbes, von Denkern und Künstlern, einer speziellen Form der Kreativität und der Suche nach dem Sinn<br />
über pragmatische Verhandlungen mit dem täglichen Leben hinaus.<br />
Im Jahr 1989 brachten die Völker dieser Region bei ihrer „Rückkehr nach Europa“ ihre Vielfalt und Buntheit mit, ihre Lebendigkeit,<br />
Geheimnisse und Erinnerungen sowie auch alte und neue Sehnsüchte. Und sie brachten die Erkenntnis, dass der Übergang von einer<br />
geschlossenen Gesellschaft in eine offene sowohl möglich als auch extrem schwierig ist.<br />
Thomas Mann schrieb einst: „Die Freiheit ist komplizierter als die Macht.” Freiheit verändert den Rahmen und das Wesen der<br />
Entscheidung sowie der individuellen und kollektiven Verantwortung. Sie betont den Gegensatz zwischen Initiative und Apathie,<br />
Wagemut und Gehorsam, Konkurrenz und absoluter Abhängigkeit von einem Staat, der eine Art unabänderliches Schicksal verkörpert.<br />
Ebenso wie Sklaverei Schritt für Schritt erlernt werden muss, um deren Terror und Finten zu überleben, muss Freiheit erlernt werden,<br />
um ihren Risiken und Chancen zu begegnen.<br />
An dieser fließenden Grenze zwischen Alt und Neu sehnten sich die Menschen am meisten nach dem, was sie niemals hatten: nach<br />
Denk- und Meinungsfreiheit, nach Information, nach den Möglichkeiten, ihr eigenes Glück zu diskutieren und zu definieren.<br />
Der Fall der Berliner Mauer und die Wiedervereinigung – von Michail Gorbatschow überraschend akzeptiert – bedeuteten unmittelbare<br />
und direkte Unterstützung für den Wiederaufbau der ostdeutschen Institutionen und der Wirtschaft. Aber sogar in Deutschland war die<br />
Situation alles andere als ideal. Viele „Ossis“ waren aufgrund ihrer scheinbaren Stellung als Bürger zweiter Klasse frustriert und viele<br />
„Wessis“ stießen sich an der finanziellen Last der Wiedervereinigung.<br />
Anderswo erwies sich der Wandel als noch viel komplizierter. Viele der neuen postkommunistischen Gesellschaften – durchdrungen von<br />
Rachegelüsten, Verbitterung und beinharten Kämpfen um Macht und Ansehen – wurden zu einer Brutstätte des aggressiven<br />
Nationalismus. Ethnozentrismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus florierten neben Korruption, Nepotismus, Heuchelei und
Opportunismus. Die postkommunistischen Wirren führten zum Zerfall der Sowjetunion und der Auflösung der Tschechoslowakei,<br />
schürten die Kriege und ethnisch motivierten Gräueltaten in Jugoslawien und brachten in Russland autoritäre Herrschaft und imperialen<br />
Revanchismus hervor.<br />
In dieser chaotischen Freiheit zerstörten unvermittelt enthüllte Geheimnisse Familien und Freundschaften und ein allgemeines Gefühl<br />
der Zusammengehörigkeit. Sie erschütterten die soziale Stabilität, so unsicher und verfälscht sie auch war. In manchen Fällen wurden<br />
sogar alte Heuchelei und Opportunismus durch neue Formen derselben ersetzt, wie man an dem Erfolg vieler ehemaliger Funktionäre<br />
und Geheimpolizei-Mitglieder erkennen konnte.<br />
Die öffentlichen Debatten in ganz Osteuropa offenbarten bald eine erbitterte Konfrontation zwischen zwei unterschiedlichen<br />
verborgenen Erinnerungen: die Erinnerung an den Holocaust und jene an den kommunistischen Terror und seine Verbrechen. Es<br />
entstand eine idiotische Konkurrenz zwischen den beiden Albträumen, dem Holocaust und dem Gulag, dem totalitären Nazismus und<br />
dem totalitären Kommunismus.<br />
Zwangsläufig entwickelten sich alt-neue Klischees. In Rumänien verurteilten etliche führende Intellektuelle das so genannte „jüdische<br />
Leidensmonopol“…Teil einer internationalen Verschwörung, die, wieder einmal, die Region zwischen Donau und den Karpaten erreicht<br />
hatte.<br />
Während der berüchtigten Walser-Debatte in Deutschland im Jahr 1998 über die „unerträgliche” Art, wie Deutsche nach dem Holocaust<br />
dargestellt wurden, schlug ich vor, dass jedes Land seine Denkmäler der Heldentums, durch Denkmäler der Schande ergänzen solle, um<br />
das Unrecht, das man anderen Ländern, anderen Völkern und auch den Menschen im eigenen Land angetan hatte, in Erinnerung zu<br />
rufen. Ein Jahrzehnt später scheint dieser Vorschlag noch immer sinnvoll. Wären Denkmäler der Schande nicht ebenso lehrreich, wenn<br />
nicht noch lehrreicher, als die Denkmäler des Heldentums?<br />
Obwohl die Aufnahme in die Europäische Union einen Schlussstrich unter die postkommunistische Phase zu ziehen schien (zumindest<br />
in Mittel und Osteuropa), markierte der Bruch von 1989 nicht den Beginn einer Ära vollkommener Zusammenarbeit der Menschen und<br />
für die Menschen. Aber das hinderte manche nicht, das Ende der Ideologie – und somit der Geschichte – gegenüber dem Sieg des<br />
liberalen Kapitalismus zu verkünden.<br />
Es bedarf eines gerüttelt Maßes an Vorstellungskraft, Optimismus oder blanker Dummheit um zu glauben, dass die Menschen jemals<br />
jenseits von Geschichte und Ideologie leben werden. Wie die religiösen Terroristen des 11. September 2001 bewiesen, geht die<br />
menschliche Geschichte und die Geschichte der Menschheit wie bisher weiter - durch Ideen und Konflikte, durch absolutes Glück<br />
verheißende Projekte, durch Grausamkeit und Katastrophen, durch Revolutionen und Wiedererstehung.
Mittelmäßige politische Führer und ein zur Karikatur verkommener öffentlicher Diskurs machen den liberalen Kapitalismus zu einer<br />
schlechten Werbung für die absolute Idee. Tatsächlich fragt man sich mancherorts, ob die jüngste Finanzkrise für den liberalen<br />
Kapitalismus dieselbe Bedeutung hatte wie der Fall der Berliner Mauer für den Kommunismus.<br />
Es besteht eine enervierende Ähnlichkeit zwischen der naiven Prämisse der Ökonomen vom vollkommen rationalen Markt und dem<br />
„dialektischen Materialismus“ des wissenschaftlichen Sozialismus. Durch die Verschleppung des Begriffs „Rationalität“ im Glauben,<br />
menschliches Verhalten vorhersagen (und daher potenziell kontrollieren) zu können, hat sich der arrogante Generalstab der Ökonomen,<br />
Banker und Bürokraten von heute nicht nur selbst kompromittiert, sondern auch den Grundbegriff von Freiheit.<br />
Wir haben keine wirkliche Alternative zum Markt, ebenso wenig wie wir über eine wirkliche Alternative zur Freiheit verfügen. Keines<br />
der Defizite oder Mankos marktwirtschaftlicher Ökonomien ist so schlimm, wie die Abhilfemaßnahmen dagegen. Aber ebenso wie jeder<br />
Akt individueller und kollektiver Freiheit den „realen Sozialismus“ bedrohte, müssen wir erkennen, dass die menschliche Freiheit – die<br />
Emanzipation der Kreativität – das Ende der Gewissheit bedeutet.<br />
Diese Ungewissheit schwächt den liberalen Kapitalismus nicht – im Gegenteil, sie ist die wesentlichste Quelle der Stärke dieses Systems.<br />
Sie erstreckt sich sehr wohl darauf, was Ökonomen über menschliches Verhalten und den Markt wissen können. In dieser Hinsicht ist die<br />
wichtigste Lehre aus 1989 und seinen Folgen, dass die Entwicklung einer Gesellschaft nie genau vorhergesagt werden kann. Und dass<br />
trotz großer Schwierigkeiten und Spannungen, der raue postkommunistische Kapitalismus von heute noch immer besser ist, als der<br />
degenerierte und tyrannische „reale Sozialismus“ von gestern. (2009)<br />
Norman Manea<br />
Norman Manea’s latest novel, Vizuina (The Lair) was published in Romania in 2010, and will appear soon in Brazil, France, Italy, Germany,<br />
Spain, Sweden, the US, and elsewhere.<br />
http://www.project-syndicate.org/commentary/from-kafka-to-gorbachev
Stärker als alle Schwerkraft von Thomas Steinfeld<br />
Wie nur wenige steht Franz Kafka für das Leiden am Deutschen. Doch Kafka war nicht der größte Gefangene, sondern der größte<br />
Virtuose der deutschen Sprache. Eine der bekanntesten Erzählungen in deutscher Sprache beginnt mit dem Satz: "Als Gregor Samsa<br />
eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt."<br />
undatiertes Porträt Franz Kafkas: Sein Ort war sein Schreiben, seine Sprache, seine Dichtung. (© Foto: dpa)<br />
Das Ereignis, von dem hier die Rede ist, mag gewaltig sein, erschütternd, unbegreiflich. Aber die Form, in der davon berichtet wird, ist<br />
das Muster eines wohlgestalteten deutschen Satzes. Wie naheliegend wäre es gewesen, das Außerordentliche auch sprachlich zu<br />
gestalten. Doch nichts Ungewöhnliches geschieht, weder in der Grammatik noch in der Wortwahl. Geordnet und auf diskrete Weise<br />
lebhaft zieht der Satz dahin, der lange Satzbogen ist gespannt durch die Temporalkonstruktion und die beiden jeweils ans Ende des<br />
Haupt- und Nebensatzes gesetzten Verben.<br />
Vielfüßiges Stolpern und Trippeln<br />
Und wie geschickt ist es, aus dem steten Rhythmus genau drei Wörter herausfallen zu lassen: "unruhigen", "ungeheuren" und<br />
"Ungeziefer". In diesen Wörtern ist es, als begänne mitten im Satz ein vielfüßiges Stolpern und Trippeln. Von Franz Kafka, dem jung an<br />
Schwindsucht gestorbenen Prager Juden, ist seit langem die Vorstellung im Umlauf, er habe, wie kein anderer Schriftsteller, die<br />
Katastrophen des 20.Jahrhunderts in sich aufgenommen, in seine Person und in sein Werk. Dieses Schreckensgesicht, diese weit<br />
geöffneten Augen und aufgestellten Ohren! Im Werk von Kafka sei, so will es diese spät, erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene<br />
Vorstellung, das Leiden am Deutschen auf seinem Höhepunkt angekommen.<br />
Ein sprachlicher Nicht-Ort<br />
In der Folge sei Kafka gar nicht wirklich in der deutschen Sprache zu Hause. So kam es, dass eigens für ihn ein sprachlicher Nicht-Ort
eingerichtet wurde, abseits des emanzipierten Judentums, für das sein Vater stand, abseits der Sprache, die ihm als Prager Deutsch, als<br />
die Sprache einer gebildeten, unangefochtenen Minderheit entgegentrat, abseits auch des Tschechischen, das die Arbeiter und einfachen<br />
Leute in Böhmen sprachen. Dabei besteht sein Werk mitnichten aus dem Mäusegequieke, das Gregor Samsa als Ungeziefer von sich gibt.<br />
Offensichtlich gibt es auch für Franz Kafka einen Ort: sein Schreiben, seine Sprache, seine Dichtung. "Er wurde geboren mit der Frage: 'Was<br />
haben wir hier auf dieser Welt zu tun?'" Die 104-jährige Pianistin und Überlebende des Konzentrationslagers Theresienstadt, Alice Herz-Sommer,<br />
spricht über ihre Bekanntschaft zu Franz Kafka. Deutlich sind sie geprägt von der deutschen Literatur des 19.Jahrhunderts, von Goethe vor<br />
allem, aber auch von Kleist, von Johann Peter Hebel, von Adalbert Stifter. Einen anderen als diesen mitten in der deutschen Sprache<br />
beheimateten, mit sich selbst identischen Franz Kafka gibt es nicht. Immer wieder sagt Kafka, er lebe nur schreibend. "Die Festigkeit<br />
aber", teilt er im November 1913 Felice Bauer mit, "die das geringste Schreiben mir verursacht, ist zweifellos und wunderbar."<br />
Negatives Gesetz<br />
Dieses Schreiben aber, heißt es anderswo, sei "nichts als die Fahne des Robinson auf dem höchsten Punkt der Insel." In zahllosen<br />
Deutungen, denen das Unglück dieses Schriftstellers vorausgesetzt zu sein scheint wie ein Fundament aus Beton, wurde aus dieser<br />
Nachricht das negative Gesetz des gesamten Werks: das Schreiben als höchste, letzte und doch wieder aussichtslose Flucht aus einem<br />
verlorenen, angsterfüllten Leben. Wie aber, wenn man in dieser Auskunft über sich selbst etwas anderes, minder Existentielles zu<br />
erkennen hätte? Wie, wenn Kafka nicht der größte Gefangene, sondern der größte Virtuose der deutschen Sprache gewesen wäre, ein<br />
Sportler gleichsam, erfüllt von einem unbedingten Willen, seine Fähigkeiten auszuleben, sie sinnlich gestaltet zu erfahren?<br />
Und wenn eben seine Meisterschaft darin bestanden hätte, diese Virtuosität in den Dienst der Dichtung zu<br />
stellen, lauter wohlgeordnete, lebendige Sätze hervorbringen zu können, ein jeder genau so lang, wie er sein muss, gefüllt mit möglichst<br />
wenigen, aber treffenden, und nicht mit vielen prächtigen Wörtern?
Fein rhythmisierte Satzgefüge<br />
"Aber jeden Tag soll zumindest eine Zeile gegen mich gerichtet werden", schreibt er. Und selbst wenn Franz Kafka in solchen Sätzen<br />
Gericht über sich selbst gehalten hätte - es schließt nicht aus, dass er im selben Augenblick, in dem er dies schrieb, die Hände vom Blatt<br />
hob und lustvoll mit der Zunge schnalzte: Welch großartiger Satz! Kafkas Meisterschaft ist in den überaus sorgfältig aufgebauten, fein<br />
rhythmisierten Satzgefügen zu erkennen, in der völligen Abwesenheit des ungewöhlichen, auffälligen Wortes, in einem souveränen<br />
Umgang mit der indirekten Rede sowie, nicht zuletzt, in der erschöpfenden Nutzung der grammatischen wie der logischen<br />
Möglichkeiten der Negation im Deutschen. Josefine, schreibt Franz Kafka in seiner letzten abgeschlossenen Erzählung, heiße eine Maus<br />
und Sängerin. "Wer sie nicht gehört hat, kennt nicht die Macht des Gesangs."<br />
Unerreichtes Bewusstsein für die deutsche Sprache<br />
Der Erzähler wird Josefine gehört haben, ja, aber seine Leser kennen ihre Stimme nicht. Und so wird Versuch um Versuch verworfen,<br />
dennoch von diesem Gesang zu berichten: "das ist aber eben nicht der Fall" - bis die Maus am Ende eine negative Apotheose erlebt:<br />
"Josefine (...) wird fröhlich sich verlieren in der zahllosen Menge der Helden unseres Volkes, und bald, da wir keine Geschichte treiben,<br />
in gesteigerter Erlösung vergessen sein wie alle ihre Brüder." Wie das gebaut ist - so, dass aus diesen "nichts" und "keins" viel mehr<br />
hervorgeht als die Zurückweisung von etwas Bestehendem, nämlich ein Nicht-Ort, etwas, das Ort und Nichts zugleich ist, das dann, in<br />
einer letzten, das Ironische berührenden Wendung ("in gesteigerter Erlösung vergessen") ins Metaphysische gekippt wird. Ein schärferes<br />
sprachliches Bewusstsein besitzt kein anderer deutscher Autor. Die Erzählung "Das Urteil", so hält Franz Kafka in seinem Tagebuch fest,<br />
habe er unerhört schnell geschrieben, in einer Septembernacht des Jahres 1912: "Nur so kann geschrieben werden, nur in einem solchen<br />
Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele."<br />
Meister in der Betrachtung seines Werkes<br />
Und weil diese Dichtung einem bösen Traum zumindest ähnelt, weil sie einem wüsten, bedrohlichen und ausweglosen Alb gleicht,<br />
entsteht der Gedanke, dieses Schreiben verdanke sich selbst einer dunklen Inspiration, sei besinnungsloser Ausdruck einer<br />
verhängnisvollen Gnade, unbewusst hellsichtige Konsequenz eines tief tragischen Ringens um die Existenz als solche und als eigene.<br />
Der Stolz und die Genugtuung über das gelungene Stück aber verraten etwas anderes: den Meister in der Betrachtung seines Werks. Und<br />
dieser Meister ist groß genug, dass ihm alles zum Stoff wird - die Angst vor dem Vater, der Selbstzweifel, die Unsicherheit gegenüber<br />
Frauen und Freunden. Das Gelingen in der Sprache aber ist größer und stärker als alle Schwerkraft der eigenen Befindlichkeit.<br />
http://www.sueddeutsche.de/kultur/zum-geburtstag-von-franz-kafka-staerker-als-alle-schwerkraft-1.207429-2 (2008)
Die Suche von Heike Faller<br />
Wie ein amerikanischer Literaturprofessor versucht, die Briefe zu finden, die Kafka an ein kleines Mädchen geschrieben haben soll, als er in Berlin lebte<br />
Kafka liebte Berlin, und im letzten Jahr seines Lebens schaffte er es schließlich, Prag zu verlassen. Er zog in die Stadt, die auf seiner<br />
inneren Landkarte Freiheit bedeutete, ein Gegenmittel zu Prag. In Steglitz lebte er mit seiner Freundin Dora Diamant, die Ende der<br />
vierziger Jahre in einem Interview diese Geschichte erzählte: Als wir in Berlin waren, ging Kafka oft in den Steglitzer Park. Ich begleitete<br />
ihn manchmal. Eines Tages trafen wir ein kleines Mädchen, das weinte und ganz verzweifelt zu sein schien. Wir sprachen mit dem<br />
Mädchen. Franz fragte es nach seinem Kummer, und wir erfuhren, dass es seine Puppe verloren hatte. Sofort erfindet er eine plausible<br />
Geschichte, um dieses Verschwinden zu erklären: >Deine Puppe macht nur gerade eine Reise, ich weiß es, sie hat mir einen Brief<br />
geschickt.< Das kleine Mädchen ist etwas misstrauisch: >Hast du ihn bei Dir?< - > Nein, ich habe ihn zuhause liegen lassen, aber ich<br />
werde ihn Dir morgen mitbringen.<<br />
Das neugierig gewordene Mädchen hatte seinen Kummer schon halb vergessen, und Franz kehrte sofort nach Hause zurück, um den<br />
Brief zu schreiben. Die Korrespondenz soll drei Wochen gedauert haben, in denen die Puppe größer wurde, in die Schule kam, neue<br />
Leute kennen lernte - und dem Mädchen immer wieder ihre Liebe versicherte. Am Ende soll Kafka sogar ein Happy End geschrieben<br />
haben, sein einziges: Die Puppe hatte einen Mann kennen gelernt und geheiratet (und konnte deshalb nicht zu dem Mädchen<br />
zurückkehren). Die Briefe wurden nie gefunden, aber sie wurden auch nicht wirklich gesucht.<br />
Vielleicht sind sie verbrannt oder wurden von der Gestapo beschlagnahmt, vielleicht liegen sie in einem Berliner Keller oder in einem<br />
Altersheim: wenn das Mädchen alt geworden ist, wäre sie jetzt Anfang achtzig. Die Zeit wird also knapp für den amerikanischen Kafka-<br />
Forscher Mark Harman, der als Fellow der American Academy für neun Monate in Berlin ist (ungefähr derselbe Zeitraum, den Kafka in<br />
der Stadt verbracht hat), um die Briefe zu suchen.<br />
Mark Harman ist groß und hager wie Kafka<br />
Mark Harman ist Associate Professor für Germanistik und Englisch am Elizabethtown College in Pennsylvania<br />
1998 erschien von ihm eine neue Übersetzung von dem Schloß. Sollte er die Briefe an das Mädchen finden, wäre das natürlich eine<br />
Sensation, sie würden selbstverständlich den Erben gehören, sagt Harman. Er will die Briefe nicht, er würde sie nur lesen wollen. Sie<br />
könnten - in seiner Vorstellung - eine neue, ziemlich überraschende Seite an Kafka zeigen: den heiteren Kafka, einen Kafka hinter der<br />
Angst, der zum ersten Mal mit einer Frau zusammenlebte, mit Kindern spielte und sich von seiner Schwester Grimms Märchen schicken<br />
ließ. Sie könnten zeigen, was aus Kafka geworden wäre, wenn er nicht nach seinem Berliner Jahr - im Juni 1924 - gestorben wäre. Meine<br />
Vermutung ist, wenn er länger gelebt hätte, wäre diese spielerische Seite von ihm rausgekommen, diese kindliche, fantasievolle, nicht so<br />
ängstliche Seite. Der Puppe wäre schließlich das gelungen, worum Kafka gekämpft hatte: sich zu emanzipieren, zu heiraten.
Mark Harman ist groß und hager wie Franz Kafka, und das ist ungefähr alles, was er mit dem Objekt seiner Obsession teilt. Er hat<br />
rotblonde Haare, nicht sehr viele, Sommersprossen, blaue Augen. Eigentlich kommt er aus Dublin, aber er lebt in den USA, seit er mit 24<br />
nach Yale ging, wo er seine Doktorarbeit über Kafka geschrieben hat. Er ist jetzt 49 Jahre alt und hat sich auch mit Joyce und Beckett<br />
beschäftigt. Kafka hat er in der ganzen Zeit nie weggelegt und ist tief in seine Welt eingetaucht, als er Das Schloß übersetzte, was mit<br />
Unterbrechungen fast vier Jahre gedauert hat (Kafka brauchte sieben Monate und hörte mitten im Satz mit dem Schreiben auf. Das<br />
Manuskript blieb unvollendet).<br />
Dass seine Faszination für Kafka auch etwas mit seiner eigenen Biografie zu tun haben könnte, hat Mark Harman lange nicht zugegeben:<br />
Ich sagte einfach, er ist ein großer Schriftsteller, ein großer Erzähler, und wer würde dem widersprechen. Als ein Freund ihn fragte,<br />
warum er seine Dissertation über den großen Dichter aus Prag schrieb (statt über den großen Dichter aus Dublin), murmelte ich was<br />
über akademische Gründe und wechselte das Thema.<br />
Erst 1998 schrieb er einen Aufsatz über sein eigenes Vater-Thema und seine eigene Obsession mit undurchschaubaren Autoritäten: Ich<br />
habe einen Großteil meiner Jugend damit verbracht, über meinen Vater zu spekulieren und über die Mechanismen seiner<br />
Kommandozentrale, genau wie der Landvermesser im Schloß ständig jede Geste der mysteriösen Schloß-Beamten interpretiert.<br />
An diesem Nachmittag war der Spielplatz leer.<br />
Während seiner jahrelangen Übersetzungsarbeit, basierend auf der kritischen Ausgabe, die die Stellen enthält, die später gestrichen<br />
wurden, fand Harman einen neuen Zugang zur Obsession des Landvermessers: Tief im Text versteckt, und in den Stellen, die Kafka<br />
gestrichen hat, gibt es ein Bewusstsein des Helden, dass seine Interpretationswut sinnlos ist und er sich im Kreise dreht. Harman las nun<br />
- verändert auch durch eigene Lebenserfahrung -, was er als Student nicht sehen konnte: Eine Abwendung von der Obsession. Gerade in<br />
den Stellen, die Kafka gestrichen hat, wird gegen Obsession ziemlich deutlich Stellung bezogen.<br />
Nachdem er Das Schloß geschrieben hatte, ging Kafka nach Berlin<br />
nachdem Harman es übersetzt hatte, bewarb er sich um ein Forschungsstipendium an der American Academy, weil er untersuchen<br />
wollte, wie Kafka sein Leben - via Tagebücher und Briefe - in literarische Texte verwandelt hat. Und in seine berühmten Metaphern, die<br />
so fremd und gleichzeitig vertraut erscheinen, dass auch Leute, die Kafka nie gelesen haben, sich heute in Situationen wiederfinden, für<br />
die es nur ein gutes Wort gibt: kafkaesk.<br />
Der Steglitzer Stadtpark liegt zwischen einem Hochhaus und Stadtvillen am südlichen Rand Berlins. Er ist klein und hügelig, mit einem<br />
runden See in seiner Mitte und einem texanischen Steakhouse. Es gibt einen Spielplatz mit Schaukeln und einer Hängebrücke, auf der<br />
die Kinder lernen, eine wacklige Balance zu halten. An einem Nachmittag im Dezember war der Spielplatz leer: Um kurz vor vier hatte<br />
sich ein bleiernes Grau um die Bäume gelegt, durch die Äste blinkten die Lichter der Stadt. Sich an einem Tag wie diesem einen
40jährigen Mann vorzustellen, der einem Kindergartenmädchen Briefe vorliest, die er im Namen ihrer verschwundenen Puppe<br />
geschrieben hat: nicht unbedingt poetisch.<br />
Mark Harman ist sich nicht einmal sicher, ob das der richtige Park ist. Als er von Kafkas Straße hierher gelaufen ist, brauchte er fast eine<br />
halbe Stunde. Schwer vorstellbar, dass ein Mann, der unheilbar an Tuberkulose erkrankt ist - eine Krankheit, die das Atmen am Ende fast<br />
unmöglich macht -, drei Wochen lang jeden Tag diese Strecke gelaufen sein soll.<br />
Um dieser Frage nachzugehen, hat sich Harman mit dem Leiter des Heimatmuseums von Steglitz verabredet, Wolfgang Holtz kennt die<br />
Geschichte bereits. Er dreht sich zu einem Stahlschrank, in dem Steglitzer Köpfe sortiert sind, öffnet die Schublade F-Ko und zieht einen<br />
dünnen Hefter hervor: KAFKA, Franz, Schriftsteller. 3.7.1883 in Prag - 3.6.1924 Kierling bei Wien. Kafka ist ganz schwach hier vertreten,<br />
sagt Holtz. Dora Diamant schreibt, dass Kafka das Mädchen im Steglitzer Stadtpark getroffen hat<br />
ich vermute, dass das ein bisschen zu weit ist, sagt Harman.<br />
Holtz: Er war auch im Botanischen Garten. Aber der Botanische Garten wurde nie als Park bezeichnet. Sind Sie die Strecke abgelaufen?<br />
Wissen Sie die Entfernung?<br />
Harman schüttelt den Kopf.<br />
Ich würde sagen, wenn er langsam läuft, sind es vielleicht 15, 20 Minuten eine Strecke, sagt Holtz. Allerdings ist die Albrechtstraße zum<br />
Stadtpark eine sehr attraktive Straße, viele Geschäfte, er hat viel sehen können. Ich glaube schon, dass Kafka - ich stell mir vor, er war im<br />
Stadtpark Steglitz.<br />
Das ist einer für ihn, er findet da seine Ruhe, das ist schon was für Kafkas Seele. Vielleicht schlendert er da 'ne halbe Stunde hin, spricht<br />
vielleicht mit Leuten. Hat er das gemacht - mit Leuten gesprochen?<br />
Dann zieht Holtz ein Blatt aus dem Ordner, eine Kopie aus dem Jahrbuch Steglitz von 1959. Ein kleines Mädchen im Matrosenkleid ist<br />
darauf zu sehen.<br />
Wer hat seine Puppe verloren, steht über dem Artikel und dann: Suchruf an Frauen der Jahrgänge um 1917, die in Steglitz großgeworden<br />
sind - Der Herbst 1923 brachte eine Reihe wunderbar sonniger Tage. Wer war das kleine, etwa sechsjährige Mädchen im Steglitzer Park,<br />
das so herzzerbrechend weinte, weil es seine Puppe verloren hatte? Ein großer, leidend aussehender Mann mit seiner Begleiterin<br />
versuchte das Mädchen zu trösten, indem er ihr sagte, die Puppe sei doch gar nicht verloren, sie sei nur verreist ...<br />
Niemand, sagt Herr Holtz, habe sich damals gemeldet, was natürlich kein gutes Zeichen ist. Und für Harman die Frage aufwirft, warum<br />
sich seit damals nur ein kleines Stadtteilblättchen (Auflage 10 000) für die Briefe interessiert hat, aber nie die Literaturwissenschaft.<br />
Am 8. August 1933 durchsuchte die Gestapo die Wohnung von Dora Diamant und konfiszierte dabei Texte von Kafka. Kurz darauf
versuchte sein Freund und Nachlassverwalter Max Brod, die Schriften mithilfe des tschechischen Kulturattachés zu retten. Erfolglos. Es<br />
sollte fast 65 Jahre dauern, bis es wieder einen systematischen Versuch gab, die Texte zu finden: von einer kalifornischen Journalistin und<br />
Literaturkritikerin, die über das Leben von Dora Diamant recherchierte. Ihre Anfragen beim Bundesarchiv und der Gauck-Behörde<br />
brachten kein neues Material - außer einer Bestätigung, dass die Texte tatsächlich von der Gestapo konfisziert worden waren.<br />
Warum wollte keiner was von Dora wissen?<br />
Die Frau, die mehr darüber gewusst hätte - zum Beispiel, ob das Mädchen die Briefe mit nach Hause genommen hatte -, wurde nie<br />
gefragt: Dora Diamant lebte bis in die fünfziger Jahre in London, und außer zwei Interviews in Literaturzeitschriften gab es von<br />
wissenschaftlicher Seite kein Interesse an ihr. Was kein Zufall ist, sagt Harman, sondern mit Kafka selbst zu tun hat, der als überzeitlicher<br />
Autor angesehen wurde, unter dem Einfluss von Max Brod, der ihn als religiösen Schreiber sah und seine Werke allegorisch deutete.<br />
Ein anderer Grund für das Desinteresse, glaubt Harman, liegt in der Art, wie die wissenschaftliche Literaturkritik im 20. Jahrhundert<br />
Texte betrachet hat: die Dominanz des New Criticism, der eine regelrechte Abscheu gegen alles Biografische hatte, gegen alles, was<br />
außerhalb des Textes stand. Ein Interview mit Dora Diamant in den fünfziger Jahren in London? Es hätte vielleicht nicht die Karriere<br />
ruiniert, aber es hätte einen im akademischen Literaturbetrieb eher verdächtig gemacht, sagt Harman, dem eine Menge Fragen an Dora<br />
Diamant einfallen würden.<br />
In Berlin machte im Winter 1923/24 die Inflation die Pension wertlos, die Kafka von der Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt bekam.<br />
Die Miete war hoch, und die Vermieterin hasste das unverheiratete jüdische Paar, Kafka schrieb über sie in der Geschichte Eine kleine<br />
Frau. Im Februar 1924 fand das Paar zwei Zimmer bei der Witwe des Dichters Karl Busse. Es war nicht das Berlin, von dem Kafka in Prag<br />
geträumt hatte, als er an Max Brod schrieb: Die Wannseevilla, Max! Und mir bitte ein stilles Dachzimmer (weit vom Musikzimmer), aus<br />
dem ich mich gar nicht fortrühren will<br />
man wird gar nicht merken, daß ich dort bin.<br />
Mark Harman kannte den Brief, aber erst als Fellow der American Academy erinnerte er sich wieder daran. Und bemerkte, dass er jetzt<br />
selbst so lebte, wie Kafka es beschrieben hatte: im ersten Stock einer Wannseevilla, mit Blick auf das Wasser.<br />
Hier erreichte ihn der Anruf einer älteren Dame, die im Lokalteil des Tagesspiegels einen Artikel über die neuen Stipendiaten gelesen<br />
hatte. Sie meldete sich mit dem Namen Geier, Geier Christine, und sagte, dass sie Kafka in Berlin gekannt hatte.<br />
Auch sie spielte damals noch mit Puppen, obwohl sie schon 15 war. Die Briefe hat auch sie nicht, ihre Verbindung zu Franz Kafka ist eine<br />
andere: Er trat als Untermieter in ihr Leben, als er im Frühjahr 1924 ins Haus ihrer Mutter zog, der Witwe des Dichters Karl Busse.<br />
Sie ist jetzt 92 Jahre alt, trägt Hosen und einen modischen Rundschnitt. Ihr Gesicht ist runzlig, aber ihre Augen sind klar, wie man es in<br />
Filmen sieht, wenn Schauspieler auf alt geschminkt werden, die in Wirklichkeit viel jünger sind.
Man stellte ihr Kafka als Dr. Keesburger vor<br />
Franz Kafka trat als Dr. Keesburger in ihr Leben, ein Pseudonym, das möglicherweise mit der Angst der Mutter vor Antisemitismus zu<br />
tun hatte, die konvertiert war und ihre jüdische Herkunft vor den Kindern geheim hielt. Ich weiß, ich kam aus der Schule, und meine<br />
Mutter stand vor dem Haus mit ihm. Er kam wohl von einem Spaziergang. Da kam meine Mutter und sagte: Ach, sieh mal, sagte sie, da<br />
kann ich dir gleich Herrn Dr. Keesburger vorstellen, das ist meine jüngste Tochter Christine, sagte sie, und er nahm seinen Hut ab und<br />
strahlte einen an, ganz lieb und nett, das weiß ich noch. So habe ich ihn kennen gelernt. Dass er Franz Kafka hieß - der Name war in<br />
Literatenkreisen zu der Zeit schon bekannt -, erfuhr sie erst nach seiner Abreise.<br />
Der Name Keesburger ist ein echt bayrischer Name. Da wär meine Mutter nicht drauf gekommen. Sie wäre vielleicht auf Schulze-Maier-<br />
Müller gekommen, darum nehme ich an, dass das seine Version war.<br />
Vielleicht war es ein Pseudonym nach Kafkas Geschmack, sagt Harman, statt sich zu wehren, hat er aktiv daran teilgenommen, ein Spiel<br />
mit alternativen Lebensläufen, wie er es beim Schreiben oft entwarf.<br />
Draußen vor dem Fenster, auf dem Teltower Damm, fahren die Pendler (unglückliche Versicherungsangestellte wie Kafka?) zurück in<br />
ihre Vororte. Drinnen serviert die Tochter von Kafkas Vermieterin Kaffee aus der weißen Tchibo-Thermoskanne, die ihr das Altersheim<br />
zur Verfügung stellt.<br />
Beinahe hätte Kafka sie angesteckt, dass kein falscher Eindruck entsteht, er war ja an sich tadellos gepflegt. Wir hatten eine Laube, da<br />
war mit der Zeit ein richtiges Laubdach gewachsen, und Kafka sah von seinem Balkon direkt darauf. Ich spielte dort immer mit meiner<br />
Freundin, wir hatten dort eine Bank, auf die mein Vater >Freundschaftsbänkchen für zwei junge Gänschen< geschrieben hatte. Und eines<br />
Tages - da war er schon sehr krank -, da hörten wir etwas, er konnte uns ja nicht sehen: wie er seinen Schleim da runtergespuckt hat. Das<br />
ging so ein paar Tage, und dann hab ich's Mutti erzählt, und die war entsetzt - Kafka hat natürlich keine Ahnung gehabt, dass da Kinder<br />
unten sind -, und dann hat Mutti uns verboten, in die Laube zu gehen. Aber da konnte er ja nichts für. Er hatte eine sehr nette Art: Ein<br />
netter Onkel, will ich mal sagen.<br />
Ein paar Wochen später sagte sie, sie glaube nicht mehr, dass die Briefe noch gefunden werden, ob Mr. Harman wohl enttäuscht sei?<br />
Meistens sucht man etwas und findet etwas anderes, sagt der Übersetzer, der genug über Obsessionen wissen müsste, um ihnen nicht zu<br />
verfallen.<br />
Obwohl. Vielleicht hilft ja dieser Artikel, sie zu finden. Vielleicht ist sie nur aus Berlin weggezogen.<br />
* Dora Diamants Erinnerung an ihre Berliner Zeit mit Franz Kafka und an die Geschichte mit der Puppe kann man nachlesen in einem Buch von Hans-Gerd Koch:<br />
Als Kafka mir entgegenkam.<br />
DIE ZEIT, 02/2001
"Kafka hatte schöne braune Augen" – Ein Anruf bei Alice Herz-Sommer<br />
von Oliver Das Gupta, 2007<br />
Seit 100 Jahren spielt Alice Herz-Sommer Klavier, heute feiert sie ihren 104. Geburtstag. Sie hat noch mehr zu bieten: eine Bekanntschaft<br />
mit Franz Kafka.<br />
SZ: Herzlichen Glückwunsch, Frau Herz-Sommer, zum 104. Geburtstag. Erwarten Sie viele Gratulanten?<br />
Klavierlehrerin bei Max Brod: Alice Herz-Sommer 1924. (© Foto: Droemer Verlag)<br />
Alice Herz-Sommer: Nur die engsten Familienmitglieder werden kommen und dafür gibt es einen guten Grund: So kann man sich viel<br />
besser unterhalten. Wir werden miteinander essen.<br />
SZ: Frau Herz-Sommer, können Sie sich an Ihren 4. Geburtstag im Jahre 1907 erinnern?<br />
Herz-Sommer: Dunkel, aber eines kann ich sagen: Geburtstage wurden nicht besonders begangen. Große Geschenke gab es nicht. Wir<br />
waren fünf Kinder und wurden sehr spartanisch erzogen. Unsere Mutter war eigentlich immer nur daran interessiert, dass wir lernen.<br />
SZ: Sie waren zwischen den Weltkriegen eine gefeierte Konzertpianistin. Saßen Sie auch schon 1907 am Klavier?<br />
Herz-Sommer: Ja. Aber ob ich der einzige Mensch bin, der seit 100 Jahren Klavier spielt, weiß ich nicht.<br />
SZ: Am häufigsten werden Sie aber nicht wegen Ihrer Virtuosität angesprochen, sondern auf Ihre Erlebnisse mit Franz Kafka.<br />
Herz-Sommer: Das stimmt. Vorige Woche waren aus Brasilien, Argentinien und Chile ein paar Studenten da. Die wollten wissen, wie<br />
Kafka so war.<br />
SZ: Wie kam es zu der Bekanntschaft mit ihm?
Herz-Sommer: Er war der beste Freund meines Schwagers und ging bei uns ein und aus. Kafka ging mit meiner Schwester und mir<br />
spazieren oder ins Freibad. Er ging sehr gerne schwimmen.<br />
SZ: Wie wirkte er auf Sie?<br />
Herz-Sommer: Nicht unbedingt melancholisch. Wenn er mit uns unterwegs war, wirkte er eigentlich wie ein Kind. Er hat uns<br />
Geschichten erzählt, ich kann Ihnen leider nicht mehr sagen, von was sie handelten. Er hatte schöne, große braune Augen. Und er war<br />
ein ausgesprochen nobler Charakter. Kafka sprach übrigens perfekt Tschechisch, was nicht selbstverständlich war für einen Juden in<br />
Prag, denn man sprach zumeist Deutsch.<br />
SZ: Neben Kafka haben Sie auch Größen der Prager und Wiener Bohème kennengelernt. An wen können Sie sich erinnern?<br />
Herz-Sommer: Meine Eltern waren zum Beispiel befreundet mit den Eltern von Gustav Mahler. Ich habe auch Franz Werfel<br />
kennengelernt, er war nicht sehr sympathisch. Max Brod dagegen war als Schriftsteller nicht so erstklassig, aber als Mensch<br />
hervorragend, so hilfsbereit. Er verfasste auch viele Kritiken meiner Konzerte.<br />
SZ: Brod veröffentlichte nach Kafkas Tod auch dessen Werke.<br />
Herz-Sommer: Brod hatte einen Sinn dafür, was für die Ewigkeit ist. Er war klein gewachsen mit einem Höcker, aber er war umgeben<br />
von den schönsten Frauen, weil er überwältigend charmant war. Er hat einen Roman geschrieben, ich weiß nicht, wie er heißt, da komme<br />
ich drin vor: als Klavierlehrerin.<br />
SZ: Brod entkam den Nazis, Sie hingegen wurden mit ihrem Mann und ihrem Sohn nach Theresienstadt, dem "Vorzeige"-KZ der Nazis,<br />
deportiert. Haben Sie dort ihr Wiegenfest begangen?<br />
Herz-Sommer: Schauen Sie, wir waren dort zwei Jahre, mein Mann hat nicht überlebt. Da hat man andere Sorgen, als den Geburtstag.<br />
Wir haben gehungert. Aber ich konnte dort auftreten, einige Hunderte mal sogar. Das gab mir eine ungeheure Genugtuung. Manchmal<br />
war ich sogar glücklich.<br />
SZ: Nach dem Krieg trafen Sie Max Brod wieder - in Israel.<br />
Herz-Sommer: Ja, wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wir sprachen viel über Kafka und haben gemeinsam musiziert.<br />
SZ: Frau Herz-Sommer Sie gehen noch heute ohne Stock und spielen jeden Tag Klavier. Wie bleibt man so fit?<br />
Herz-Sommer: Ich war immer sehr sportiv und diszipliniert. Ich sagte Ihnen ja: Wir hatten eine spartanische Jugend. Jeden Tag wuschen<br />
wir Kinder uns mit eiskaltem Wasser. Das hat ungeheuer abgehärtet.<br />
SZ: Was wünschen Sie sich zum Geburtstag?<br />
Herz-Sommer: Gar nichts, Ich bin wunschlos. Ich habe das Glück in mir. Ich nehme das Leben so wie es ist, ich suche immer das Gute.
Born to be wild<br />
Wilde Kinder hat es im Verlauf der Menschheitsgeschichte immer gegeben - und mit ihnen auch die Frage, inwieweit sie später noch in die menschliche<br />
Gesellschaft integrierbar seien. Die Kollegen von "Rokko´s Adventures" sind dem Mythos vom homo ferus auf die Spur gegangen. 06.04.2009<br />
Es war einmal ...<br />
Irgendwann im Jahre Schnee entwuchs der Affe dem Affen und wurde zum Menschen (was das heißen könnte, dazu im Laufe des<br />
Aufsatzes mehr). In dieser Übergangsphase hielt der Menschenaffe das Ding geschickt am Laufen: Das malaysische orang-utan bedeutet<br />
Waldmensch, was darauf schließen läßt, daß die dortigen (menschlichen) Stämme ihre Nachbarn für direkte Brüder und Schwestern<br />
hielten. Und nach wie vor wird in fachschaftlichen Kreisen diskutiert, ob denn der Homo sapiens, als er Afrika verließ, es auf dem Weg<br />
nach Amerika noch mit europäischen Neandertalern getrieben hat oder nicht.<br />
Davon unbeeindruckt steht fest: Den Nachwuchs zu konditionieren, zu hegen und zu pflegen ist Aufgabe der Platzhalter<br />
Erziehungsberechtigte/r, und in den meisten Fällen menschlicher Frischlinge handelt es sich dabei sogar um Menschen (?) selbst. Ab und<br />
zu aber wird die Aufgabe der Erziehung weitergeschoben und damit freigegeben für Revolverblätter, Stammtische und seinerzeitige<br />
Ausprägungen. Sie werden wilde Kinder/Menschen bzw. feral children genannt und wachsen mit minimalem oder gar keinem Kontakt zu<br />
Menschen auf. Sie werden entweder von ihren Erzeugern eingesperrt und von sozialen Kontakten weitgehend isoliert (Keller,<br />
Hundezwinger, Schweinestall) oder sie wachsen in der Wildnis - alleine oder unter Tieren - auf. Der Mensch ist also eine Variable<br />
zwischen Unbekannten. Aber auch bei Tieren läßt sich vieles ausgestalten: Angebliche Erbfeinde wie Katzen und Mäuse vertragen sich<br />
zum Beispiel blendend - vorausgesetzt, man läßt sie ohne übertriebenes Mißtrauen miteinander aufwachsen. Daß Hunde Katzen<br />
aufziehen, ist in freier Wildbahn durchaus keine Seltenheit. Es gibt also nach wie vor nichts von vornherein Normales, sondern bloß<br />
realitätsschaffende und zeitlich begrenzte Konventionen, die von den jeweiligen Gesellschaften festgesetzt werden, um Bequemlichkeit<br />
und Goschn-Halten zu garantieren.<br />
Wilde Kinder werden entweder von Eltern verloren, verstoßen, fliehen vor häuslicher Gewalt oder werden von Tieren geraubt, deren<br />
Verhaltensweisen ihnen nach und nach quasi ins Blut übergehen. Auch wenn sich die meisten Wissenschafter, Mediziner und<br />
Quacksalber auf die Sprachentwicklung konzentrieren, gibt es noch einige andere bemerkenswerte Aspekte im Bezug auf wilde Kinder.<br />
Das geht soweit, daß Kälte- und Hitzeempfinden rück- bzw. gar nicht entwickelt werden, Zweibeiner zu behaarten Vierbeinern werden,<br />
Sehschärfe in der Dunkelheit und Gehör generell optimiert und die Laute der Adoptiveltern imitiert werden. Bei wilden Kindern, die in<br />
menschliche Umgebung zurückgebracht wurden, herrscht meist so etwas wie sexuelle Gleichgültigkeit - selbst die Geilheit des<br />
Menschen muß konditioniert werden (Stichwort: YouPorn-Generation).<br />
Psychosozialer Kleinwuchs ist ein weiteres Ergebnis des Aufwachsens in Isolation. Der Mensch kann dort nicht gedeihen - selbst bei
ausreichender Ernährung wächst und entwickelt sich der Körper nicht wie bei uns verhätschelten Menschlein. Das hat die Ursache<br />
darin, daß die Produktion von nötigen Hormonen durch den hohen Streßlevel unterdrückt wird. Der Ernährungsplan wird ebenso von<br />
den Pflegeeltern übernommen, und Mangelernährung wirkt sich noch zusätzlich auf das eventuelle Aufblühen aus. Wilde Kinder essen<br />
zwar genug, um zu überleben, meist aber ist ihre Diät sehr einseitig. Kinder, die von Wölfen aufgezogen werden, essen zum Beispiel nur<br />
rohes Fleisch. Sie nach dieser Phase auch kulinarisch zu resozialisieren und an gekochtes Fleisch und Gemüse zu gewöhnen, ist eine<br />
langwierige und herausfordernde Aufgabe. Oft sind wilde Kinder nämlich auch nach dem Wiedereintritt in die menschliche Gesellschaft<br />
noch richtig scharf auf frisches Blut; Kamala etwa packte die Gelegenheit oft am Schopf, wenn ein Huhn in Reichweite nach Würmern<br />
pickte - fing, tötete und aß das Ding. Rohes Fleisch ist bei Wolfskindern also durchaus normal, während Kinder, die sich über längere<br />
Zeit alleine durchschlagen, meist auf größere Fleischgerichte verzichten und sich hauptsächlich von Beeren, Gräsern, Rinden, Würmern,<br />
Fröschen und anderen Kleintieren ernähren. John Ssebunya zum Beispiel, der mehr als zehn Jahre mit Affen im Dschungel gelebt hatte,<br />
trank angeblich in seiner gesamten wilden Zeit keinen Tropfen (Regen-)Wasser, sondern bekam die lebensnotwendige Flüssigkeit - wie<br />
seine Affenkollegen - aus Früchten. Zudem wurden Berichten zufolge mehr als einen halben Meter lange Würmer in seinen Exkrementen<br />
gefunden.<br />
Nichts ist besser als gar nichts<br />
Mangelnde Ernährung wirkt sich zusätzlich auf Hormone aus, die für den Haarwuchs verantwortlich sind und macht manche - wenn<br />
auch nicht alle wilden Kinder, wie Linné es fälschlicherweise festgesetzt hat - zu ganzkörperbehaarten Wesen. Hypertrichosis nennt sich<br />
dieses Phänomen, das auch bei an Anorexia nervosa Erkrankten auftritt.<br />
Kinder, die von Tieren aufgezogen werden, sind sich weiters der Bedürfnisse anderer nicht bewußt, sie identifizieren sich nicht als<br />
menschliche Individuen, sondern sehen ihnen begegnende Menschen eher als Gefahr an. Konzepte von Moral, Besitz und Eigentum sind<br />
ihnen genauso fremd wie Empathie. Die oben angeführten Eigenschaften sind natürlich Klischees von Bilderbuch-Wilden und treffen in
nur äußerst seltenen Fällen in ihrer Gesamtheit zu bzw. sind – wie es bei individuellen Geschöpfen eben der Fall ist - von Persönlichkeit<br />
zu Persönlichkeit in verschiedenen Kombinationen ausgeprägt. Verständlicherweise sind nicht alle Tierarten gleich gut geeignet, um sich<br />
eines Säuglings anzunehmen. Am menschenkinderfreundlichsten sind Wölfe, besonders in Indien werden auf diese Weise wilde Kinder<br />
gemacht. Der Grund dafür mag sein, daß die auf dem Feld arbeitenden Frauen ihre Kinder zur Seite legen, um ihrer Tätigkeit nachgehen<br />
zu können. Speziell Wolfsdamen mit ausgeprägtem Mutterinstinkt nähern sich daraufhin menschlichen Säuglingen, um sie auf ihre<br />
Weise - nach bestem Wissen und Gewissen - großzuziehen. Hercules Grey Ross, der um 1860 als Assistant Commissioner in Sultanpur<br />
tätig war, meinte, daß Wolfsmütter, die gerade einen Wurf verloren hatten, ihre noch vorhandenen Muttergefühle auf hilflose<br />
Menschenkinder übertragen würden - eine durchaus plausible Annahme. Aber auch in Großstädten Südamerikas und Osteuropas gibt<br />
es nach wie vor Kinder, die mit Hunden leben und sich von Abfällen ernähren (siehe "Simpsons", 16. Staffel, Folge 11 - "On a Clear Day I<br />
Can´t See My Sister" [dt.: "Die böse Hexe des Westens"]: Bart wird zum Hundejungen; "Malcolm Mittendrin", 6. Staffel, Folge 19 -<br />
"Motivational Seminar" [dt.: "Motivator Hal"]: Reese wird zum Hundejungen – beides in Nordamerika!).<br />
Am schwierigsten und auch entscheidendsten ist es jedoch, das Sprachverhalten aufzupäppeln, was uns zur Hypothese der "kritischen<br />
Periode" führt. Diese besagt im Wesentlichen, daß die Fähigkeit zum Spracherwerb auf die Jahre vor der Pubertät beschränkt ist. Danach<br />
verschwindet - als eine Folge von neurologischen Veränderungen des Gehirns - das Vermögen, das Sprachverhalten vollständig zu<br />
erwerben. Es können (wie etwa im Fall Genie von Temple City) nur einzelne Wörter und einfache grammatikalische Konstruktionen<br />
erlernt werden; es sei denn, man hat schon vor der Isolation die Sprachfähigkeit beherrscht - dann ist es möglich, sie wieder vollständig<br />
aufzutauen. Doch ansonsten waren wilde Kinder nur in der Lage, sich mit Hilfe einer Mischung aus Zeichensprache und Lauten zu<br />
artikulieren. Die Laute der Tiergattung jedoch, unter der sie gelebt hatten, beherrschten sie häufig erstaunlich gut, verlernten sie unter<br />
den Menschen jedoch zunehmend. Chris Schaner-Wolles, Sprachwissenschafterin und Professorin für klinische Linguistik an der<br />
Universität Wien zu den heutigen Erkenntnissen der Sprachwissenschaft und der damit verbundenen Erforschung der<br />
Gehirnaktivitäten: "Das Zeitfenster für den Erstspracherwerb ist nur bis etwa zum sechsten, siebten Lebensjahr geöffnet. Werden in<br />
dieser Zeit keine sprachrelevanten Vernetzungen im Gehirn (bei den meisten Menschen in der linken Gehirnhälfte) gebildet, so ist es<br />
dem Kind später unmöglich, eine Sprache zu erlernen. Speziell der Erwerb von Grammatik ist nicht mehr möglich. Lediglich Wörter und<br />
einzelne Satzmuster können - quasi nach dem Dressurprinzip (Belohnung bzw. Bestrafung) - gespeichert werden."<br />
The Forbidden Experiment<br />
Wilde Kinder hat es natürlich schon immer bzw. seit der gottgewollten Trennung von Mensch und Tier gegeben. Wir kennen die<br />
Geschichten von Romulus und Remus, Mowgli oder Tarzan, die die romantische Erzählform wählen und netten Stoff für Disney-Filme<br />
hergeben. Die meisten dieser Phänomene waren nicht geplant und intendiert - teilweise aber doch und mitunter sogar unter<br />
wissenschaftlichen Vorzeichen. So hat zum Beispiel der ägyptische Pharao Psammetichos I. im 7. Jahrhundert vor unserer Zeit zumindest
laut dem griechischen Historiker Herodot einer Familie zwei Kinder weggenommen, um sie bei einem stummen Hirten und dessen<br />
Ziegen aufwachsen zu lassen. So wollte er dem Ursprung der Sprache auf die Spur kommen. Nach zwei Jahren riefen die Kinder<br />
angeblich "bekos, bekos!", was im Phrygischen Brot bedeutet, woraufhin Psammetichos I. phrygisch als Ursprache akzeptierte. Der für<br />
seine Zeit aufgeklärte Staufer und Kaiser Friedrich II. und der schottische König Jakob IV. hatten - unabhängig voneinander und mit<br />
Jahrhunderten Zeitdifferenz - angeordnet, mit einzeln herausgepickten Neugeborenen nicht zu sprechen und sie nur mit den<br />
lebensnotwendigen Materialien zu versorgen. Sie starben jedoch, bevor sie nach bekos verlangen konnten. Ab dem 14. Jahrhundert<br />
nehmen (angebliche) Tatsachenschilderungen über hessische Wolfsjungen, russische Bärenkinder, irische Schafskinder und andere<br />
Mischkulturen zu, doch die ernsthafte (wenn auch oft grausame und rücksichtslose) Beschäftigung mit wilden Kindern begann erst mit<br />
der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Zuvor wurden diese Erscheinungen meist bloß im Sinne von Anekdoten oder der Faszination am<br />
Bizarren verwendet oder dienten am königlichen Hofe als Unterhaltungsobjekte (was übrigens auch später in Freakshows in<br />
abgewandelter und aufgemotzter Form noch bis ins 20. Jahrhundert geschah und in seinen Ausprägungen bis heute stattfindet). Der<br />
französische Philosoph Etienne Bonnot de Condillac veröffentlichte 1746 den "Essai sur l´origine des conaissances humaines", worin er<br />
die These aufstellt, der Mensch komme als unbeschriebenes Blatt zur Welt und erhalte erst durch sinnliche Erfahrung sein Profil - der<br />
Mensch sei also kein Ergebnis der Natur, sondern der Einflüsse seiner Umwelt. Der Universalgelehrte Georges-Louis Buffon brachte drei<br />
Jahre später "Histoire naturelle générale et particulière" heraus, worin er vom Urzustand der Menschheit erzählt und als erste<br />
maßgebliche Stimme den Topos des Edlen Wilden abfeiert. 1758 schließlich postulierte der schwedische Naturwissenschafter Carl von<br />
Linné in der zehnten Auflage seines "Systema Naturae" die sechs Unterarten des Homo sapiens. Zu unterscheiden wäre demnach<br />
zwischen dem Homo americanus, dem Homo europaeus, dem Homo asiaticus, dem Homo afer, dem Homo monstrosus (zu dem alles<br />
zwischen Pygmäen und Primaten, Zyklopen, Lotophagen und geschwänzten Menschen gehört) und dem Homo ferus. Letzterer ist laut<br />
Linné trapus, mutus und hirsutus, also vierbeinig, stumm und behaart - eine in den allermeisten Fällen übertriebene, aber damals gängige<br />
Vorstellung vom wilden Menschen. Johann Christian Daniel Schreber, ein Schüler Linnés, bewertete den Homo ferus nicht als Unterart,<br />
sondern als Ausartung des Homo sapiens. Zudem war der wilde Mensch für Schreber kein Mensch im ursprünglichen Zustand, sondern<br />
ein bedauernswertes Individuum. Der Theologe und Philosoph Johann Friedrich Immanuel Tafel veröffentlichte 1848 seine<br />
Fundamentalphilosophie in genetischer Entwicklung mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte jedes einzelnen Problems, deren Fazit<br />
sich wie folgt liest: "Der Mensch wird also nur unter Menschen ein Mensch, er muß zum Menschen erzogen werden, ohne diese<br />
Erziehung bleibt er ein Tier." August Rauber, ein Anatomieprofessor, war ein weiterer wichtiger Impulsgeber in Sachen Homo ferus. Für<br />
ihn war der wilde Mensch schlicht der Mensch ohne Kultur - im Gegensatz zum Menschen in der Gesellschaft: "Der Einzelne bedarf<br />
nicht bloß zu seiner Menschwerdung der Wirkungen des staatlichen Verbandes, sondern die menschliche Vernunft selbst, so wie die<br />
Sprache des Menschen, sind langsam gereifte Erzeugnisse des Verbandslebens." Worunter die Wilden leiden, sei keine angeborene
Geistesschwäche, sondern dementia ex separatione, durch Absonderung verursachter Schwachsinn. Wären sie bereits geistig behindert<br />
geboren, so hätten sie eine derart strapaziöse Isolierung, wie sie wilde Kinder durchmachen, nicht überlebt. Rauber war außerdem der<br />
Meinung, daß der isolierte Mensch durchaus die Urform des Menschen sei. Wenn Charles Darwin hingegen von den Wilden spricht, so<br />
meint er keine von Tieren aufgezogenen Kinder, sondern die primitven Stämme Afrikas, Amerikas und Asiens, die seiner Theorie<br />
zufolge auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe des Menschen stehen als die Europäer. Susanne Winter und andere ehrliche Kämpfer<br />
der Freiheitlichen Partei Österreichs sind dort irgendwo hängen geblieben und werfen noch immer mit gedanklichen Exkrementen aus<br />
ihren eigenen Köpfen um sich. Wir erinnern uns auch: In islamischen Ländern werden von den Männern keine Frauen, sondern Tiere<br />
gefickt, woraufhin Susanne Winter die großartige Idee hatte, man sollte, um vor Vergewaltigungen prophylaktisch zu schützen,<br />
Schafherden im Grazer Stadtpark rasenmähen lassen. Frau Winter, Sie sind ein Genie! Und vielleicht wird dann endlich das erste<br />
Schafskind mit Migrationshintergrund geboren! Der Sozialpsychologe Lucien Malson schrieb im 1964 erschienenen "Die wilden Kinder":<br />
"Die Wahrheit, die letztlich durch all dies verkündet wird, lautet, daß der Mensch als Mensch vor seiner Erziehung nichts weiter ist als<br />
eine Eventualität, und sogar noch weniger: nur eine Hoffnung."<br />
Affe stampft Kafka<br />
Der Psychologe Winthrop Niles Kellog wagte 1931 ein Experiment: Er schätzte den Unterschied zwischen Menschen und Affen als sehr<br />
gering ein und führte ihn großteils auf die Erziehung zurück. Er stellte sich die Frage, wie sich wohl ein Affenkind verhalten würde, das<br />
wie ein Mensch - samt Angekleidet- und Gewaschenwerden, eigenem Kinderbettchen und Schmusen - erzogen würde. So zog am 26.<br />
Juni desselben Jahres das siebeneinhalb Monate alte Schimpansenweibchen Gua zur Familie Kellogg, in der der damals gerade zehn<br />
Monate alte Sohn Donald aufwuchs. Gua und Donald sollten nun wie Geschwister ohne merkliche Unterschiede aufgezogen werden -<br />
beide wurden auf den Topf gesetzt und mit festem Schuhwerk zum Zweibeiner erhöht. Es stellte sich heraus, daß Gua in vielerlei<br />
Hinsicht schnellere Fortschritte als ihr Halbbruder machte. Papa Kellog machte viele Versuche mit seinen beiden Zöglingen und merkte,<br />
daß Gua geltende Funktionen besser begreifen konnte als Donald, während dieser großteils Gua bloß nachahmte - das heißt, nicht das<br />
Tier wurde zum Menschen, sondern der Mensch zum Tier. Donald lernte mit 14 Monaten von Gua Bell-, Grunz- und Schreilaute, die<br />
menschliche Sprachentwicklung setzte allmählich aus. Mit 19 Monaten konnte Donald nur noch sechs Wörter aussprechen -<br />
normalerweise haben Kinder in diesem Alter einen aktiven Wortschatz von 50 Wörtern. Nach neun Monaten wurde das Experiment<br />
schließlich und aus plausiblen Gründen abgebrochen, Donald konnte die Menschensprache natürlich noch erlernen und wurde Jahre<br />
später zum Doktor der Medizin an der Harvard Medical School. Über das weitere Leben von Gua konnte ich keine Informationen<br />
einholen.<br />
Ein weiterer interessanter Akt zur Sprengung tradierter Abgrenzungen gelang der Psychologin Francine Penny Patterson, die 1972 vom<br />
Tierpark San Francisco das damals einjährige Gorillamädchen Koko bekam und diesem sogleich eine eigens für sie erfundene
Zeichensprache beibrachte. Nach 30 Jahren verfügte Koko über etwa 1000 Handzeichen und verstand 2000 Wörter, konnte viele ihrer<br />
Wünsche äußern, Witze machen, schimpfen und sogar bewußt lügen. Sie sprach hauptsächlich über Essen und ihre Gefühle. Hier ein<br />
Auszug aus einem Dialog zwischen Patterson und Koko, der in Zeichensprache gehalten und anschließend von Dr. Patterson übersetzt<br />
wurde. Koko und ihr Frauchen betrachten ein Gorillaskelett:<br />
Patterson: Lebt der Gorilla oder ist er tot?<br />
Koko: Tot, Wiedersehen.<br />
Patterson: Wie fühlt sich ein Gorilla, wenn er stirbt: glücklich, traurig, ängstlich?<br />
Koko: Schlafen.<br />
Patterson: Wohin gehen Gorillas, wenn sie sterben?<br />
Koko: Gemütliches Loch, Wiedersehen.<br />
Das ist in der Tat ein Meilenstein und ermöglicht in einzelnen Fällen halbwegs realistische Gedanken an eine gemeinsame Sprache von<br />
Mensch und Tier, die ungeahnte Eindrücke liefern könnte. Allerdings ist natürlich auch dieser Dialog nur schwer zu überprüfen -<br />
bekanntermaßen bekam einzig der Pferdeflüsterer den Gültigkeitsstempel von der Wissenschaftsfabrik Hollywood. Hip, hip, hurra!<br />
Die Wahrheit zumutbar?<br />
Wie wir sehen, ist es sehr schwierig, den Wahrheitsgehalt einer jeden Schilderung ordnungsgemäß zu überprüfen. Erstens, weil die<br />
Forscher von ihren Projekten absolut voreingenommen sind und die Forschungsergebnisse immer von Eindruck und Ausgestaltung<br />
eines oder nur weniger Beteiligter formuliert werden. Zweitens sind die Fälle schon meist zu alt, um sie nachzuprüfen. Drittens sind die<br />
Quellen nur sekundärer oder tertiärer Natur - Informationen aus erster Hand sind nur schwer zu erhalten, und selbst diese sind immer<br />
stark eingefärbt mit den Absichten und Hintergründen der jeweiligen Person. Und selbst Interviews mit wilden Menschen zu führen ist<br />
ungefähr so einfach wie eine Photo-Lovestory mit Thomas Pynchon anzufertigen. Zudem bewegt sich dieses ganze Gebiet auf nur sehr<br />
wackeligen Beinen; es gibt verschiedene Annahmen und verschiedene Thesen, von denen nur wenige bewiesen und viele umstritten<br />
sind. Allerdings gibt es doch einige Berichte und Ergebnisse, die mindestens genauso plausibel klingen wie Frankensteins<br />
Relativitätstheorie und über spinnerte Spekulationen hinausgehen. Doch ich denke auch, daß viele wilden Kinder der bloßen Einfachheit<br />
halber als solche bezeichnet wurden, obschon sie mitunter Autisten oder geistig Verwirrte waren. Es mag dies der Grund für das<br />
Verstoßen oder Einsperren des Kindes sein und nicht unbedingt dessen Folge. Außerdem nehme ich einfach einmal an, daß die meisten<br />
wilden Menschen keine Berühmtheit erlangt haben, sondern vor ihrem Durchbruch bereits in der Wildnis verendet sind.<br />
http://www.evolver.at/stories/homo_ferus_Wilde_Kinder_15_2009/ (Texte_Rokko´s Adventures im EVOLVER #15)
Unvollendetes<br />
Der Kampf der Hände<br />
Meine zwei Hände begannen einen Kampf. Das Buch in dem ich gelesen hatte, klappten sie zu und schoben es bei Seite, damit es nicht<br />
störe. Mir salutierten sie und ernannten mich zum Schiedsrichter. Und schon hatten sie die Finger ineinander verschränkt und schon<br />
jagten sie am Tischrand hin, bald nach rechts bald nach links je nach dem Überdruck der einen oder der andern. Ich liess keinen Blick<br />
von ihnen. Sind es meine Hände, muss ich ein gerechter Richter sein, sonst halse ich mir selbst die Leiden eines falschen Schiedsspruchs<br />
auf. Aber mein Amt ist nicht leicht, im Dunkel zwischen den Handtellern werden verschiedene Kniffe angewendet, die ich nicht<br />
unbeachtet lassen darf, ich drücke deshalb das Kinn an den Tisch und nun entgeht mir nichts. Mein Leben lang habe ich die Rechte, ohne<br />
es gegen die Linke böse zu meinen, bevorzugt. Hätte doch die Linke einmal etwas gesagt, ich hätte, nachgiebig und rechtlich wie ich bin,<br />
gleich den Missbrauch eingestellt. Aber sie muckste nicht, hing an mir hinunter und während etwa die Rechte auf der Gasse meinen Hut<br />
schwang, tastete die Linke ängstlich meinen Schenkel ab. Das war eine schlechte Vorbereitung zum Kampf, der jetzt vor sich geht. Wie<br />
willst Du auf die Dauer, linkes Handgelenk, gegen diese gewaltige Rechte Dich stemmen? Wie Deine mädchenhaften Finger in der<br />
Klemme der fünf andern behaupten? Das scheint mir kein Kampf mehr, sondern natürliches Ende der Linken. Schon ist sie in die<br />
äusserste linke Ecke des Tisches gedrängt, und an ihr regelmässig auf und nieder schwingend wie ein Maschinenkolben die Rechte.<br />
Bekäme ich angesichts dieser Not nicht den erlösenden Gedanken, dass es meine eigenen Hände sind, die hier im Kampf stehn und dass<br />
ich sie mit einem leichten Ruck von einander wegziehn kann und damit Kampf und Not beenden – bekäme ich diesen Gedanken nicht,<br />
die Linke wäre aus dem Gelenk gebrochen vom Tisch geschleudert und dann vielleicht die Rechte in der Zügellosigkeit des Siegers wie<br />
der fünfköpfige Höllenhund mir selbst ins aufmerksame Gesicht gefahren. Statt dessen liegen die zwei jetzt übereinander, die Rechte<br />
streichelt den Rücken der Linken, und ich unehrlicher Schiedsrichter nicke dazu.<br />
Franz Kafka<br />
Das offenbar abgeschlossene, jedoch titellose und von Kafka nicht veröffentliche Prosastück findet sich im sogenannten ›Oktavheft D‹. Es entstand im<br />
April 1917 sehr wahrscheinlich in dem von seiner Schwester Ottla angemieteten Häuschen in der Alchimistengasse auf dem Prager Hradschin.<br />
Der letzte Satz lautete im Manuskript zunächst: Statt dessen liegen die zwei jetzt übereinander, die Rechte streichelt den Rücken der Linken,<br />
dann wird das Buch wieder vorgenommen und einträchtig gehalten.
Literatur und<br />
Dorothee Kimmich: Öde Landschaften und die Nomaden in der<br />
eigenen Sprache, Bemerkungen zu Franz Kafka, Feridun Zaimoğlu<br />
und der Weltliteratur als »Littérature mineure« (vorliegend)<br />
Ria Endres: Milena antwortet, Ein Brief, Rowohlt 1982. (vorliegend)<br />
George Tabori: Unruhige Träume nach Franz Kafka, Burgtheater im<br />
Kasino am Schwarzenbergplatz 1991/92. (vorliegend)<br />
Lars Klein: Von der Grausamkeit des Über-Ichs, Freud, Kakfa und<br />
die Zeitmäßigkeit des Ödipuskomplexes, 2001 (vorliegend)<br />
„Herrschaft und Sexualität in Franz Kafkas Romanen ‚Der Proceß’<br />
und ‚Das Schloß’“ von Karin Leich, Diss. <strong>Marburg</strong> 2003 (vorliegend)<br />
„Hier muss ich mich festhalten...“, Die Tagebücher von Franz Kafka,<br />
Ein literarisches Laboratorium 1909-1923 von Andrea Rother, Diss.<br />
Berlin 2007 (vorliegend)<br />
Peter-André Alt: Kafka und der Film. Über kinematographisches<br />
Erzählen. C. H. Beck Verlag, München 2009 (Vorwort vorliegend)<br />
Saul Friedländer: Franz Kafka, C.H. Beck 2012.<br />
Peter-André Alt: Franz Kafka, Der ewige Sohn, C.H. Beck 2005.<br />
Max Brod: Franz Kafka, Eine Biographie, 1963 (zuerst 1937).<br />
Links:<br />
http://www.kafka.org/index.php?articles<br />
zum Lesen und Hören: http://www.dradio.de/aktuell/810660/<br />
historisch-kritische Franz Kafka-Ausgabe:<br />
http://www.textkritik.de/fka/uebersicht/uebersicht.htm<br />
Briefe und Tagebücher:<br />
http://homepage.univie.ac.at/werner.haas/index.html<br />
zahlreiche Essays über eine literarische Texte Kafkas:<br />
http://www.kafka.org/<br />
Martin Kippenberger The Happy End of Kafka's Amerika:<br />
http://www.renaissancesociety.org/site/Exhibitions/Essay.Martin-<br />
Kippenberger-The-Happy-End-of-Kafka-s-Amerika.30.html<br />
Kafkas Sätze – Von monströser Vieldeutigkeit verfolgt (Autoren über<br />
Kafka): http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/faz-net-spezialkafkas-saetze-von-monstroeser-vieldeutigkeit-verfolgt-1671382.html<br />
Vom Baum des Lebens essen - Franz Kafka und sein Judentum von Dr.<br />
Carolin Hannah Reese: http://www.talmud.de/artikel/kafka.htm<br />
erstellt von Eva Bormann, Junges <strong>Theater</strong>, September 2012