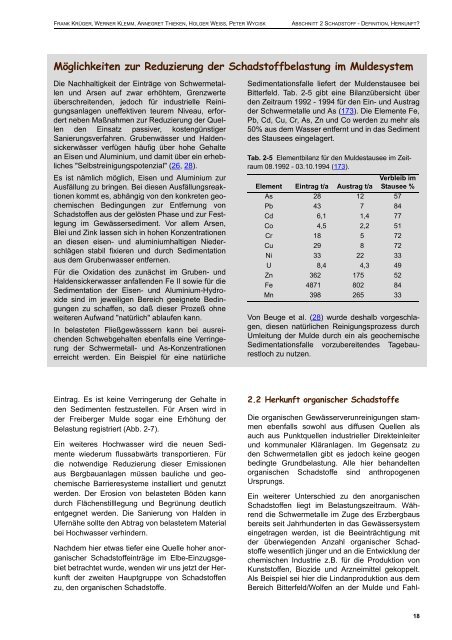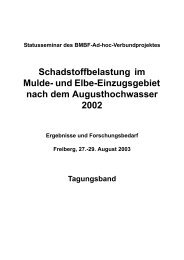Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002 - UFZ
Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002 - UFZ
Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002 - UFZ
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
FRANK KRÜGER, WERNER KLEMM, ANNEGRET THIEKEN, HOLGER WEISS, PETER WYCISK ABSCHNITT 2SCHADSTOFF - DEFINITION, HERKUNFT?<br />
Möglichkeiten zur Reduzierung der <strong>Schadstoffbelastung</strong> im Muldesystem<br />
Die Nachhaltigkeit der Einträge von Schwermetallen<br />
und Arsen auf zwar erhöhtem, Grenzwerte<br />
überschreitenden, jedoch für industrielle Reinigungsanlagen<br />
uneffektiven teurem Niveau, erfordert<br />
neben Maßnahmen zur Reduzierung der Quellen<br />
den Einsatz passiver, kostengünstiger<br />
Sanierungsverfahren. Grubenwässer und Haldensickerwässer<br />
verfügen häufig über hohe Gehalte<br />
an Eisen und Aluminium, und damit über ein erhebliches<br />
"Selbstreinigungspotenzial" (26, 28).<br />
Es ist nämlich möglich, Eisen und Aluminium zur<br />
Ausfällung zu bringen. Bei diesen Ausfällungsreaktionen<br />
kommt es, abhängig von den konkreten geochemischen<br />
Bedingungen zur Entfernung von<br />
Schadstoffen aus der gelösten Phase und zur Festlegung<br />
im Gewässersediment. Vor allem Arsen,<br />
Blei und Zink lassen sich in hohen Konzentrationen<br />
an diesen eisen- und aluminiumhaltigen Niederschlägen<br />
stabil fixieren und durch Sedimentation<br />
aus <strong>dem</strong> Grubenwasser entfernen.<br />
Für die Oxidation des zunächst im Gruben- und<br />
Haldensickerwasser anfallenden Fe II sowie für die<br />
Sedimentation der Eisen- und Aluminium-Hydroxide<br />
sind im jeweiligen Bereich geeignete Bedingungen<br />
zu schaffen, so daß dieser Prozeß ohne<br />
weiteren Aufwand "natürlich" ablaufen kann.<br />
In belasteten Fließgewässsern kann bei ausreichenden<br />
Schwebgehalten ebenfalls eine Verringerung<br />
der Schwermetall- und As-Konzentrationen<br />
erreicht werden. Ein Beispiel für eine natürliche<br />
Eintrag. Es ist keine Verringerung der Gehalte in<br />
den Sedimenten festzustellen. Für Arsen wird in<br />
der Freiberger Mulde sogar eine Erhöhung der<br />
Belastung registriert (Abb. 2-7).<br />
Ein weiteres <strong>Hochwasser</strong> wird die neuen Sedimente<br />
wiederum flussabwärts transportieren. Für<br />
die notwendige Reduzierung dieser Emissionen<br />
aus Bergbauanlagen müssen bauliche und geochemische<br />
Barrieresysteme installiert und genutzt<br />
werden. Der Erosion von belasteten Böden kann<br />
durch Flächenstilllegung und Begrünung deutlich<br />
entgegnet werden. Die Sanierung von Halden in<br />
Ufernähe sollte den Abtrag von belastetem Material<br />
bei <strong>Hochwasser</strong> verhindern.<br />
Nach<strong>dem</strong> hier etwas tiefer eine Quelle hoher anorganischer<br />
Schadstoffeinträge im <strong>Elbe</strong>-Einzugsgebiet<br />
betrachtet wurde, wenden wir uns jetzt der Herkunft<br />
der zweiten Hauptgruppe von Schadstoffen<br />
zu, den organischen Schadstoffe.<br />
Sedimentationsfalle liefert der Muldenstausee bei<br />
Bitterfeld. Tab. 2-5 gibt eine Bilanzübersicht über<br />
den Zeitraum 1992 - 1994 für den Ein- und Austrag<br />
der Schwermetalle und As (173). Die Elemente Fe,<br />
Pb, Cd, Cu, Cr, As, Zn und Co werden zu mehr als<br />
50% aus <strong>dem</strong> Wasser entfernt und in das Sediment<br />
des Stausees eingelagert.<br />
Tab. 2-5 Elementbilanz für den Muldestausee im Zeitraum<br />
08.1992 - 03.10.1994 (173).<br />
Verbleib im<br />
Element Eintrag t/a Austrag t/a Stausee %<br />
As 28 12 57<br />
Pb 43 7 84<br />
Cd 6,1 1,4 77<br />
Co 4,5 2,2 51<br />
Cr 18 5 72<br />
Cu 29 8 72<br />
Ni 33 22 33<br />
U 8,4 4,3 49<br />
Zn 362 175 52<br />
Fe 4871 802 84<br />
Mn 398 265 33<br />
Von Beuge et al. (28) wurde deshalb vorgeschlagen,<br />
diesen natürlichen Reinigungsprozess durch<br />
Umleitung der Mulde durch ein als geochemische<br />
Sedimentationsfalle vorzubereitendes Tagebaurestloch<br />
zu nutzen.<br />
2.2 Herkunft organischer Schadstoffe<br />
Die organischen Gewässerverunreinigungen stammen<br />
ebenfalls sowohl aus diffusen Quellen als<br />
auch aus Punktquellen industrieller Direkteinleiter<br />
und kommunaler Kläranlagen. Im Gegensatz zu<br />
den Schwermetallen gibt es jedoch keine geogen<br />
bedingte Grundbelastung. Alle hier behandelten<br />
organischen Schadstoffe sind anthropogenen<br />
Ursprungs.<br />
Ein weiterer Unterschied zu den anorganischen<br />
Schadstoffen liegt im Belastungszeitraum. Während<br />
die Schwermetalle im Zuge des Erzbergbaus<br />
bereits seit Jahrhunderten in das Gewässersystem<br />
eingetragen werden, ist die Beeinträchtigung mit<br />
der überwiegenden Anzahl organischer Schadstoffe<br />
wesentlich jünger und an die Entwicklung der<br />
chemischen Industrie z.B. für die Produktion von<br />
Kunststoffen, Biozide und Arzneimittel gekoppelt.<br />
Als Beispiel sei hier die Lindanproduktion aus <strong>dem</strong><br />
Bereich Bitterfeld/Wolfen an der Mulde und Fahl-<br />
18