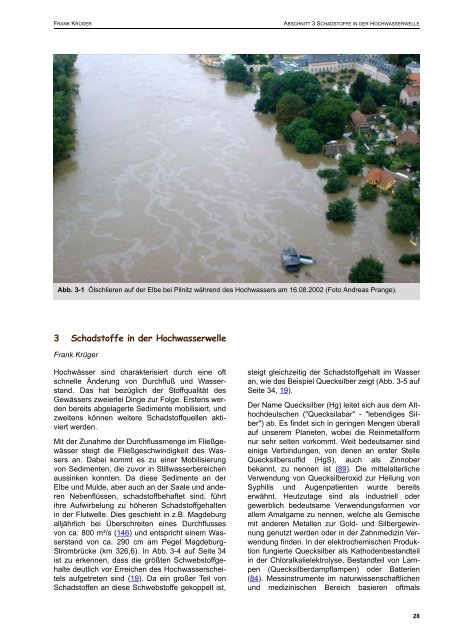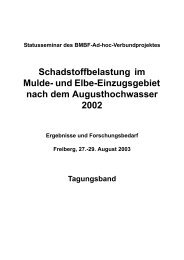Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002 - UFZ
Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002 - UFZ
Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002 - UFZ
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
FRANK KRÜGER ABSCHNITT 3SCHADSTOFFE IN DER HOCHWASSERWELLE<br />
Abb. 3-1 Ölschlieren auf der <strong>Elbe</strong> bei Pilnitz während des <strong>Hochwasser</strong>s am 16.08.<strong>2002</strong> (Foto Andreas Prange).<br />
3 Schadstoffe in der <strong>Hochwasser</strong>welle<br />
Frank Krüger<br />
Hochwässer sind charakterisiert durch eine oft<br />
schnelle Änderung von Durchfluß und Wasserstand.<br />
Das hat bezüglich der Stoffqualität des<br />
Gewässers zweierlei Dinge zur Folge. Erstens werden<br />
bereits abgelagerte Sedimente mobilisiert, und<br />
zweitens können weitere Schadstoffquellen aktiviert<br />
werden.<br />
Mit der Zunahme der Durchflussmenge im Fließgewässer<br />
steigt die Fließgeschwindigkeit des Wassers<br />
an. Dabei kommt es zu einer Mobilisierung<br />
von Sedimenten, die zuvor in Stillwasserbereichen<br />
aussinken konnten. Da diese Sedimente an der<br />
<strong>Elbe</strong> und Mulde, aber auch an der Saale und anderen<br />
Nebenflüssen, schadstoffbehaftet sind, führt<br />
ihre Aufwirbelung zu höheren Schadstoffgehalten<br />
in der Flutwelle. Dies geschieht in z.B. Magdeburg<br />
alljährlich bei Überschreiten eines Durchflusses<br />
von ca. 800 m³/s (146) und entspricht einem Wasserstand<br />
von ca. 290 cm am Pegel Magdeburg-<br />
Strombrücke (km 326,6). In Abb. 3-4 auf Seite 34<br />
ist zu erkennen, dass die größten Schwebstoffgehalte<br />
deutlich vor Erreichen des <strong>Hochwasser</strong>scheitels<br />
aufgetreten sind (19). Da ein großer Teil von<br />
Schadstoffen an diese Schwebstoffe gekoppelt ist,<br />
steigt gleichzeitig der Schadstoffgehalt im Wasser<br />
an, wie das Beispiel Quecksilber zeigt (Abb. 3-5 auf<br />
Seite 34, 19).<br />
Der Name Quecksilber (Hg) leitet sich aus <strong>dem</strong> Althochdeutschen<br />
("Quecksilabar" - "lebendiges Silber")<br />
ab. Es findet sich in geringen Mengen überall<br />
auf unserem Planeten, wobei die Reinmetallform<br />
nur sehr selten vorkommt. Weit bedeutsamer sind<br />
einige Verbindungen, von denen an erster Stelle<br />
Quecksilbersulfid (HgS), auch als Zinnober<br />
bekannt, zu nennen ist (89). Die mittelalterliche<br />
Verwendung von Quecksilberoxid zur Heilung von<br />
Syphilis und Augenpatienten wurde bereits<br />
erwähnt. Heutzutage sind als industriell oder<br />
gewerblich bedeutsame Verwendungsformen vor<br />
allem Amalgame zu nennen, welche als Gemische<br />
mit anderen Metallen zur Gold- und Silbergewinnung<br />
genutzt werden oder in der Zahnmedizin Verwendung<br />
finden. In der elektrochemischen Produktion<br />
fungierte Quecksilber als Kathodenbestandteil<br />
in der Chloralkalielektrolyse, Bestandteil von Lampen<br />
(Quecksilberdampflampen) oder Batterien<br />
(84). Messinstrumente im naturwissenschaftlichen<br />
und medizinischen Bereich basieren oftmals<br />
28