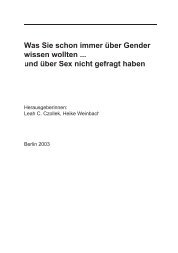Re-Präsentationen - PUB - Universität Bielefeld
Re-Präsentationen - PUB - Universität Bielefeld
Re-Präsentationen - PUB - Universität Bielefeld
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Politik der <strong>Re</strong>präsentation<br />
präsentationspolitiken stabilisiert werden. Scheinbar paradoxerweise<br />
macht eine Politik der <strong>Re</strong>präsentation nur dann Sinn, wenn sowohl<br />
die Subjekte als auch der Prozess der <strong>Re</strong>präsentation permanent einer<br />
Problematisierung zugeführt werden. Die Ziele anti-hegemonialer<br />
Politiken riskieren deswegen ins Leere zu laufen, wenn die konstitutive<br />
Macht der eigenen <strong>Re</strong>präsentation unbeachtet bleibt. Eine Lösung<br />
des Problems der <strong>Re</strong>präsentation darin zu suchen, die Kategorie „Migrantin“<br />
aus rein „strategischen“ Motiven heraus zu nutzen, löst das<br />
grundlegende Problem der <strong>Re</strong>präsentation allein deshalb nicht, da die<br />
Strategie selbst Effekte hervorbringt, die die intendierten Ziele jederzeit<br />
subvertieren können (vgl. Butler 1990, 4). Spivak bemerkt in diesem<br />
Zusammenhang, dass es nicht möglich ist, nicht essentialistisch<br />
zu sein, weswegen sie für einen „strategischen Essentialismus“ plädiert<br />
(vgl. Spivak 1996, 7, 205; vgl. auch Castro Varela 2003). Dieser ermöglicht<br />
es über und für eine minorisierte Gruppe zu sprechen, diese zu<br />
repräsentieren, obschon die Fallen dieser <strong>Re</strong>präsentation offenkundig<br />
sind. Doch da ansonsten die Stimmen dieser nicht vernommen werden,<br />
bleibt die Verantwortung, diese zu repräsentieren. Man kann diesem<br />
Dilemma nicht einfach ausweichen, indem man eine <strong>Re</strong>präsentation<br />
verweigert. Eine der größten Herausforderungen liegt deshalb in der<br />
effektvollen Problematisierung der Kategorien selbst, die unhinterfragt<br />
als Instrumente der Kritik fungieren. Eine wichtige Konsequenz postkolonialer<br />
Intervention ist insoweit, dass Kategorien wie etwa „Migrantin“<br />
nicht als stabile, sondern irritierende Signifikanten gelten.<br />
Von der Unmöglichkeit adäquater <strong>Re</strong>präsentation<br />
Eins der Ziele herrschaftskritischer Theoriebildung ist es, eine Sprache<br />
zu entwickeln, die in der Lage ist, minorisierte Gruppen adäquat zu<br />
repräsentieren und die Gewalt unterdrückerischer Sprache aufzudecken<br />
und zu skandalisieren. Doch die politische und linguistische <strong>Re</strong>präsentation<br />
determiniert irritierenderweise immer auch die Kriterien,<br />
denen zufolge das Subjekt geformt wird, so dass <strong>Re</strong>präsentation nur<br />
für diejenigen gültig sein kann, die Anerkennung als Subjekt finden.<br />
Die Anerkennung als Subjekt geht der <strong>Re</strong>präsentation unweigerlich<br />
voraus. Wie nun Butler in Anlehnung an Foucault zeigt, produziert die<br />
Macht die Subjekte, die analog repräsentiert werden. Das minorisierte<br />
32<br />
María do Mar Castro Varela & Nikita Dhawan<br />
und marginalisierte Subjekt wird diskursiv durch eben das politische<br />
System hergestellt, welches vorgibt, es zu emanzipieren (vgl. Butler<br />
1990). Wenn nun die Diskurse das produzieren, was sie lediglich zu repräsentieren<br />
vorgeben, so bedeutet dies auch, dass die entscheidende<br />
Frage nicht jene ist, die nach den Möglichkeiten einer adäquaten <strong>Re</strong>präsentation<br />
sucht, sondern dass es vielmehr darum gehen muss, herauszufinden,<br />
wie das Subjekt durch die Machtstrukturen sozialer Widerstandsbewegungen<br />
produziert und eingeschränkt wird (vgl. Butler<br />
1990, 2).<br />
Westliche kritische Theorie legt häufig einen kolonisierenden Impetus<br />
an den Tag, indem sie geradezu erwartet, dass sich postkoloniale<br />
Subjekte ohne Widerrede ihren Vorstellungen von „Unterdrückung“<br />
und „Emanzipation“ fügen. Dabei wird die so genannte ‚Dritte Welt‘<br />
produziert oder auch der ‚Orient‘ als ein Raum konstruiert, für den<br />
etwa die Unterdrückung der Frauen aufgrund seines essentiellen<br />
nichtwestlichen ‚Primitivismus‘ und ‚Barbarismus‘ geradezu symptomatisch<br />
ist (vgl. Castro Varela/Dhawan 2006, Said 1997). Die Folgen<br />
hiervon sind z. B. quasi-normalisierte Darstellungen von MigrantInnen<br />
als die Anderen. Sie besetzen heute den imaginären Raum, den vormals<br />
die Kolonisierten besetzten: Für die Dominanzbevölkerung<br />
verkörpern sie gleichzeitig das „Bedrohliche“, „Barbarische“ und „Exotische“.<br />
Über einen anhaltenden Diskurs um innere Sicherheit und<br />
Terrorismus sind MigrantInnen zum lebendigen und beschreibbaren<br />
„Sicherheitsrisiko“ geworden. Sie sind scheinbar der Grund dafür, warum<br />
mehr und mehr BürgerInnenrechte abgebaut werden, ohne dass<br />
sich wirklicher Widerstand dagegen rührt. MigrantInnen stellen aber<br />
auch das „Barbarische“ dar. Sie müssen deswegen in den verordneten<br />
Orientierungskursen, die der so genannten Integration dienen sollen,<br />
lernen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Insbesondere<br />
Menschen aus Ländern mit muslimischen Mehrheiten stehen unter<br />
dem beständigen Verdacht, die Menschenrechte zu missachten. So<br />
werden Menschen aus postkolonialen Ländern nach wie vor als nichtmoderne<br />
Subjekte gekennzeichnet, die noch in die Moderne finden<br />
müssen. Und wieder scheint es dabei die „Bürde des weißen Mannes“<br />
zu sein, die „Andere Frau vor den Anderen Mann“ zu retten (vgl. Spivak<br />
1988).<br />
33