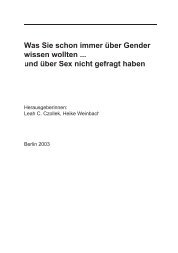Re-Präsentationen - PUB - Universität Bielefeld
Re-Präsentationen - PUB - Universität Bielefeld
Re-Präsentationen - PUB - Universität Bielefeld
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Postnationalsozialistische Gesellschaft<br />
tigung und zur nationalen Besetzung der Thematik, die ausgrenzend<br />
wirkt, ohne diese Ausgrenzung direkt zum Ausdruck zu bringen, da<br />
Identität hier negativ gefasst wird und wie eine schwere Belastung erscheint,<br />
die man loswerden und keinesfalls nun auch noch anderen<br />
zumuten will. Erinnerungsarbeit erscheint damit als etwas, das den<br />
Deutschen abgefordert wird.<br />
Angesichts des europäischen Ausmaßes des nationalsozialistischen<br />
Herrschaftszusammenhangs und angesichts eines zunehmend globalisierten<br />
Holocaust-Gedächtnisses ist in der pädagogischen Erinnerungsarbeit<br />
deutlicher herauszustellen, dass die Geschichte nicht einfach<br />
den Deutschen gehört, sondern dass es sich um eine Geschichte<br />
jenseits nationaler Identitätsstiftungen handelt. Eine durchaus prekäre<br />
Erkenntnis, da sie auch dazu benutzt werden kann, auf eine elegante<br />
Weise das Problem mit der deutschen Identität loszuwerden,<br />
wenn nun alle gleichermaßen mit der Verbrechensgeschichte zu tun<br />
haben sollen. Entgegen einer relativierenden und entlastenden Form<br />
der Multikulturalisierung von Geschichtsaneignung kann es aber in<br />
der dritten Generation möglich werden, den gemeinsamen Kontext<br />
der Migrationsgesellschaft als das Terrain anzuerkennen, auf dem<br />
Geschichte erinnert wird und auf dem zugleich die Zugehörigkeiten<br />
umkämpft sind. Ein beziehungsgeschichtlicher Ansatz, der die Erinnerungsarbeit<br />
in der postnationalsozialistischen Gesellschaft von der<br />
Fixierung auf die deutsche Abstammungsgemeinschaft löst, kann insbesondere<br />
in der dritten Generation dazu beitragen, die vielfältigen<br />
Erfahrungen mit dem Umgang mit erinnerter Geschichte zum Gegenstand<br />
der <strong>Re</strong>flexion zu machen. Dann wäre zu diskutieren, wie an den<br />
Nationalsozialismus erinnert worden ist, was mich daran gestört hat,<br />
welche Formen des Erinnerns mir angemessen oder unangemessen<br />
erscheinen und wie ein kulturelles Holocaustgedächtnis heute zu gestalten<br />
wäre.<br />
64<br />
Astrid Messerschmidt<br />
Abwehrmuster – Gleichsetzung von Erinnerung<br />
mit moralisierender Geschichtsvermittlung<br />
Neben die Schuldstilisierung tritt ein zweites Motiv, das als unartikulierter<br />
Protest gegen moralisierende Geschichtsvermittlung auftritt.<br />
Man wehrt sich gegen den Betroffenheitsgestus der Vertreter/innen<br />
der zweiten Generation, die auch die Lehrer(innen)schaft stellten und<br />
von denen man sich häufig moralisierend belehrt gefühlt hat. Die<br />
Abwehr gegen diese Belehrung tritt dann häufig als Abwehr der Erinnerung<br />
auf: „Dauernd werden wir mit dem Nationalsozialismus belästigt.“<br />
Der historische Gegenstand wird dabei zu etwas Äußerlichem,<br />
mit dem ich eigentlich nichts zu tun habe, das mir aber dauernd als<br />
„mein Ding“ angetragen wird. Der Gestus einer selbstsicheren moralischen<br />
Position, mit dem dieses Herantragen erfolgt (ist), erzeugt<br />
Abgrenzungsreaktionen. Es scheint hier ein Überdruss entstanden zu<br />
sein, der aber nicht in Form der Kritik an der Art und Weise der Vermittlung<br />
ausgetragen werden kann, weil keine Analyse dieser Vermittlungsformen<br />
erfolgt ist. Der Vorwurf an diejenigen, die Erinnerung<br />
zu einem Belehrungsgegenstand machen und so tun, als hätten sie<br />
sich selbst angemessen mit der Geschichte und Vorgeschichte von<br />
Auschwitz auseinander gesetzt, bleibt unausgesprochen. Er wird auf<br />
den historischen Gegenstand gerichtet, der damit auf Distanz gehalten<br />
werden kann.<br />
In der dritten Generation kommt es zu diskontinuierlichen Überlagerungen.<br />
Die Geschichtsdiskurse der Zeitzeug(inn)engeneration wirken<br />
offensichtlich bis in die dritte Generation hinein, die z. T. dieselben<br />
Abwehrmuster aufruft, als würde sie für das Geschehen verantwortlich<br />
gemacht. Aber in dieser Anknüpfung an die Täter und Mittäter zeigt<br />
sich möglicherweise noch etwas anderes als Versöhnungsbedürfnisse<br />
und Entlastungsabsichten. Ausgetragen wird hier unterschwellig auch<br />
der Generationenkonflikt mit der Eltern- und Lehrer/innengeneration.<br />
In dieser zweiten Generation distanzierte man sich von den Tätern und<br />
identifizierte sich mit den Opfern. Wie in der ersten Generation blieben<br />
die Täter die Anderen, allerdings wurden sie zum Teil des deutschen<br />
Geschichtskollektivs, zu jenem Teil, von dem man sich durch das<br />
Thematisieren der Geschichte abgrenzte. Mit der Vergegenwärtigung<br />
des Nationalsozialismus schuf die zweite Generation „die mentale<br />
65