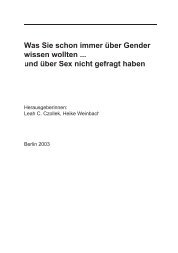Re-Präsentationen - PUB - Universität Bielefeld
Re-Präsentationen - PUB - Universität Bielefeld
Re-Präsentationen - PUB - Universität Bielefeld
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Postnationalsozialistische Gesellschaft<br />
Kohlstruck, Michael (1997): Zwischen Erinnerung und Geschichte. Der Nationalsozialismus<br />
und die jungen Deutschen, Berlin<br />
Kosnick, Kira (1992): Sozialwissenschaftliche Ansätze in der Diskussion um<br />
Opfer und Überleben, in: Wobbe, Theresa (Hg.): Nach Osten. Verdeckte Spuren<br />
nationalsozialistischer Verbrechen, Frankfurt a. M., 87-98<br />
Kux, Ulla (2006): Produktive Irritationen. Multiperspektivische Bildungsprojekte<br />
zur Beziehungsgeschichte hiesiger Mehr- und Minderheiten, in: Fechler,<br />
Bernd/Kößler, Gottfried/Messerschmidt, Astrid/Schäuble, Barbara (Hg.): Neue<br />
Judenfeindschaft? Zum pädagogischen Umgang mit globalisiertem Antisemitismus,<br />
Frankfurt a. M., 318-328<br />
Levi, Primo (1990): Die Untergegangenen und die Geretteten, München/Wien<br />
Levy, Daniel/Sznaider, Natan (2001): Erinnerung im globalen Zeitalter: Der<br />
Holocaust, Frankfurt a. M.<br />
Loewy, Hanno (2000): Deutsche Identitäten vor und nach dem Holocaust, in: Erler,<br />
Hans/Ehrlich, Ernst Ludwig (Hg.): Jüdisches Leben und jüdische Kultur in Deutschland.<br />
Geschichte, Zerstörung und schwieriger Neubeginn, Frankfurt a. M., 240-251<br />
Mecheril, Paul (2003): Prekäre Verhältnisse. Über natio-ethno-kulturelle<br />
(Mehrfach-)Zugehörigkeit, Münster<br />
Meseth, Wolfgang (2002): ‚Auschwitz’ als Bildungsinhalt in der deutschen<br />
Einwanderungsgesellschaft, in: Lenz, Claudia/Schmidt, Jens/von Wrochem,<br />
Oliver (Hg.): Erinnerungskulturen im Dialog. Europäische Perspektiven auf die<br />
NS-Vergangenheit, Münster, 125-133<br />
Messerschmidt, Astrid (2005a): Antiglobal oder postkolonial? Globalisierungskritik,<br />
antisemitische Welterklärungen und der Versuch, sich in Widersprüchen<br />
zu bewegen, in: Loewy, Hanno (Hg.): Gerüchte über die Juden. Antisemitismus,<br />
Philosemitismus und aktuelle Verschwörungstheorien, Essen, 123-146<br />
Messerschmidt, Astrid (2005b): Zwischen Schuldprojektion und Moralisierungsabwehr.<br />
Beobachtungen in der dritten Generation nach dem Holocaust,<br />
in: Außerschulische Bildung, o. J., Heft 1/2005, 35-41<br />
Rüsen, Jörn (2001): Holocaust, Erinnerung, Identität. Drei Formen generationeller<br />
Praktiken der Erinnerung, in: Welzer, Harald (Hg.): Das soziale Gedächtnis.<br />
Geschichte, Erinnerung, Tradierung, Hamburg, 243-259<br />
Schmidt-Linsenhoff, Viktoria (1996): Kohl und Kollwitz. Staats- und Weiblichkeitsdiskurse<br />
in der Neuen Wache 1993, in: Graczyk, Annette (Hg.): Das Volk.<br />
Abbild, Konstruktion, Phantasma, Berlin, 185-203<br />
Schneider, Christian/Stillke, Cornelia/Leineweber, Bernd (2000): Trauma und<br />
Kritik. Zur Generationengeschichte der Kritischen Theorie, Münster<br />
68<br />
Mark Schrödter<br />
Die Objektivität des Rassismus.<br />
Anerkennungsverhältnisse und<br />
prekäre Identitätszumutungen<br />
Wer definiert, was rassistisch ist?<br />
Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter einer mittelgroßen <strong>Universität</strong><br />
holen aus der Cafeteria einige Kannen Kaffee ab, die sie dort für<br />
eine Konferenz bestellt hatten. Einer von ihnen ist weiß, der andere<br />
schwarz. Beide sind promoviert, der erste ist soeben zum Junior-Professor<br />
berufen geworden. Ursprünglich waren zwei Hilfskräfte der<br />
Mitarbeiter, zwei Studentinnen aus demselben Fachbereich, damit<br />
beauftragt, den Kaffee zusammen mit der übrigen Verpflegung abzuholen.<br />
Als die zwei Frauen nun in der Cafeteria nach der Bestellung<br />
fragten, sagte man ihnen, dass zwei „Burschen“ bereits einige Kannen<br />
mitgenommen hätten. Weil die beiden Studentinnen sich keinen<br />
<strong>Re</strong>im darauf machen konnten, um wen es sich bei diesen „Burschen“<br />
gehandelt haben könnte, fügte der Mitarbeiter in der Essensausgabe<br />
hinzu: „Einer von ihnen war dunkelhäutig“. Nun, da die unbekannten<br />
„Burschen“ identifiziert worden waren, war das Gelächter unter den<br />
Hilfskräften groß und an diesem Tag wurde „Kaffee-Burschen“ zum geflügelten<br />
Wort.<br />
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter hatten ebenfalls ihre helle Freude<br />
daran und sie fühlten sich offensichtlich ein wenig geschmeichelt.<br />
Es ist selten, in den „vergeistigten“ Räumen einer <strong>Universität</strong> so unmittelbar<br />
(in nicht-sexualisierter Form) in der Körperlichkeit wahrgenommen<br />
und auf so eine erfrischend naive Weise jenseits der professoralen<br />
Statushierarchie die eigene Jugendlichkeit gespiegelt zu bekommen.<br />
Laut Universalwörterbuch der deutschen Sprache (1997) bezeichnet<br />
man beispielsweise einen niedlichen Knaben als „Burschen“ – eine<br />
Bedeutungsvariante, die für die betroffenen wissenschaftlichen Mitarbeiter,<br />
die sich im vierten Lebensjahrzehnt befinden, unwahrscheinlich<br />
ist. Darüber hinaus ist aber auch der „halbwüchsige“, freundliche,<br />
junge Mann, aber vor allem der Draufgänger ein „Bursche“. Im besten<br />
69