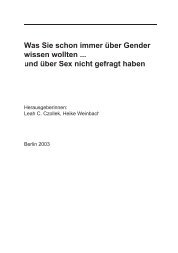Re-Präsentationen - PUB - Universität Bielefeld
Re-Präsentationen - PUB - Universität Bielefeld
Re-Präsentationen - PUB - Universität Bielefeld
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Politik der <strong>Re</strong>präsentation<br />
Ignoranz hervorgebracht. Denn das Sprechen der Migrantin über ihre<br />
Kultur stabilisiert nicht nur die Idee statischer Kulturen als Container,<br />
sondern erzeugt auch eine Vorstellung von Wissen, welches sich quasi<br />
- so die Vorstellung - qua Geburt einstellt. Solcherlei Wissen, welches<br />
von den Mitgliedern der Dominanzkultur immer wieder gerne abgerufen<br />
wird, erweist sich als risikoreich, weil es hegemoniale Strukturen<br />
nicht problematisiert, sondern vielmehr stabilisiert. Zynisch bemerkt<br />
etwa Trinh Minh-Ha:<br />
„My audience expects and demands it; otherwise people would feel<br />
as if they have been cheated: We did not come here to hear a Third<br />
World member speak about the First World. We came to listen to that<br />
voice of difference likely to bring us what we can’t have, and to divert<br />
us from the monotony of sameness“ (Trinh 1989, 88).<br />
Spivak macht deutlich, dass <strong>Re</strong>präsentation als Sprechakt mit einer<br />
Sprecherin auf der einen und einer Zuhörerin auf der anderen Seite<br />
zu lesen ist. Nicht selten versucht das minorisierte Subjekt sich selbst<br />
zu repräsentieren. Wenn jedoch diese <strong>Re</strong>präsentation außerhalb der<br />
offiziell vorgeschriebenen Strukturen stattfindet, so wird dieser Akt<br />
nicht gehört, sondern einfach ignoriert. Spivak bezeichnet diese Form<br />
der <strong>Re</strong>präsentation als die Unmöglichkeit zu sprechen (1996, 306). Die<br />
Zuhörer erkennen es nicht als einen Akt der <strong>Re</strong>präsentation an, auch<br />
weil es nicht dem entspricht, was sie erwarten.<br />
In verschiedenen Beiträgen hat Spivak nun Überlegungen zum<br />
Verhältnis der Intellektuellen zu denjenigen Gruppen, die sich ihrer<br />
Meinung nach nicht selbst repräsentieren können, angestellt. Grundlegend<br />
unterscheidet sie, in Anlehnung an Marx, zwischen Darstellung<br />
als ein Sprechen von und Vertretung als ein Sprechen für (vgl.<br />
Spivak 1994, 71ff). Die Gefahr liegt nun insbesondere darin, beide<br />
Bedeutungen ineinander kollabieren zu lassen und die symbolische<br />
Bedeutung der <strong>Re</strong>präsentation als ein „Sein-in-anderen-Schuhen“ zu<br />
missverstehen und damit die imaginierten Subjektivitäten, die immer<br />
auf instabilen Identifikationen beruhen, zu faktischen <strong>Re</strong>ferenten gefrieren<br />
zu lassen. In der Konsequenz wird die Darstellung, das Porträt,<br />
welches symbolisch die Entmächtigten als kohärentes politisches<br />
Subjekt repräsentiert, zum transparenten Ausdruck ihrer politischen<br />
Begehren und Interessen. Doch es gibt keine Vertretung ohne Darstel-<br />
40<br />
María do Mar Castro Varela & Nikita Dhawan<br />
lung, denn beide Bedeutungen zeigen sich unzertrennlich miteinander<br />
verquickt (Spivak 1996, 6). An anderer Stelle spricht Spivak über<br />
die trickreiche Funktion des „im Namen eines Anderen zu sprechen“.<br />
Genau hier schlägt sie die bekannte Strategie der „persistenten Kritik“<br />
vor, die davor schützen soll, die jeweils Anderen simplifizierender Weise<br />
zu einem Objekt des Wissens zu reduzieren. Der fundamentale Fehler<br />
liegt darin, dass angenommen wird, es gebe einen tatsächlichen<br />
<strong>Re</strong>ferenten, wohlwissend, dass Subjekte der <strong>Re</strong>präsentation immer<br />
imaginierte heterogene Subjekte sind. Dies stabilisiert die Situation,<br />
die es einigen Wenigen gestattet, sich politisch zu artikulieren, die<br />
Anderen zu repräsentieren und sich damit <strong>Re</strong>spekt und Geltung zu<br />
verschaffen (vgl. ebd.). Die Zulassung einiger Auserwählter ist möglich<br />
und nötig. Die hegemoniale Mehrheit kann so ihr Wohlwollen und ihre<br />
Generosität unter Beweis stellen. Das Zulassen einiger Wenigen, Necla<br />
Kelek zum Beispiel, ermöglicht dabei den weiteren konstanten Ausschluss<br />
der Mehrheit der Minorisierten.<br />
<strong>Re</strong>präsentation ist immer auch Interpretation. Aus diesem Grund ist<br />
es wichtig, den Fokus darauf zu richten, wer die Aufgabe des Interpretierens<br />
übernommen hat. Dabei sollte nicht nur die Frage von <strong>Re</strong>levanz<br />
sein, wer repräsentiert, sondern auch, wer aus welchen Gründen<br />
heraus repräsentiert wird, und zu welchem historischen Moment, in<br />
welchem Kontext, mit welchen Strategien und mit welcher Haltung.<br />
Eine kritische <strong>Re</strong>präsentation wagt schließlich danach zu fragen, wer<br />
eigentlich legitimiert ist, die „Stimme der Minorisierten“ zu sein. Der<br />
allegorische Charakter der <strong>Re</strong>präsentation ist es schließlich, der die<br />
Frage, wer nun wirklich über wen spricht, zur vordringlichen Frage<br />
geraten lässt. Wie ist es möglich, ethisch die Erzählungen Anderer zu<br />
bewohnen, ohne sie zu vereinnahmen, ohne ihnen Gewalt anzutun?<br />
Eine mögliche Lösung dieses komplexen Problems ist die Zunahme<br />
von Selbst-<strong>Re</strong>präsentation. Doch natürlich kann die bloße Inklusion<br />
von mehr „Minorisierten“ nicht die gewaltvollen Grenzziehungen ins<br />
Wanken bringen, die eine gleichwertige Partizipation differenter Kollektive<br />
verhindern.<br />
Die Herausforderung liegt darin, mehr Raum zur <strong>Re</strong>präsentation<br />
anti-hegemonialer Politiken zu schaffen. <strong>Re</strong>präsentation ist, wie gesehen,<br />
immer problematisch und nie adäquat oder gar komplett. Wes-<br />
41