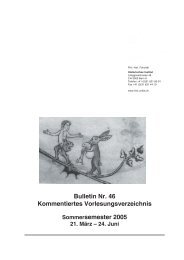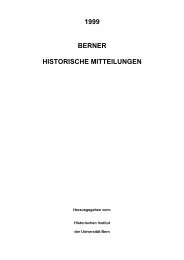BeHMI 2010 - Historisches Institut - Universität Bern
BeHMI 2010 - Historisches Institut - Universität Bern
BeHMI 2010 - Historisches Institut - Universität Bern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
den englischen Thron konnte Arbella für die jeweilig<br />
regierenden Monarchen zur Gefahr werden.<br />
Deshalb hatten diese versucht Arbellas Macht<br />
mit unterschiedlichen Mitteln einzudämmen. Dies<br />
geschah vor allem durch das Schaffen einer finanziellen<br />
Abhängigkeit und Untersagung, ohne<br />
königliche Einwilligung zu heiraten. Als Folge<br />
dessen wurde Arbella in ihren Möglichkeiten zur<br />
dynastischen Herrschaftssicherung enorm beein-<br />
Eliane Forster<br />
trächtigt. Ferner wird gezeigt, dass Arbella ihrer<br />
politischen Wichtigkeit wegen nicht nur zur Herrschaftssicherung<br />
ihrer eigenen Dynastie diente,<br />
sondern auch von der englischen Königin Elisabeth<br />
I. als Mittel zum Erreichen ihrer Ziele eingesetzt<br />
wurde. Weitere europäische Mächte wie Philip<br />
II., König von Spanien, und Papst Clemens VIII.<br />
hegten ebenfalls Interesse an ihr.<br />
Die <strong>Bern</strong>er Schutzaufsicht als Macht/Wissens-Komplex<br />
Akteure, Verfahren, Narrative in den 1960er Jahren<br />
Die Masterarbeit entstand als Teil eines Projektes<br />
zur Aufarbeitung der Geschichte der Bewährungshilfe<br />
(Schutzaufsicht) in <strong>Bern</strong> (vgl. unten).<br />
Im Rahmen dieser Forschungen befasst sich<br />
die Arbeit mit einem reichen Quellenbestand von<br />
240 Personenakten aus den 1960er Jahren. Diese<br />
Personen wurden im Zuge einer bedingten Entlassung<br />
aus einer Anstalt oder nach einer bedingt<br />
vollzogenen Strafe unter Schutzaufsicht gestellt.<br />
Die FürsorgerInnen des <strong>Bern</strong>er Schutzaufsichtsamtes<br />
sowie ehrenamtliche HelferInnen (Patrone<br />
genannt) sollten fortan einige Jahre auf einen<br />
straffreien und normkonformen Lebenswandel der<br />
„Schützlinge“ hinwirken und diesen überwachen.<br />
Die Arbeit untersucht die Verfahren dieser Schutzaufsicht<br />
und die normativen Vorstellungen der zentralen<br />
AkteurInnen, die den Schutzaufsichtsalltag<br />
im Spannungsfeld zwischen Hilfe und Kontrolle<br />
ausgestalteten.<br />
Historiographisch ist die Arbeit an einer Schnittstelle<br />
zwischen Fürsorge- und Kriminalitätsgeschichte<br />
zu verorten. Angestrebt wurde ein methodisch<br />
reflektierter Umgang mit Personenakten<br />
und „Fällen“. Die theoretische Rahmung bietet der<br />
von Michel Foucault betonte Zusammenhang von<br />
Macht und Wissen. Einleitend werden Foucaults<br />
Konzepte der Disziplinarmacht, der Normalisie-<br />
Masterarbeit bei PD. Dr. Regula Ludi<br />
rung, der Einführung des Delinquenten und der<br />
Subjektivierung erörtert und auf die Schutzaufsichtsprozesse<br />
appliziert.<br />
In einem zweiten Teil der Arbeit werden die<br />
rechtlichen Grundlagen, die Verfahrensweisen<br />
und die zentralen AkteurInnen dieses Schutzaufsichtsfeldes<br />
vorgestellt. Herausgearbeitet werden<br />
sowohl angewendete Kontroll- und Zwangsmassnahmen<br />
wie auch unterstützende Interventionen<br />
der FürsorgerInnen. Es sollen hierbei die Fürsorgekonzeption<br />
des Schutzaufsichtsamtes und der<br />
Professionalisierungsanspruch der <strong>Bern</strong>er FürsorgerInnen<br />
verdeutlicht werden. Ausserdem wird die<br />
Position der <strong>Bern</strong>er Schutzaufsicht im Schweizerischen<br />
Strafvollzugsdiskurs aufgezeigt.<br />
Im Anschluss richtet sich der Fokus auf die Wissensproduktion<br />
innerhalb des Schutzaufsichtsverfahrens.<br />
Hierzu werden die Aktenführung und<br />
Dokumentationstechniken der Schutzaufsicht<br />
beschrieben, die Wissensbeschaffungsverfahren<br />
untersucht und der Wissenstransfer zwischen den<br />
verschiedenen AkteurInnen sowie amtlichen Stellen<br />
analysiert. Dabei zeigt sich, wie die Personen<br />
als „Schützlinge“ konstituiert wurden und welche<br />
fallspezifische Narrative einer nicht-Bewährung<br />
zugrunde lagen, die zum Widerruf der bedingt<br />
ausgesprochenen Strafe führten. Schliesslich wird<br />
19