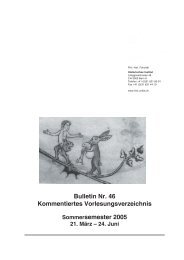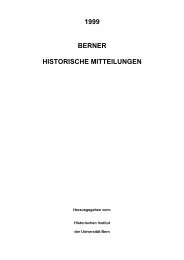BeHMI 2010 - Historisches Institut - Universität Bern
BeHMI 2010 - Historisches Institut - Universität Bern
BeHMI 2010 - Historisches Institut - Universität Bern
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Nach dieser allgemeinen Einführung lenkt die Autorin<br />
den Fokus auf die Leitfrage. Sie setzt sich<br />
hierfür mit der aus der Soziologie stammenden<br />
Theorie von Spector und Kitsuse „Constructing<br />
Social Problems“ auseinander und überträgt sie<br />
auf ihre Arbeit. Die Kernaussage liegt in der Feststellung,<br />
dass hinter jeder Formulierung einer Forderung<br />
und jeder Unterstützung einer Beschwerde<br />
Werte stehen, die es zu verteidigen gilt. Diese Werte<br />
geben nicht nur wieder, was falsch ist, sondern<br />
ebenfalls, warum etwas falsch ist.<br />
Es folgt eine kurze Einleitung in Produktion, Wirkung,<br />
Wirkstoffe, Verbreitung und Konsum von<br />
Absinth. In der Schweiz wurde das Getränk fast<br />
ausschliesslich in den französischsprachigen Kantonen<br />
konsumiert. Bis ins späte 19. Jahrhundert<br />
hinein waren Absinth und absinthhaltige Getränke<br />
Allerheilmittel. Dieses positive Bild veränderte<br />
sich, Absinth wurde als besonders schlimmes alkoholisches<br />
Getränk wahrgenommen.<br />
Nun kamen die verschiedenen Akteure ins Spiel,<br />
auf drei Gruppen wird näher eingegangen: Das<br />
Blaue Kreuz, die Frauen und die Medizin. Sie traten<br />
nach dem als „Verbrechen von Commugny“<br />
bekannten Ereignis in die Öffentlichkeit. Im April<br />
1905 erschoss in Commugny ein Weinbergarbeiter<br />
im Alkohol- und Absinthrausch seine schwangere<br />
Frau sowie seine beiden Töchter. Wieder nüchtern<br />
konnte er sich nicht an die Morde erinnern, er<br />
wurde verurteilt und erhängte sich in seiner Zelle.<br />
Was waren die Hintergründe? Der Täter war<br />
Alkoholiker, der nach eigenen Angaben täglich<br />
durchschnittlich fünf Liter Wein und zwei Gläser<br />
Absinth trank. Trotz diesen Kenntnissen wurde die<br />
Tat einzig und allein dem Absinth zugeschrieben.<br />
Ende 1905/06 reichten die Stimmbürger im Kanton<br />
Waadt/Genf eine Petition für ein kantonales<br />
Verkaufsverbot von Absinth ein. In beiden Kantonen<br />
wurde ein Verkaufsverbot eingeführt. Die<br />
kantonalen Verbote genügten den Alkoholgegnern<br />
nicht, sie lancierten ein eidgenössisches Initiativbegehren,<br />
welches Herstellung, Einfuhr, Verkauf<br />
und Aufbewahrung von Absinth auf dem gesamten<br />
Territorium der Eidgenossenschaft verbieten<br />
sollte. Dieses Vorgehen stand im Widerspruch<br />
zur Handels- und Gewerbefreiheit wie auch zu<br />
der in der Verfassung festgehaltenen persönlichen<br />
Freiheit der Bürger. Über diese wurde beim Absinthverbot<br />
jedoch die staatliche Rolle als Hüter<br />
der Volksgesundheit gewichtet. Die Meinungsmacher<br />
argumentierten mit medizinischen (Absinth =<br />
Gift), gesellschaftlichen (Absinth = Zerstörer des<br />
Familienglücks) und wirtschaftlichen (Absinth =<br />
Verarmungsursache Nummer eins) Begründungen.<br />
Eine Befragung der Kantonsregierungen ergab,<br />
dass das Absinthproblem in 21 Kantonen und sechs<br />
Halbkantonen nicht vorhanden war, dass zwei betroffene<br />
Kantone bereits ein Verkaufsverbot eingeführt<br />
hatten und sich nur die Kantone Freiburg und<br />
Wallis ein Verbot wünschten. Von den staatlichen<br />
<strong>Institut</strong>ionen lehnte der Bundesrat das Begehren<br />
ab, National- und Ständerat stimmten der Initiative<br />
zu. Am 7. April 1908 wurde die Volksinitiative<br />
„für ein Absinthverbot“ mit 63.5% der Stimmen<br />
angenommen. Erwähnenswert ist, dass die von der<br />
Problematik betroffenen französischsprachigen<br />
Kantone das Gesetz verworfen haben.<br />
Im Fazit beantwortet die Autorin die Anfangs gestellte<br />
Frage und vertritt den Standpunkt, dass die<br />
Gesetzgebung den Alkoholkonsum im Allgemeinen<br />
nicht konsequent bekämpft und am Absinth<br />
ein Exempel statuiert hat. Sie erläutert die Wichtigkeit<br />
von Werten und Moral und zeigt auf, wie<br />
es den Agitatoren gelang, mit ihrer Argumentation<br />
das Gewissen der Stimmbürger anzusprechen: der<br />
Wunsch nach moralisch korrektem Handeln hat<br />
zum Absinthverbot geführt.<br />
39