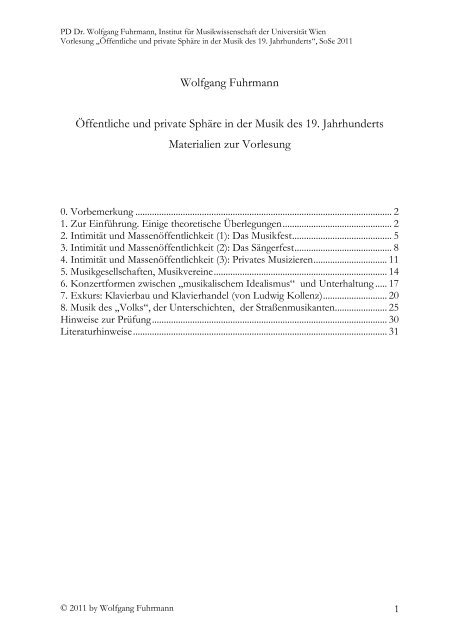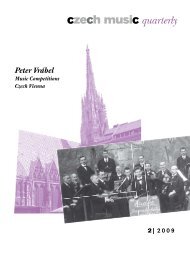Materialien zur Vorlesung "Öffentliche und private Sphäre"
Materialien zur Vorlesung "Öffentliche und private Sphäre"
Materialien zur Vorlesung "Öffentliche und private Sphäre"
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Wolfgang Fuhrmann<br />
<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
<strong>Materialien</strong> <strong>zur</strong> <strong>Vorlesung</strong><br />
0. Vorbemerkung ............................................................................................................ 2<br />
1. Zur Einführung. Einige theoretische Überlegungen .............................................. 2<br />
2. Intimität <strong>und</strong> Massenöffentlichkeit (1): Das Musikfest .......................................... 5<br />
3. Intimität <strong>und</strong> Massenöffentlichkeit (2): Das Sängerfest ......................................... 8<br />
4. Intimität <strong>und</strong> Massenöffentlichkeit (3): Privates Musizieren ............................... 11<br />
5. Musikgesellschaften, Musikvereine ......................................................................... 14<br />
6. Konzertformen zwischen „musikalischem Idealismus“ <strong>und</strong> Unterhaltung ..... 17<br />
7. Exkurs: Klavierbau <strong>und</strong> Klavierhandel (von Ludwig Kollenz) ........................... 20<br />
8. Musik des „Volks“, der Unterschichten, der Straßenmusikanten...................... 25<br />
Hinweise <strong>zur</strong> Prüfung ................................................................................................... 30<br />
Literaturhinweise ........................................................................................................... 31<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 1
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
0. Vorbemerkung<br />
Die vorliegenden <strong>Materialien</strong> sind nicht dazu gedacht, einen vollständigen<br />
Überblick über den Prüfungsstoff zu geben. Wer die <strong>Vorlesung</strong> nicht besucht hat,<br />
muss die einzelnen Themengebiete anhand der hier gegebenen Gr<strong>und</strong>risse <strong>und</strong> der<br />
Literaturhinweise nacharbeiten. Zu den Modalitäten der Prüfung siehe den<br />
Schlussabschnitt.<br />
Zitate in Rahmen sollen Beispiele bieten <strong>und</strong> zu eigenen Interpretationen anregen.<br />
Da es sich hier um Lernmaterialien handelt, wird auf den wissenschaftlichen<br />
Nachweis weitgehend verzichtet. Auf die Wiedergabe von Liedtexten wird<br />
verzichtet, da diese im allgemeinen leicht im Internet zu finden sind.<br />
1. Zur Einführung. Einige theoretische Überlegungen<br />
Musikalische Öffentlichkeit als Problem: einige Zitate<br />
Beethoven an George Smart über op. 95: „Nota Bene; this quartet is written for a<br />
small circle of connoisseurs and is never to be performed in public.“<br />
Robert Schumann 1837 an Clara: „Zum öffentlich Spielen paßt wirklich nichts von<br />
meinen Sachen allen.“<br />
Heinrich Schenker, Erinnerungen an Brahms: „Als ich <strong>und</strong> Eduard Gärtner, ein<br />
trefflicher Sänger, der bemerkenswerte Verdienste um das Wiener Konzertleben<br />
hatte, Brahms einmal zu einem Liederabend einluden, dessen Programm auch in<br />
der Öffentlichkeit noch unbekannte Lieder aufwies, bedeutete er uns: ‚Nicht alle<br />
Lieder von mir taugen in die Öffentlichkeit, manche davon sind nur als<br />
Kammerlieder gedacht.’“<br />
Alban Berg, Statuten von Schönbergs Verein für musikalische Privataufführungen:<br />
„§ 3. Die Aufführungen müssen dem korrumpierenden Einfluß der Öffentlichkeit<br />
entzogen werden, das heißt, sie dürfen nicht auf Wettbewerb gerichtet <strong>und</strong> müssen<br />
unabhängig sein von Beifall <strong>und</strong> Mißfallen.“<br />
Zum Konzept musikalischer Öffentlichkeit<br />
Gr<strong>und</strong>legend: Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (siehe<br />
Literaturverzeichnis)<br />
Habermas’ Gr<strong>und</strong>these lautet: Die repräsentative (aristokratische, hierarchische,<br />
„alteuropäische“) Öffentlichkeit wird im 18./19. Jahrh<strong>und</strong>ert von der bürgerlichen<br />
(räsonierenden = öffentliche Debatten führenden, tendenziell demokratisch-<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 2
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
egalitären, modernen) Öffentlichkeit abgelöst. Dabei spielen die Medien, von<br />
Buchdruck <strong>und</strong> Zeitung bis zum Internet, eine zentrale Rolle.<br />
Das Problem von Habermas’ Ansatz in unserem Zusammenhang: Musikalische<br />
Öffentlichkeit erschöpft sich nicht nur in einer öffentlichen/publizistischen<br />
Debatte über Musik. Notwendig für eine solche Debatte ist zunächst einmal die<br />
Verbreitung musikalischer Kenntnisse, praktischer Fähigkeiten, <strong>und</strong> die<br />
Zugänglichkeit musikalischer Texte bzw. Aufführungen.<br />
Damit stellt sich musikalische Öffentlichkeit im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert (<strong>und</strong> auch im 18.<br />
bzw. 20./21.) als ein komplexes System dar, in dem Bildungs- <strong>und</strong> Besitzvoraussetzungen,<br />
gesellschaftlicher Status, Preise für Instrumente, Noten, Veranstaltungen,<br />
mediale Zusammenhänge (im Notendruck wie in der Musikpublizistik),<br />
Institutionen der Aufführung von Musik (z. B. Musikfest, Oper, Konzert), Institutionen<br />
der öffentlichen Debatte (Musikzeitschriften, Bücher, Tagespresse) <strong>und</strong><br />
pädagogische Institutionen (vor allem die im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert überall errichteten<br />
Konservatorien) eine systemtragende Rolle spielen, aufeinander verweisen <strong>und</strong><br />
voneinander abhängig sind. Dies alles hat Auswirkungen nicht nur auf Interpreten<br />
<strong>und</strong> Publikum, sondern auch auf das Komponieren <strong>und</strong> das Selbstverständnis der<br />
Komponisten.<br />
Im Rahmen der <strong>Vorlesung</strong> wurden vor allem die Formen des Musikmachens<br />
untersucht. (Aus Zeitgründen konnten die übrigen Aspekte nur am Rande<br />
thematisiert werden, obwohl etwa die Musikpublizistik natürlich immer wieder in<br />
zitierten Dokumenten <strong>zur</strong> Sprache kam.) Dabei spielten folgende Fragestellungen<br />
eine zentrale Rolle:<br />
– Inklusion <strong>und</strong> Exklusion. Wem ist der Zugang erlaubt, sei es als Musiker, sei es<br />
als Hörer? Wer „muss draußen bleiben“? Das Bedürfnis nach sozialer Distinktion<br />
(Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede) schlägt sich auch in ästhetischen Urteilen, in<br />
kompositorischen Entscheidungen wie der Wahl bestimmter Gattungen, im<br />
Umgang mit Musik, etwa im Publikumsverhalten, nieder.<br />
– Soziale Funktion <strong>und</strong> Kunstcharakter. Musikmachen im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert hat<br />
immer auch seine gesellschaftlichen „Nebeneffekte“: Sie reichen von der<br />
Demonstration eines bestimmten sozialen „Habitus“ (Bourdieu) über die bloße<br />
Geselligkeit bis <strong>zur</strong> entschiedenen Präsentation von „Kennertum“. Die Bewegung<br />
des „musikalischen Idealismus“ (William Weber) versucht, das Konzert als Kunstereignis<br />
von den gesellschaftlichen Nebeneffekten zu emanzipieren.<br />
– Politische Fragen. Revolution, Nationalismus, Arbeiterbewegung: Die großen<br />
politischen <strong>und</strong> sozialen Ereignisse <strong>und</strong> Probleme des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts haben auch<br />
in der Musikgeschichte.<br />
– Gegenöffentlichkeit: Die Welten des „Populären“, der Unterhaltung, des Volkslieds<br />
<strong>und</strong> des Gassenhauers, die Musik der Unterschichten <strong>und</strong> Straßenmusikanten,<br />
die ohne Bildungsvoraussetzungen <strong>und</strong> Besitz (etwa eines bürgerlichen Instruments<br />
wie des Klaviers) auskommen müssen.<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 3
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Theoretische Modelle<br />
Im Lauf der <strong>Vorlesung</strong> haben sich vor allem zwei theoretische Überlegungen als<br />
weiterführend erwiesen. Die erste betrifft den Prozess der Entwicklung<br />
musikalischer Öffentlichkeit, die andere ihre Formen.<br />
1. Musikalische Bildung <strong>und</strong> Kultur war traditionsgemäß ein Vorrecht des Adels.<br />
Auch wenn es im 16., 17. <strong>und</strong> vor allem im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert schon beachtliche<br />
musikalische Aktivitäten des Bürgertums gegeben hat, hat es doch erst im 19. einen<br />
dominierenden Platz im Musikleben erobert. Und auch hier waren es zunächst die<br />
höheren, besser verdienenden, besser gebildeten Schichten innerhalb des<br />
Bürgertums. Musikalische Öffentlichkeit wird so begreiflich als ein sich von einer<br />
schmalen Elite an der Spitze der gesellschaftlichen Pyramide langsam ausbreitender<br />
Prozess, der immer auf Ungleichheiten von Bildung <strong>und</strong> Besitz gründete, dennoch<br />
aber seine soziale Basis immer mehr verbreiterte; musikalische Öffentlichkeit<br />
diff<strong>und</strong>ierte gleichsam von oben nach unten. Der Versuch des späten 19. <strong>und</strong><br />
frühen 20. Jahrh<strong>und</strong>erts, die großen Werke der bürgerlichen Musikkultur auch den<br />
Arbeitern nahezubringen, ist gewissermaßen die letzte Konsequenz dieses<br />
Prozesses.<br />
2. Die Unterscheidung zwischen „privat“ <strong>und</strong> „öffentlich“, wie sie etwa<br />
Habermas oder die entsprechenden Bände der „Musikgeschichte in Bildern“<br />
treffen, erweist sich als zu starr, um der historischen Wirklichkeit gerecht zu<br />
werden. Tatsächlich gibt es zwischen diesen beiden Bereichen eine Reihe von<br />
Zwischenstufen. Ich habe – in lockerer Anlehnung an Bruno Latours „Soziologie<br />
der Assoziationen“ – folgendes Modell vorgeschlagen:<br />
– Privat (im eigentlichen Sinn): häuslich-intimes Musizieren<br />
– Gesellig: Musizieren im Kreis von Fre<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Bekannten<br />
– „Gesellschaft“: Musizieren im Rahmen eines „Salons“<br />
– Assoziation: Musizieren im Rahmen einer Musikgesellschaft, also eines auch<br />
durch Statuten geregelten Vereins<br />
– Öffentlich: Musizieren in einem nicht, oder höchstens durch Eintrittspreise<br />
beschränkten Rahmen.<br />
In diesen Zwischenstufen vor allem spielt sich die Entwicklung musikalischer<br />
Öffentlichkeit ab. Denn in den oft noch kleinen Städten Europas (vor allem in der<br />
ersten Jahrh<strong>und</strong>erthälfte) kennt sich die schmale Schicht der „Gebildeten“ ohnehin<br />
persönlich <strong>und</strong> außerhalb ihres Kreises gab es für diese Art von Musik ohnehin<br />
praktisch kein Publikun. Ob man sich dabei in einem Salon traf oder im<br />
Konzertsaal, spielt dabei kaum eine Rolle: Man blieb „unter sich“. Dies ändert sich<br />
erst mit dem rapiden Bevölkerungswachstum <strong>und</strong> der immer stärkeren Erweiterung<br />
musikk<strong>und</strong>iger Schichten in der zweiten Jahrh<strong>und</strong>erthälfte.<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 4
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
2. Intimität <strong>und</strong> Massenöffentlichkeit (1): Das Musikfest<br />
Die Verbreitung musikalischer Interessen <strong>und</strong> Aktivitäten über deren traditionelle<br />
Sphäre in Aristokratie <strong>und</strong> Kirche hinaus wird zu Beginn des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts<br />
vielfach bemerkt <strong>und</strong> auch bemängelt. Das wirtschaftlich im Aufstieg begriffene<br />
Bürgertum, das in mehreren Revolutionen (1789, 1830, 1848) nach politischer<br />
Macht <strong>und</strong> Repräsentation strebt, schreibt sich zugleich die Kultur auf die Fahnen.<br />
Drastisch formuliert diesen Zusammenhang 1825 ein Autor aus Würzburg in der<br />
Musikzeitschrift Cäcilia, in einem Artikel mit dem schönen Titel „Ein unvorgreifliches<br />
Bedenken über die itzige musikalische Kultur à la mode“:<br />
„Auf dem Angesichte unserer Zeit kokettiren zwei grelle Schönpflästerchen,<br />
nämlich das papierene in Bezug auf Staats- <strong>und</strong> Geschäftsleben, <strong>und</strong>, was die<br />
ästhetische Bildung belangt, das musikalische. Weil nun weder der Land- noch<br />
Gottesfrieden je das Reich der Töne in seine Huth genommen, so ist uns dadurch<br />
freie Fug <strong>und</strong> Macht gegeben, eben dieses letztere zu lüften, um etwa die verdeckte<br />
Pocke zu erk<strong>und</strong>en, die darunter liegen mag.“<br />
Die umfassendste Form, in der sich Bürgertum <strong>und</strong> Nation musikalisch selbst<br />
repräsentieren, zugleich die Form mit dem höchsten Grad an sozialer Inklusivität,<br />
ist das Musikfest.<br />
Definition des deutschen Musikfests: zwei- bis dreitägige musikalische<br />
Veranstaltungen an einem Ort mit regionalen Kräften (im Unterschied zum<br />
Schweizer Musikfest, dem Ursprung der gesamten Musikfestbewegung, an dem die<br />
ganze Nation teilnahm, oder zum österreichischen, das zumindest in Wien große<br />
Oratorien auch mit lokaler Besetzung aufführen konnte). Zunächst durch<br />
Personen, dann durch Vereine organisiert, in der Regel ein- bis zweijährig<br />
wiederkehrend, wobei Ort zyklisch wechselt (z. B. im Niederrheinischen Musikfest:<br />
Elberfeld, Düsseldorf, Köln, Aachen). Kein äußerer Anlass, Aufführungen meist<br />
Pfingsten oder September.<br />
Teilnehmerschaft: gemischter ad-hoc Chor, Orchester manchmal professionell,<br />
Solisten Dilettanten (später Profis), keine Teilnehmerrestriktionen (nach<br />
Vereinszugehörigkeit, Begabung, Sozialstatus, Einkommen o. ä.). Ab den 1840er<br />
Jahren zunehmende Tendenz <strong>zur</strong> Professionalisierung (Berufsmusiker) <strong>und</strong> damit<br />
auch <strong>zur</strong> Kommerzialisierung.<br />
Konzertprogramm: geistliche & weltliche Musik, insbesondere großes Chor-<br />
Orchesterwerk: zunächst bevorzugt Haydns Oratorien, ab 1820/30 Händel.<br />
Daneben effektvoll-triviale Musik wie Friedrich Schneiders – nicht ursprünglich für<br />
ein Musikfest komponiertes – Das Weltgericht. Ausdrücklich für Musikfeste<br />
entstanden Beethovens Christus am Ölberg, Louis Spohrs Das jüngste Gericht, die<br />
Oratorien von Mendelssohn: Elias, Paulus. Als wenig erfolgreich, da zu zart-<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 5
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
poetisch, erwies sich Schumanns Das Paradies <strong>und</strong> die Peri). Keine szenische Musik<br />
(≠ Festspiele), aber oft ein Symphoniekonzert (vor allem Beethoven).<br />
Äußerungen zu Georg Friedrich Händel<br />
in der Publizistik zum Musikfest im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
Händels Musik sei „durch die vorherrschende Beschäftigung der Vocalkräfte der<br />
Massen […] geradezu vorzüglich <strong>zur</strong> Aufführung an Musikfesten geeignet“. Sie<br />
kennzeichne „im Ganzen, bei vielleicht weniger Tiefe <strong>und</strong> Reichthum polyphoner<br />
Ausarbeitung, eine fasslichere Fügung <strong>und</strong> ein absichtliches Hinneigen zu einer<br />
edeln Popularität in den Chören.“ Der Messias wird zum nationalen Denkmal<br />
erklärt: „dieser altdeutsche Dom, dessen Bau von tönendem Erz die Stürme eines<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts nicht verwittern konnten“. „Kein dorischer Tempel kann deutlicher<br />
von dem harmonischen Schönheitssinn der Hellenen, kein St. Peter sprechender<br />
von der weltumfassenden Gewalt des hierarchischen Gedankens, kein gothischer<br />
Säulen- <strong>und</strong> Fialenwald überzeugender von der transcendentalen Schwärmerei<br />
unserer Altvorderen sprechen, als in diesen ewigen Thönen das gesammte<br />
christliche Denken <strong>und</strong> Fühlen des germanischen Geistes niedergelegt ist“. Eben<br />
das nicht-kirchlich oder konfessionell geb<strong>und</strong>ene des Werks zog an.<br />
Rahmenprogramm: Festtafeln, Bälle, Ausflüge, Dekoration des Orts (Blumen,<br />
Fahnen, Illuminationen, Feuerwerk), zumindest anfangs <strong>private</strong> Unterkunft<br />
Aufführungsorte: Kirchen, Theater, Reitbahnen (Wien: Winterreitschule), eher<br />
selten Kirchen, Theater ungeeignet. 1841 (Hamburg), <strong>und</strong> öfter wurden hölzerne<br />
„Tonhallen“ errichtet <strong>und</strong> hinterher wieder abgerissen. Dies gilt auch für<br />
Sängerfeste, die allerdings ganz anders funktionierten (s. u.).<br />
Sinn <strong>und</strong> Bedeutung der Musikfeste<br />
a) Aufführung oratorischer Werke, die bei der damals geringen Bevölkerungszahl<br />
der meisten Städte anders nicht zu machen gewesen wären. (Oratorien in<br />
Massenbesetzung waren nur in großen Städten zu machen – siehe etwa die „Handel<br />
Commemorations“ in London 1784 <strong>und</strong> 1791, die Uraufführung von Haydns<br />
Schöpfung in Wien usw.)<br />
b) Bildungsbestreben: Die Musikfeste, heißt es 1831 in der Zeitschrift Eutonia,<br />
würden nicht nur <strong>zur</strong> „Bildung eines guten Geschmackes“, sondern auch „nicht<br />
wenig <strong>zur</strong> Veredlung des geistigen Menschen“ beitragen.<br />
c) Kollektivgefühl <strong>und</strong> Sozialausgleich. Die Musikfeste sind prinzipiell jedem<br />
zugänglich, jeder darf mitsingen oder -spielen oder auch zuhören. 1821 heißt es:<br />
Die Feste gälten der „Ausführung großer classischer Werke mit vereinten Kräften<br />
aller Musiker <strong>und</strong> Dilettanten unter allen Ständen“. Daher wurden am Anfang der<br />
Bewegung auch alle Teilnehmer in den umliegenden Dörfern untergebracht,<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 6
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
gerühmt wurde die „biedere <strong>und</strong> noble Gastfre<strong>und</strong>schaft“. Diese geschieht freilich<br />
nicht immer ganz freiwillig. In der historischen Realität freilich sind dieser<br />
Inklusivität durch die notwendigen Bildungsvoraussetzungen gewisse Grenzen<br />
gesetzt, <strong>und</strong> durch die erwähnten Kommerzialisierungsbestrebungen werden sie<br />
ohnehin außer Kraft gesetzt. Dennoch zeigt sich das große Interesse der<br />
Deutschen an der ständig steigenden Zahl der Sänger. Bei den niederrheinischen<br />
Musikfesten z. B. stieg die Zahl der Singenden von durchschnittlich 168 im<br />
Zeitraum 1818-24 auf 547 im Zeitraum 1851-67, sodass zuletzt zwischen Chor <strong>und</strong><br />
Orchester ein Verhältnis von 4:1 herrschte.<br />
Eduard Krüger über den Ausgleich sozialer Gegensätze im Fest:<br />
„Zum Begriff eines Festes gehört wohl die Teilnahme einer großen Masse, ja nach<br />
altrömischer Weise des ganzen Volkes. Wo die (ideelle) Menschheit feierlich im<br />
Glanze ihrer Werke erscheint, da muß die (concrete) Menschheit auch in Fülle<br />
hinzutreten. […]ein Fest ist’s nicht, was einigen Glücklichen zugehört, sondern wo<br />
Fürst <strong>und</strong> Volk in aller Freude <strong>und</strong> Herrlichkeit des Lebens zusammenschmelzen:<br />
das ist ein Fest.“ Eduard Krüger, Beiträge für Leben <strong>und</strong> Wissenschaft der Tonkunst,<br />
Leipzig 1847, 60f.<br />
Vorbild <strong>und</strong> Ausgangspunkt der Feste sind die Französischen Revolutionsfeste,<br />
auf die sich freilich niemand explizit beruft. Diese Feste, die mit der Feier des<br />
ersten Jahrestags des Sturms auf die Bastille, begannen (Fête de la Féderation, 14.<br />
Juli 1790 auf dem Marsfeld), sprachen ausdrücklich die ganze Nation an. Bei der<br />
Fête de la Féderation leistete Ludwig XVI. vor 300.000 Zuschauern seinen Eid auf<br />
die von La Fayette verlesene Verfassung. Zu diesem Zweck wurde ein eigener<br />
„Altar des Vaterlandes“ errichtet.<br />
Soziale Inklusivität in den Französischen Revolutionsfesten<br />
Über die Vorbereitungen <strong>zur</strong> Fête de la Féderation: „Soldaten, Kaufleute,<br />
Kohlenträger, Zünfte, Priester, Ordensgeistliche <strong>und</strong> andre, Schüler aller<br />
Lehranstalten, Seminaristen, alle Welt arbeitet ausdauernd <strong>und</strong> tapfer. Selbst<br />
Frauen, darunter sehr schöne <strong>und</strong> glänzende Damen, begeben sich täglich<br />
bezirksweise aufs Marsfeld, wo sie mit Schub- <strong>und</strong> Kippkarren Erde wegschaffen.<br />
Dieses Schauspiel … reißt <strong>zur</strong> Bew<strong>und</strong>erung hin. … Ich habe diese Werkstatt von<br />
über 60 000 Arbeitern <strong>und</strong> Arbeiterinnen vom politischen Standpunkt aus betrachtet,<br />
<strong>und</strong> ich habe gelernt, daß es für Völker, die vom Geiste der Freiheit beseelt<br />
sind, nichts Unangenehmes <strong>und</strong> nicht Unmögliches gibt.“ (Gaultier von Biauzat)<br />
„Der Anblick des Enthusiasmus im Volke, <strong>und</strong> vorzüglich auf dem Champ de<br />
Mars, wo man die Zubereitungen zum großen Nationalfeste machte, ist herzerhebend,<br />
weil er so ganz allgemein durch alle Klassen des Volkes geht <strong>und</strong> so rein <strong>und</strong><br />
einfach auf das gemeine Beste mit Hintansetzung des Privatvorteils wirkt.“ (Georg<br />
Forster)<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 7
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Hier wurde noch ein Te Deum gesungen, komponiert von Francois Joseph<br />
Gossec. Später wurde der katholische Einfluss <strong>zur</strong>ückgedrängt, vor allem unter den<br />
Jakobinern, die den Kult des höchsten Wesens (être supreme) einführten, bei dem<br />
man Gott mit der Vernunft gleichsetzen kann. Diese Auch eine solche Hymne an<br />
das être supreme hat Gossec komponiert. Sie war in einfachem, erhabenen Stil –<br />
der schlichtweg notwendig ist, wenn man einen Chor von nicht weniger als 2400<br />
Menschen singen lassen will. „Jeder der 48 Bezirke von Paris stellte je 50 Sänger,<br />
die sich aus 10 alten <strong>und</strong> 10 jungen Männern, 10 Müttern, 10 jungen Mädchen <strong>und</strong><br />
10 Kindern zusammensetzten.“ (Knepler 1, 116) Prominente Musiker wie Méhul,<br />
Catel, Dalayrac, Kreutzer <strong>und</strong> Lesueur übernahmen unterschiedliche Bezirke, <strong>und</strong><br />
der berühmte Cherubini soll die Lieder den Marktfrauen in der Markthalle<br />
vorgegeigt haben.<br />
In Deutschland fand das erste Musikfest 1810 im thüringischen Städtchen<br />
Frankenhausen (worüber Ernst Ludwig Gerber in der Allgemeinen musikalischen<br />
Zeitung berichtete) mit einer Aufführung der Schöpfung statt, es verbreitete sich von<br />
dort über alle deutschen Regionen. Als besonders langlebig erwiesen sich die<br />
niederrheinischen Musikfeste: Sie fanden (mit kleineren Unterbrechungen) von<br />
1818 bis 1958 (!) statt.<br />
Das Musikfest gab es auch in anderen Ländern (England, Niederlande), ab 1846<br />
in den USA, ab 1888 fand schließlich zuerst in Kopenhagen das Nordische<br />
Musikfest statt. In London fanden im Crystal Palace von 1857–1926 alle 3 Jahre<br />
Musikfeste mit 3000 Mitwirkenden <strong>und</strong> 10 000 Hörern statt. Der absolute Gipfel<br />
der Tendenz <strong>zur</strong> Momumentalisierung wurde beim Bostoner World’s Peace Jubilee<br />
and International Music Festival 1872 erreicht. Alle Musikfeste sollten quantitativ<br />
überboten werden. 20 000 Sänger <strong>und</strong> 1000 Instrumentalisten in einem eigens<br />
dafür errichteten Colosseum. Dirigent war Johann Strauß Sohn. Er hatte 20<br />
Subdirigenten.<br />
Literatur: Knepler, Weibel, Boresch, Eichhorn, Schwab.<br />
3. Intimität <strong>und</strong> Massenöffentlichkeit (2): Das Sängerfest<br />
Im Gegensatz zum eher unpolitischen Musikfest waren die (Männer-)Gesangvereine<br />
<strong>und</strong> die von ihnen veranstalteten Sängerfeste explizit politischer Natur,<br />
wobei sie Nationalismus mit der Forderung nach politischer Emanzipation<br />
verknüpften. Die Gesangvereine <strong>und</strong> andere Bewegungen wie die Turner- <strong>und</strong><br />
Schützenvereine <strong>und</strong> die von ihnen veranstalteten Volks-, Turn-, Sängerfeste waren<br />
nur vorgeblich unpolitisch. Tatsächlich repräsentierten sie oppositionelle<br />
Bewegungen.<br />
Als – noch nicht oppositionell gedachte – Vorlage für diese Volksfeste diente das<br />
„deutsche Nationalfest“ des 18. Oktober 1814 (Jahrestag der Leipziger<br />
Völkerschlacht). Es wurde deutschlandweit gefeiert. Die Menschen versammelten<br />
sich festlich geschmückt am Nachmittag oder am Abend vor dem Rathaus, dann<br />
Umzug (Glockengeläut, Militärmusik, Böllerschüsse) zu den Feuerplätzen<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 8
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
außerhalb des Ortes; am Abend färbten unzählige Feuersäulen, die allenthalben<br />
entzündet wurden, den Himmel rot (Brandopfer, Opferflammen, heilige<br />
Dankesflammen; die Berge: Altäre der Natur usw.). Um diese Feuersäulen wurden<br />
patriotisch-deutsche Rezitationen veranstaltet <strong>und</strong> nationaldeutsche bzw. kirchlichreligiöse<br />
Lieder gesungen (z. B. „Nun danket alle Gott“, das katholische „Te Deum<br />
laudamus“); Landwehr oder Landsturmmännern, Bürgermilizen <strong>und</strong> ähnliche traten<br />
in voller Waffenmontur auf. Der Pfarrer oder sonst jemand hielt eine Rede. Es<br />
folgt ein Feuerwerk <strong>und</strong> der Rückweg in den Ort; dann Festmahl. Am folgenden<br />
Tag gab es einen Kirchgang (ökumenisch!), dann eine gesellige Veranstaltung: ein<br />
Kinder oder Jugendfest, ein Ball, ein Konzert.<br />
Also ist dieses Fest zugleich religiös, ein nationales Freudenfest <strong>und</strong> ein Verbrüderungsfest<br />
der Deutschen; auch hier wieder, wie beim Musikfest, demonstrative<br />
soziale Integration, teilweise auch der jüdischen Mitbürger (gemeinsamer Besuch<br />
von Kirche oder Synagoge). Bruderküsse, Tränen, „ein Fest der Herzen“ schrieb<br />
ein Beobachter. Dabei viel germanisches Pathos, Eichenlaubkränze etc. Die<br />
politische Stoßrichtung war 1814 gegen Napoleon <strong>und</strong> Frankreich orientiert.<br />
Politische Forderungen für die nachnapoleonische Ordnung gab es nicht.<br />
Erst als sich nach dem Wiener Kongress die politische Ernüchterung über die<br />
nicht eingelösten politischen Versprechungen breitmachte, entstanden oppositionelle<br />
Bewegungen, die vor allem in folgenden Zeiträumen florierten: 1815 bis 1819<br />
(bis zu den Karlsbader Beschlüssen), 1830 bis 1847 (sog. Vormärz) <strong>und</strong> in den<br />
1860er Jahren bis <strong>zur</strong> Reichsgründung. Je stärker Verbot <strong>und</strong> Zensur walteten,<br />
desto mehr konzentrierten sich die Bewegungen in Vereinen <strong>und</strong> feierten ihre<br />
„Volksfeste“, da kein politisches Versammlungsrecht existierte. Politische<br />
Forderungen waren: Presse- <strong>und</strong> Meinungsfreiheit, Rechtsstaat <strong>und</strong> verfassungsmäßig<br />
garantiertes politisches Mitspracherecht des Volks.<br />
Der Ursprung der Männergesangbewegung lag – wie der der Musikfeste – in der<br />
Schweiz, bei dem Komponisten, Musikpädagogen, -publizisten <strong>und</strong> –verleger Hans<br />
Georg Nägeli. Von dort verbreiteten sie sich über Süddeutschland (Württemberg)<br />
allmählich im ganzen deutschsprachigen Raum <strong>und</strong> verdrängte im Norden die<br />
stärker exklusiven Liedertafeln. Die Männergesangvereine kannten gr<strong>und</strong>sätzlich<br />
keine Aufnahmebeschränkung (außer der des Geschlechts); auch passive Mitglieder<br />
wurden geduldet. Erst 1843 wurde der Wiener Männergesangverein gegründet; die<br />
Zensurbehörden verlangten, dass er alle Lieder, die öffentlich aufgeführt werden<br />
sollten, vorher vorlegte; der Briefwechsel mit anderen Vereinen war untersagt.<br />
Hans Georg Nägeli über den Männergesang<br />
„Der Charakter des Chorgesangs, als immer zugleich wirkliche <strong>und</strong> symbolische<br />
Darstellung des Volkes <strong>und</strong> des Volkslebens soll immer großartig sein, <strong>und</strong> die<br />
Großartigkeit, ja die wahre wirkliche Größe […] muß bei starker Besetzung<br />
unfehlbar mächtig hervortreten.“ Und: „wenn irgendwo, statt vierzig, vierh<strong>und</strong>ert<br />
Sänger zumal unsere Chöre ausführen, so dürfen wir (uns) eine nicht bloß<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 9
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
mathematisch berechnet verstärkte Wirkung versprechen“, denn es liege „schon in<br />
der Natur der Sache, daß man, wo eine also druch Kunst veredelte Volksstimme<br />
erschallt, auch die Stimme eines veredelten Volks zu hören glaubt.“<br />
Hans Georg Nägeli, Gesangbildungslehre für den Männerchor, 1817<br />
Zu den „politischen“ Liedern gehörte etwa „Was ist des Deutschen Vaterland“<br />
(Text von Ernst Moritz Arndt, Musik von Gustav Reichardt), „Lützows wilde<br />
Jagd“ (Text Theodor Körner, Musik Carl Maria von Weber), das Deutschlandlied<br />
(die heutige deutsche Nationalhymne, Text August Heinrich Hoffmann v.<br />
Fallersleben, Musik Joseph Haydn).<br />
Typischer Ablauf eines Sängerfests: 1. Teil fand in einer Kirche oder einem<br />
sonstigen großen Raum statt (auch hier wurden hölzerne Festhallen gezimmert),<br />
alle singen vierstimmige geistliche <strong>und</strong> weltliche Lieder <strong>und</strong> es werden – durchaus<br />
patriotische – Reden gehalten. 2. Teil im Freien (Gasthausgarten, Gartenanlage),<br />
hier werden ausschließlich patriotische oder volkstümliche Lieder gesungen; ferner<br />
wird gefeiert, Trinksprüche etc. Festmahl <strong>und</strong> Festumzug (gern mit weißgekleideten<br />
Ehrenjungfrauen = ansehnliche Bürgertöchter) kommen hinzu, dazu auch<br />
Festschmuck, wieder das beliebte Eichenlaub, immer wieder auch die schwarz-rotgoldene<br />
Fahne. Obwohl sie der Deutsche B<strong>und</strong>estag im Juli 1832 verboten hatte,<br />
wurde sie zumindest in den 1840er Jahren gerne geführt. Nicht obligatorisch waren<br />
Empfänge der auswärtigen Vereinssänger, Feuerwerke, Bälle etc. Viele der<br />
Rahmenbedingungen wurden auch von den Turnern bei ihren Festen<br />
übernommen; bei diesen, die von Ernst Ludwig Jahn („Turnvater Jahn“) initiiert<br />
worden waren, standen das öffentliche Schauturnen im Freien <strong>und</strong> die Wettkämpfe<br />
im Mittelpunkt, aber auch hier wurden patriotische Lieder gesungen, oft noch<br />
drastischer politische, also riskante Lieder, <strong>und</strong> Reden gehalten, <strong>und</strong> auch teilweise<br />
demokratisch-republikanische <strong>und</strong> sozialrevolutionäre Ziele formuliert. Freiheit,<br />
Gleichheit, Brüderlichkeit beim Wort genommen, scheinbar bis hin zu einer<br />
materiellen Umverteilung (siehe die Rede des Fabrikarbeiters Hoffmann auf der<br />
nächsten Seite). Hin <strong>und</strong> wieder nahmen auch Turner an Sängerfesten teil <strong>und</strong><br />
umgekehrt.<br />
Am Vorabend der 48er-Revolution existierten vermutlich mehr als 1100 Männer-<br />
Gesangvereine mit mindestens 100 000 Mitgliedern in Deutschland. Dazu kamen<br />
die Hörer, meist mehrere 1000, beim Liederfest in Schleswig sogar 14 000 nicht<br />
singende Teilnehmer. Die Sängerfeste wurden regional, tendenziell sogar<br />
überregional gefeiert. Ab 1843 gab es auch hier Sängerbünde, d. h. die Region<br />
übergreifende Vereinigungen verschiedener Gesangvereine. 1845, 1846, 1847<br />
wurden dann explizit „Deutsche Sängerfeste“ gefeiert: in Würzburg, Köln <strong>und</strong><br />
Lübeck. In den 60er Jahren gab es noch einmal ein Aufflammen des Nationalfests,<br />
etwa im Deutschen Sängerfest in Dresden 1865. Leitender Gedanke der dort zu<br />
hörenden Reden war, dass eine deutsche Einigung durch das Volk, nicht von oben<br />
kommen müsse. Durch die von Bismarck gegen solche Bestrebungen<br />
durchgesetzte Reichsgründung (eben „von oben“) wurden die Nationalfeste<br />
obsolet.<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 10
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Rede des Fabrikarbeiters Hoffmann<br />
beim Heidelberger Turnerfest am 17. Juni 1847<br />
„Bürger, Mitstreiter, Kampfgenossen! Das Proletariat spricht durch mich; ich habe<br />
nicht viele Worte, ich habe nur zwei Hände, um die Tyrannen, um die Aristokraten<br />
zu würgen; ich habe siedendes Blut <strong>und</strong>vbei Gott, Muth <strong>und</strong> That, wenn auch nicht<br />
die Überredung der Sprache, ich sehe da hier viele Stände vereinigt. Bürger! Stände!<br />
Was sind Stände? Gleichheit, Freiheit! Das ist die Losung der Zeit, <strong>und</strong> jene reichen<br />
Stolzen, jene räuberischen Wucherer […] sitzen auf weichen Stühlen, während wir<br />
vor Hunger verschmachten. Drum weg mit den Ständen, es giebt nur ein [sic]<br />
Stand: das Volk; es giebt nur ein Recht, nur ein Gesetz, das ist wieder das Volk, es<br />
giebt nur etwas, was vom Urbeginn da war, das ist […] das Volk <strong>und</strong> das ist stark<br />
<strong>und</strong> fürchtet sich nicht.“ Und er schloss: „Ich sehe da viele studirte Herren, aber<br />
reicht nur dem simpeln Arbeitsmann die Hand, ihr Herrn, <strong>und</strong> ihr werdet sehen,<br />
was er vermag. Das Volk hat in Frankreich die Aristokraten geköpft <strong>und</strong> es ist mit<br />
allen Soldaten fertig geworden; wir können das auch! Drum ein Losungswort für<br />
uns alle! Tod der Tyranney <strong>und</strong> Freiheit <strong>und</strong> Gleichheit!“<br />
Literatur: Düding<br />
4. Intimität <strong>und</strong> Massenöffentlichkeit (3): Privates Musizieren<br />
Ideal <strong>und</strong> Wirklichkeit in der Hausmusik<br />
1855 plädierte Wilhelm Heinrich Riehl in seiner Liederpublikation Hausmusik<br />
gegen die schalen Freuden der „blasirten musikalischen grossen Welt“ für eine<br />
„einfache <strong>und</strong> ehrliche Musik“ <strong>zur</strong> „Freude <strong>und</strong> Erbauung“ in den „heiligen<br />
Räumen des Hauses, um wieder rein <strong>und</strong> züchtig zu werden“. Riehls einflussreicher<br />
Begriff von Hausmusik ist aber ein ideologisches Konstrukt, eine Fiktion <strong>zur</strong><br />
Beförderung einer patriarchalischen Vorstellung von häuslicher Ordnung.<br />
Was also ist Hausmusik? Sie ist zugleich Gattung <strong>und</strong> Musizierform – vereint<br />
musikalische <strong>und</strong> soziale Ansprüche. Sie ist verknüpft mit der Entwicklung des<br />
bürgerlichen Wohnwesens, das immer stärker einen Salon zum Empfang von<br />
Gästen ausbildete, in dessen Mittelpunkt das unentbehrliche Möbel des Klaviers<br />
stand. 1797 heißt es bei Joseph Rohrer, Neuestes Gemählde von Wien: „Bey jeder<br />
gebildeten Familie findet sich ein Fortepiano. Ob aber die Unterweisung der<br />
weiblichen Jugend in der Musik nicht einen beinahe zu grossen Raum in der<br />
gewöhnlichen Erziehung einnimmt, ist eine andere Frage […].“ Die Betonung liegt<br />
auf der „gebildeten Familie“, also der Schicht bildungsbürgerlicher Berufe<br />
(Akademiker, Beamten, Ärzte, Juristen, Lehrer etc.), <strong>und</strong> der „weiblichen Jugend“:<br />
Klavierspiel war Frauensache, die Männer spielten eher Streichinstrumente. Das<br />
Klavier als unbewegliches Möbel passt hervorragend zu der ans Haus geb<strong>und</strong>enen<br />
Rolle der Frau bzw. höheren Tochter.<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 11
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Hausmusik vereint aber mit gesellschaftlichen Repräsentationsbedürfnissen auch<br />
sehr prosaische Absichten: Die höhere Tochter soll durch ihr Klavierspielen eine<br />
„gute Partie“ finden, der sozial niedriggestellte Universitätsabsolvent soll sich durch<br />
(auch musikalische) „Bildung“ für höhere Posten <strong>und</strong> Aufgaben qualifizieren (siehe<br />
Zitat nächste Seite).<br />
Spott über Hausmusik <strong>und</strong> Bildungsdünkel in der Zeitschrift Cäcilia (1825):<br />
„Doch wir […] gehen auf eine weitere Triebfeder der musikalischen Ausbildung<br />
über, nämich auf die Galanterie. Dass wir dabei mit unsern verehrten Lesern in<br />
vornehme Gesellschaft kommen, die uns mit den Lorgnetten mustert, versteht sich<br />
von selbst […]. Hören wir ja doch sogleich am Eingange des Salon die<br />
überirdischen Töne des meisterlichen Pianoforte à quatre chordes, <strong>und</strong> erblicken die<br />
schlanke Nymphengestalt der kehl- <strong>und</strong> fingerfertigen Sängerin […]! Frage man sie<br />
nur, warum sie musikalisch sey, so wird sie, nach einer langen Pause hysterischer<br />
Verw<strong>und</strong>erung, merken lassen, sie folge eben dem guten Tone, sey ein Fräulein der<br />
bester[n] Erziehung, <strong>und</strong> der Maestro müsse sich eine Ehre daraus machen, wenn sie<br />
<strong>und</strong> Leute ihres Gleichen seine Cavatinen nachtigallen.<br />
Es zeigt überhaupt eine eminente Meisterschaft in dem Kapitel der Lebensklugheit,<br />
jede Sache vielfach zu benützen, <strong>und</strong> wie könnte man in Abrede stellen, dass in<br />
dieser Hinsicht heutzutage die Musik ein in der menschlichen Ökonomie allgemein<br />
brauchbares Hausmittelchen ist, das bald den vermissten Hymen [der Hochzeitsgott]<br />
bei den Haaren herzuziehen, bald dem nonum in annum bedrückten Supplikanten<br />
[d. h. dem schon seit neun Jahren sich um einen Posten Bewerbenden] Amt <strong>und</strong> Pfründe zu<br />
verschaffen weiss!<br />
Aus diesen <strong>und</strong> ähnlichen Gründen <strong>und</strong> ganz von Rechtswegen hat sich daher die<br />
Musik selbst dem Tone der Welt fügen müssen, <strong>und</strong> es gibt kein besseres Zeichen,<br />
dass man mit dem Zeitgeiste fortgeschritten sey, als Musique à la mode zu schreiben<br />
oder zu exequiren.“<br />
Dieser Prätention zufolge ist das im Haus gepflegte Repertoire oft äußerst trivial:<br />
Lieder, Walzer <strong>und</strong> andere Tänze, Variationen, Etüden, Potpourris … . Ein etwas<br />
späteres Beispiel für einen „Modekomponisten“, der auch als Virtuose für leicht<br />
zugängliche Musik sorgt, ist der von Robert Schumann immer wieder attackierte<br />
Henri Herz. Der mit dem Schlagwort vom musikalischen „Biedermeier“ assoziierte<br />
Vorstellungskreis von „gemütlicher“ Tanzmusik <strong>und</strong> locker-harmloser Melodienfolge<br />
hat in dieser frühbürgerlichen Kultur seine soziale Gr<strong>und</strong>lage. Der in der<br />
<strong>Vorlesung</strong> zitierte Text von E. T. A. Hoffmann aus den Kreisleriana führt die<br />
ganzen Unseligkeiten des frühen bürgerlichen Hausmusikwesens in Form einer<br />
überspitzten Karikatur vor. Dass es auch ernsthafte <strong>und</strong> ernstzunehmende Formen<br />
von Hausmusik gegeben hat, steht außer Frage.<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 12
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Hausmusik zwischen Privatheit <strong>und</strong> Öffentlichkeit<br />
Hausmusik scheint die <strong>private</strong> Musik schlechthin. Während die Musik- <strong>und</strong><br />
Sängerfeste nicht nur öffentliche Veranstaltungen sind, sondern auch nach<br />
publizistischer Öffentlichkeit, musikalischer Berichterstattung, Resonanz beim<br />
Publikum usw. verlangen, findet die Hausmusik in den eigenen vier Wänden statt.<br />
Um etwas darüber zu erfahren, sind wir auf die Berichte in der Presse angewiesen,<br />
die oft ihre eigenen parteiischen, polemischen Meinungen vertreten, auf ebenfalls<br />
<strong>zur</strong> Überspitzung neigende literarische Texte (wie E. T. A. Hoffmann) oder auf<br />
<strong>private</strong> Zeugnisse.<br />
Aber es gibt auch Hausmusik, die eine eigentümliche Stellung zwischen Privatheit<br />
<strong>und</strong> Öffentlichkeit einnimmt. Zwei Beispiele dafür haben wir in der <strong>Vorlesung</strong><br />
erörtert:<br />
– die „Liebhaberkonzerte“ im Wiener Schottenhof zwischen 1815 <strong>und</strong> 1818, die<br />
eigentlich aus dem <strong>private</strong>n Quartettspiel der Familie Schubert entstanden waren,<br />
zu denen sich immer mehr „Dilettanten“ gesellten, bis zuletzt ein kleines Orchester<br />
beisammen war – respektable 35 (sämtlich männliche) Mitglieder, darunter nur<br />
wenige professionelle Musiker, die meisten gehörten „dem Handlungs-, Gewerbs-<br />
oder minderen Beamtenstande an“ (Leopold von Sonnleithner). Wir haben<br />
erörtert, wie sich in Schuberts für dieses Ensemble komponierten Symphonie Nr. 5<br />
die klassischen Vorbilder Haydn <strong>und</strong> Mozart in einer „biedermeierlichen“ Variante<br />
widerspiegeln, die die kontrapunktischen bzw. motivisch-thematischen Verfahren<br />
der Klassiker glättet <strong>und</strong> ihre leichter konsumierbaren Aspekte kultiviert.<br />
– die „Sonntagsmusiken“ bei der Familie Mendelssohn in Berlin, die in den<br />
1820er Jahren vor allem in der Leipziger Straße wohl bis zu 150 Personen<br />
versammelten, darunter Wissenschaftler, Politiker <strong>und</strong> Künstler des Vormärz-<br />
Berlin, <strong>und</strong> die sich auch durch ihre Konzentration auf ernstes Repertoire <strong>und</strong> ihr<br />
Augenmerk auf Publikumsdisziplin entschieden von der geselligen Anlage der<br />
Salons unterschieden, wie sie vielerorts <strong>und</strong> eben auch bei den Mendelssohns<br />
gepflegt wurden. Obwohl der ernste Kunstanspruch der Sonntagsmusiken sie<br />
durchaus etwa Felix Mendelssohn Bartholdys späteren Gewandhauskonzerten<br />
verwandt erscheinen lässt, der weite Personenkreis durchaus einen Großteil des<br />
gebildeten Berlin umfasste, waren sie doch, einer Äußerung von Lea Mendelssohn<br />
vom Mai 1823 nach zu schließen, bewusst nicht-öffentlich gehalten: „So ließ sichs<br />
auch ein dummer Hesel einfallen, unsrer Morgenkoncerte öffentlich zu erwähnen,<br />
eine unerhörte indiscrétion, da sie durchaus Privatgesellschaft sind.“<br />
Wie man sieht, gibt es zwischen den scheinbar so gegensätzlichen Begriffen<br />
„privat“ <strong>und</strong> „öffentlich“ eine Reihe von Zwischenstufen: unserer Terminologie<br />
folgend etwa Geselligkeit, Gesellschaft, Assoziation (vgl. Abschnitt 1). Unter<br />
Geselligkeit kann man etwa die „Schubertiaden“ verstehen, eine Gesellschaft<br />
entspricht dem Pariser Salon <strong>zur</strong> Zeit Chopins, wo die Besucher oft alles andere als<br />
gute Fre<strong>und</strong>e waren, aber auch die Mendelssohnschen Sonntagskonzerte. Weitere<br />
Aspekte, die <strong>zur</strong> differenzierten Betrachtung dieser Phänomene dienen können,<br />
sind:<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 13
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
– kommen die musikalischen Darbietungen spontan zustande, oder sind sie<br />
geplant? Entstehen sie aus einer Stimmung heraus, oder verdanken sie sich dem<br />
bewussten Interesse an einem konkreten Werk?<br />
– sind alle am Musizieren beteiligt („Umgangsmusik“) oder gibt es eine Trennung<br />
zwischen Musikern <strong>und</strong> Publikum („Darbietungsmusik“)? Dies konnte sich, wie<br />
Hoffmanns Erzählung zeigt, auch mittendrin ändern.<br />
– wird eher das Moment des Intimen oder Fre<strong>und</strong>schaftlichen betont oder das<br />
Gesellige <strong>und</strong> Repräsentative?<br />
Literatur: Fellinger, Hanson, Salmen, Klein<br />
5. Musikgesellschaften, Musikvereine<br />
Definition<br />
Das Phänomen des Musikvereins war, namentlich im deutschsprachigen Raum,<br />
ein weit verbreitetes. (Es gab mindestens 23 Institutionen zwischen Zürich <strong>und</strong><br />
Berlin, zwischen Hamburg <strong>und</strong> Ljubljana alias Laibach, die ähnlich organisiert<br />
waren wie der Wiener Musikverein.)<br />
Was sind Musikvereine? „[E]ine bürgerliche Vereinigung <strong>zur</strong> regelmässigen<br />
Ausübung von Vokal- <strong>und</strong> Instrumentalmusik“. (Heine 9) Und genauer: „Eine<br />
Musikgesellschaft (Musikverein) ist i. d. R. eine bürgerliche Institution, die auf<br />
<strong>private</strong>r Ebene initiiert wurde, die in der Regel ebenfalls auf <strong>private</strong>r Ebene<br />
finanziert wird, sich der orchestralen Musik widmet <strong>und</strong> regelmässig Konzerte<br />
organisiert. Es handelt sich dabei zum grossen Teil um Abonnements- oder<br />
Subskriptionskonzerte, in denen Vokal- <strong>und</strong> Instrumentalmusik aufgeführt werden.<br />
Der Musikverein entsteht stets durch Zusammenschluss mehrerer Personen. Er<br />
besteht aus einem Vorstand – der für die Regelung der Finanzierung, die<br />
Organisation des Vereins <strong>und</strong> Archivierung von Akten zuständig ist <strong>und</strong> sich in<br />
regelmässigen Abständen trifft – <strong>und</strong> weiteren Mitgliedern. Der Musikverein gibt<br />
sich eigene Regeln/Gesetze, welche, gedruckt oder handschriftlich, in Statuten<br />
(Satzungen) festgehalten <strong>und</strong> allen Mitgliedern mitgeteilt werden. Die<br />
Vorstandsmitglieder wie auch die übrigen Mitglieder des Vereins bezahlen für ihre<br />
Mitgliedschaft eine Gebühr in regelmässigen Zeitabständen (meist monatlich oder<br />
vierteljährlich) <strong>und</strong> können dadurch, im Gegensatz zu Nichtmitgliedern, an allen<br />
(also auch nicht‐öffentlichen) Veranstaltungen des Vereins teilnehmen.“ (Heine<br />
55)<br />
Merkmale dieser Art von Musikvereinen sind also generell:<br />
1. die Organisationsform. Das Vereinswesen gehörte in der zweiten Hälfte des 18.<br />
<strong>und</strong> im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert zu den ganz heftig blühenden Formen bürgerlichen<br />
Wesens. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen handelte es sich um einen<br />
freien Zusammenschluss Gleichgesinnter – dies im Gegensatz zu älteren Formen<br />
der Korporation wie etwa der Handwerkszünfte, wo man es sich nicht aussuchen<br />
konnte. Dem Verein konnte man beitreten oder auch wieder austreten. Hier<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 14
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
wurden auch Fragen des Rangs ausgeklammert, selbst dort, wo in Residenzstädten<br />
Angehörige des Adels teilnahmen. Es sollte, so heißt es in einem Dokument, allein<br />
das „Streben gebildeter Männer“ zählen (Männer!), „aus den engen Schranken des<br />
eigenen Bewußtseins herauszutreten <strong>und</strong> sich in geistiger Weise an dem<br />
mannigfaltigen Leben der Völker zu beteiligen durch Lektüre <strong>und</strong> mündlichen<br />
Austausch der Ideen“. Dennoch bleiben die Vereine in sich geschlossen, sie<br />
verbinden mit den Worten Hans-Ulrich Wehlers „Binnenegalität mit<br />
Außenexklusivität“. Wichtig ist, dass durch die Vereinsstruktur eine gewisse<br />
Stetigkeit <strong>und</strong> Kontinuität der jeweiligen musikalischen Institution erreicht wurde,<br />
wie sie bei einem Fürsten oder auch der sonstigen Initiative eines Einzelnen nicht<br />
erreicht werden konnte.<br />
2. Diese Musikvereine sind Dilettantenvereine. Wir haben schon mehrfach<br />
betont, dass in dem Wort, wie es damals gebraucht wurde, nichts Verächtliches<br />
liegt. Der diletto, das Vergnügen, Wohlgefallen, ja die Liebe, das steckt darin. Die<br />
Dilettantenvereine aus musikalisch gebildeten Bürgern <strong>und</strong> Adeligen konnten<br />
musikalisch hohe Qualitäten erreichen. Nur wenige Berufsmusiker – das heißt,<br />
solche, die mit ihrem Musizieren ihren Lebensunterhalt bestritten – waren darunter.<br />
Zu dieser Regel sind bisher (im deutschen Sprachraum) nur drei Ausnahmen<br />
bekannt, deren Orchester <strong>zur</strong> Gänze oder großteils aus Berufsmusikern bestanden:<br />
die nach dem Vorbild der London Philharmonic Society gegründete Hamburgische<br />
„Philharmonische Gesellschaft“, das Leipziger Gewandhauskonzert <strong>und</strong> das<br />
Bremer Privatkonzert. Die vergleichsweise schwache Professionalisierung der<br />
Orchester ist eine Folge der kleinen Städte. Wien wäre eine der wenigen<br />
Ausnahmen gewesen, aber gerade in Wien hat sich ein öffentliches Konzert- <strong>und</strong><br />
Orchesterwesen lange im dilettantischen Raum gehalten.<br />
Während in Hamburg, Leipzig <strong>und</strong> Bremen die Mitglieder des örtlichen<br />
Musikvereins somit gleichsam Abonnenten im heutigen Sinn sind, zahlende<br />
Zuhörer, sind an den übrigen, das heißt den meisten Orten die Mitglieder zugleich<br />
Musiker. Zuhörer sind ihre Verwandten <strong>und</strong> durchreisende Fremde.<br />
3. Denn: Die Konzerte, <strong>und</strong> auch das ist eine Folge der Organisationsform<br />
Verein, sind nicht öffentlich. Sie sind prinzipiell nur für Vereinsmitglieder <strong>und</strong><br />
deren Anhang zugänglich. Oft werden sie auch nicht als Konzerte, sondern als<br />
„Übungen“ des Vereins deklariert. Auch hier verbindet sich, um nochmals Wehler<br />
zu zitieren, „Binnenegalität mit Außenexklusivität“. Auch hier bedeutet<br />
Öffentlichkeit zunächst noch nicht oder zumindest nicht ausschließlich<br />
schrankenlose (d. h. nur kommerziell geregelte) Zugänglichkeit für alle. Und das gilt<br />
im Gr<strong>und</strong>e für die gesamte bürgerliche Schicht der Zeit <strong>und</strong> gilt vielleicht für jede<br />
gesellschaftliche Schicht: nach innen gleich, nach außen abgeschlossen.<br />
Zur Entstehungsgeschichte des Wiener Musikvereins<br />
Einige heute noch existierende Musikvereine oder Konzertreihen gehen auf das<br />
frühe 19. Jahrh<strong>und</strong>ert <strong>zur</strong>ück: die Allgemeine Musik-Gesellschaft in Zürich (deren<br />
praktische Aktivitäten heute von der Tonhallegesellschaft ausgeübt werden), die<br />
Philharmonische Gesellschaft in Hamburg, die Gewandhaus-Konzerte in Leipzig<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 15
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
(die sogar schon seit 1781 existieren) <strong>und</strong> die Gesellschaft der Musikfre<strong>und</strong>e in<br />
Wien. Anhand letzterer lässt sich erörtern, was eine Musikgesellschaft im 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert ist <strong>und</strong> wie sie sich unterscheidet von unserem heutigen Verständnis.<br />
Wien ist allerdings in vieler Hinsicht ein Sonderfall – als Residenzstadt verfügte es<br />
über ein reiches Musikleben, zugleich war aber das öffentliche Konzertwesen<br />
extrem schwach ausgeprägt. Von den Tagen Mozarts bis ins frühe 19. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
gab es immer wieder Anläufe, feste Reihen von Subskriptionskonzerten zu<br />
installieren, darunter die Konzerte im Augarten <strong>und</strong> in der Mehlgrube, an denen<br />
Mozart mitwirkte, aber Stabilität erlangte keines von ihnen. Kurz vor der<br />
Gründung der Gesellschaft der Musikfre<strong>und</strong>e gab es die vergleichsweise kurzlebige<br />
Institution der „Adeligen Liebhaberkonzerte“ (1807–1808), bei denen der Bankier<br />
von Herring mit dem Fürsten Trauttmannsdorff <strong>und</strong> dem Musikgrafen Moritz<br />
Dietrichstein zusammenwirkte. Auf der einen Seite also ein Vertreter des neuen<br />
Geldadels, auf der anderen Seite der übrigens einflussreiche Bekleider eines uralten<br />
<strong>und</strong> längst überholten Amts der österreichischen Monarchie. Das sollte auch<br />
typisch werden für die Gesellschaft der Musikfre<strong>und</strong>e.<br />
Sie ging hervor aus der Tätigkeit einer 1810 gegründeten „Gesellschaft adeliger<br />
Frauen <strong>zur</strong> Beförderung des Guten <strong>und</strong> Nützlichen“, in der sich zwölf Frauen aus<br />
dem Geburts- <strong>und</strong> nobilitierten Adel zusammenfanden, unter der Leitung der<br />
Fürstin Karoline von Lobkowitz. Gegründet worden war sie durch Joseph von<br />
Sonnleithner, ihren „perpetuirlichen Secretär“ <strong>und</strong> eine zentrale Figur des<br />
Musiklebens in Wien (u. a. Musikhistoriker <strong>und</strong> Librettist von Beethovens Leonore,<br />
der Erstfassung des Fidelio). Für die Kriegsopfer vor allem der Schlachten von<br />
Aspern <strong>und</strong> Wagram, auch wohl für die Opfer des Brands von Baden, wurde 1812<br />
ein Wohltätigkeitskonzert veranstaltet, auf Initiative von Fanny Freiin von<br />
Arnstein, mit Händels „Timotheus oder Die Macht der Musik“ (also Alexander’s<br />
Feast). Sonnleithner machte nun einen Vorschlag <strong>zur</strong> Gründung einer Gesellschaft<br />
der Musikfre<strong>und</strong>e, der im Dezember 1812 umlief, aber erst Anfang 1813 vorgelegt<br />
wurde. Zum Ausschuss, der mit der Organisation beauftragt wurde, gehörten<br />
alteingessessene Adelige wie Apponyi, Moriz Graf zu Dietrichstein, Lobkowitz,<br />
aber auch Verdienstadel wie Moritz Graf von Fries, der Bankier v. Häring oder der<br />
Großhändler Johann v. Tost, Bürger wie z. B. der Beamte Vincenz Hauschka <strong>und</strong><br />
der Hofrichter des Schottenstifts Dr. Franz Theser, <strong>und</strong> schließlich als prof.<br />
Musiker Antonio Salieri). Die endgültigen Statuten sind erst 1814 vom Kaiser<br />
approbiert worden, als Protector wurde Erzherzog Rudolph gewählt, Sekretär war<br />
Sonnleithner <strong>und</strong> blieb es bis zu seinem Tode.<br />
In die Statuten schrieb sich die Gesellschaft neben der Abhaltung von Konzerten<br />
„die Emporbringung der Musik in allen ihren Zweigen“. Also:<br />
– Aufbau eines Konservatoriums.<br />
– Herausgabe einer musikalischen Zeitschrift.<br />
– Aufbau einer musikalischen Bibliothek, eines Archivs, einer Gemälde- <strong>und</strong> einer<br />
Musikinstrumentensammlung.<br />
Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts wandelte sich der Musikverein<br />
von einer Dilettantenvereinigung zu einem Konzertveranstalter <strong>und</strong> die<br />
Musikfre<strong>und</strong>e zu einem passiven Publikum. 1851 revidiert die Gesellschaft ihre<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 16
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Statuten, wobei nicht nur die Organisation weniger schwerfällig, effektiver gemacht<br />
wird, sondern auch bestimmt wird, dass die Konzerte in Zukunft nicht mehr von<br />
Dilettanten, sondern von Künstlern zu bestreiten sind, um „dem Vordrängen des<br />
bloßen Dilettantentums“ Einhalt zu gebieten – also jenes Dilettantentums, das die<br />
Gesellschaft eigentlich erst begründet hatte.<br />
Literatur: Heine, Perger, Pohl, zum Vereinswesen Wehler 317–325<br />
6. Konzertformen zwischen „musikalischem Idealismus“<br />
<strong>und</strong> Unterhaltung<br />
Die frühen Konzerte der Gesellschaft für Musikfre<strong>und</strong>e zeigen eine Tendenz zum<br />
„bunten Programm“, zum „Mischkulanz“-Konzert, das Vokal- <strong>und</strong> Instrumentalmusik<br />
<strong>und</strong> die unterschiedlichsten Besetzungen, Formen <strong>und</strong> Gattungen durcheinandermischt.<br />
Dagegen ist in den Aufführungen des Wiener Concert spirituel<br />
eine Konzentration auf „große“ <strong>und</strong> „bedeutende“ Werke deutlich spürbar Das<br />
hängt zusammen mit einer Bewegung, die William Weber „musical idealism“<br />
genannt hat. Dieser musikalische Idealismus setzte auf „große Werke“ <strong>und</strong><br />
„bedeutende Komponisten“. Er trug entscheidend dazu bei, dass „alte“ Musik im<br />
Repertoire verblieb, ja im Falle Bachs überhaupt erst in dieses Repertoire Eingang<br />
fand. So um 1830, 1835 verstand sich das durchaus nicht von selbst.<br />
Einem solchen musikalischen Idealismus waren beispielsweise auch die Konzerte<br />
des Pariser Conservatoire (ab 1828) oder der Wiener Philharmoniker (ab 1842)<br />
verpflichtet. Das Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire unter<br />
François Antoine Habeneck hat bekanntlich als möglicherweise erstes Orchester<br />
für adäquate Aufführungen von Beethovens Symphonien gesorgt. Wesentlich war<br />
auch der Einsatz von Virtuosen wie Franz Liszt oder Clara Schumann. Liszt war<br />
wohl der erste Pianist, der allein ganze Konzerte bestritt, <strong>und</strong> dabei spielte er<br />
immer wieder auch unpopuläres Repertoire wie Beethoven oder Schumann.<br />
Mit dieser Bewegung des „musikalischen Idealismus“ hing es auch zusammen,<br />
dass das Publikum, über dessen eifrige Gespräche während der Konzerte viele<br />
Beobachter um 1800 sich beklagten, immer disziplinierter <strong>und</strong> schweigsamer<br />
wurde.<br />
Eine Satire auf schwatzendes Konzertpublikum<br />
„Wer du aber auch bist, der du dich ärgerst, Kenner oder Dilettant, bescheide dich<br />
doch endlich einmal, daß man hier nicht der Musik wegen zusammenkommt. …<br />
Wir kommen allein der Pause wegen hierher <strong>und</strong> zwar nicht wir Damen allein,<br />
sondern auch der größte Teil der Herren. Man hat sich öfters die liebe lange Woche<br />
nicht gesehen, man hat sich allerhand zu sagen; aber zum größten Verdruß gönnt<br />
man uns dazu nur ½ St<strong>und</strong>e <strong>und</strong> das Gefiedel geht wieder an, indem wir in der<br />
wichtigsten Unterhaltung begriffen sind. Und sollten wir uns darum wohl<br />
Stillschweigen gebieten? Wir sind es ja, die das Konzert erhalten, das Abonnement<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 17
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
der sog. Kenner würde kaum hinreichen, den Musikern das Kollophonium zu<br />
bezahlen.“ Leipzig im Profil : Ein Taschenwörterbuch für Einheimische <strong>und</strong> Fremde, Leipzig<br />
1799<br />
Hanslick über das Schweigen der Engländer<br />
„Es wird applaudirt, wenngleich kühler als bei uns. Nicht der laute Beifall, etwas<br />
Anderes, schwer zu Definirendes ist es, was wir vermissen: der stille, inwendige<br />
Applaus der Hörer während des Stückes. Bei einem genialen Uebergang, einer<br />
ergreifenden Melodie, welch bewegtes Murmeln des Verständnisses, welch leises<br />
Wetterleuchten der Empfindung in einem deutschen Concertsaal!“ Eduard<br />
Hanslick, Aus dem Concertsaal, Wien 1870, 513 (Bericht von 1862).<br />
Gehörte der alte, vermischte Typus von Konzert – so argumentiert Weber –<br />
notwendig zu einer sehr kleinen musikalischen Gesellschaft, einer sehr dünnen<br />
Schicht von Musikliebhabern, wie sie im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert noch üblich war, <strong>und</strong> bei<br />
denen jeder Musikgeschmack befriedigt werden musste. Erst durch das Anwachsen<br />
der Bevölkerung <strong>und</strong> damit jener Schichten, die kaufkräftig genug waren, um ihre<br />
Konzertkarten zu bezahlen, kam es zu einer Ausdifferenzierung des<br />
Konzertprogramms in „ernst“ <strong>und</strong> „heiter“, später zu einer Spaltung zwischen E<br />
<strong>und</strong> U.<br />
Gleichzeitig entsteht die eigentliche Unterhaltungsmusik – Philippe Musard<br />
(1793–1859) <strong>und</strong> Louis Antoine Jullien (1812–1860) in Paris (<strong>und</strong> London) bilden<br />
hier Äquivalente zu Johann Strauß Vater in Wien. Allesamt sind sie Geiger oder<br />
Dirigenten (Jullien ist der erste Showdirigent), die mit ihrem Orchester Tanzmusik,<br />
leichte Opernouvertüren <strong>und</strong> Ähnliches aufführen. Musard <strong>und</strong> Jullien sind auch<br />
die Erfinder oder zumindest Miterfinder der Promenadenkonzerte.<br />
Die Erfindung des Ausdrucks „Unterhaltungsmusik“ (1833)<br />
Der Kritiker Adolf Bäuerle hatte in seiner „Allgemeinen Theaterzeitung“ Johann<br />
Strauß (Vater) mit Lob überschüttet <strong>und</strong> den Komponisten zu einem „Mozart der<br />
Walzer, Beethoven der Cotillons, Paganini der Galoppe“ erhoben. Dagegen legte<br />
ein gewisser Johann N. Hofzinser im „Sammler“ Protest ein: „Ein gerechter<br />
Unwille muß jeden ergreifen, der, wenn Strauß spielt, die Namen ,Kunst <strong>und</strong><br />
Künstler solcherart frivol entweihen hört. So muß auch jeder stutzen, wenn Strauß<br />
seine Kompositionen Werke nennt, die höchstens Fabrikate zu nennen sind.“<br />
Strauß sah sich genötigt, selbst in die Debatte einzugreifen <strong>und</strong> stellte klar, daß „die<br />
Unterhaltung des geneigten Publikums“ sein einziges Bestreben sei.<br />
Vater <strong>und</strong> Sohn Johann Strauß sind schließlich – in der fabrikähnlichen<br />
Arbeitsteilung der musikalischen Produktion, bei der ihre Einfälle von einer Reihe<br />
von Mitarbeitern ausgearbeitet, arrangiert, orchestriert wurden – <strong>und</strong> in der<br />
Benutzung aller Mittel der Werbung <strong>und</strong> der technischen Transport- <strong>und</strong><br />
Kommunikationsmöglichkeiten – ein Paradebeispiel für eine durchgängig<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 18
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
kommerzialisierte <strong>und</strong> medialisierte Unterhaltungsmusik (<strong>und</strong> zugleich ein Beispiel<br />
dafür, dass sich mit einem Begriff wie „kommerzielle Musik“ nicht automatisch<br />
mindere Qualität verbinden muss).<br />
Musikalischer Idealismus <strong>und</strong> musikalische Unterhaltung entstehen also etwa<br />
gleichzeitig. Was wir im Fortschreiten des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts beobachten können, ist<br />
ein Nebeneinander von Kunst <strong>und</strong> Unterhaltung, die sich immer radikaler ihre<br />
eigenen sozialen Orte <strong>und</strong> Räume schaffen. Die Musiklandschaft diversifiziert sich<br />
immer mehr, sie stellt immer mehr Widersprüche nebeneinander, <strong>und</strong> sie wird<br />
immer durchgängiger kommerzialisiert. Neben den großen Konzerthäusern des<br />
späten 19. Jahrh<strong>und</strong>erts wie dem Wiener Musikvereinsgebäude von 1870, die man<br />
auch gerne Musiktempel nannte, entstanden Orte der leichten Muse wie die<br />
Londoner Music halls oder die Pariser Café-chantants.<br />
Aber auch hier gibt es die erstaunlichsten Querverbindungen. Ein Beispiel, das<br />
wir erörtert haben, war die Bilse’sche Kapelle in Berlin, die ihren eigenen<br />
Konzertsaal unterhielt – der gleichzeitig als Restaurant diente.<br />
Gerhart Hauptmann über die Konzerte der Bilse’schen Kapelle<br />
„Wir besuchten die Bilse-Konzerte. Dort saßen die Männer hinter Bierseideln, die<br />
Frauen hinter Strickstrumpf <strong>und</strong> Kaffeetasse, Mütter brachten die Kinder mit. Aber<br />
Bilse […] hatte ein von ihm gut geschultes Orchester in der Hand. Es hatte im<br />
Reich den besten Namen. Die Banalität hörte auf, sobald der Meister den Taktstock<br />
erhob, um das Mittelstandspublikum des geräumigen Vergnüggungsetablissements<br />
mit großer Musik zu speisen. Während die Klänge rauschten, wurde der<br />
Wirtschaftsbetrieb nicht abgestellt, nur dass die Kellner, wenn sie Bier oder Speisen<br />
brachten, auf leisen Sohlen einherschritten <strong>und</strong> sich mit den Gästen nur pantomimisch<br />
verständigten. [… U]nd da wir die Konzerte nie versäumten […], machten<br />
wir hier einen unvergesslichen musikalischen Kursus durch, der einen großen<br />
Gewinn für uns alle brachte. Durch den befrackten, ordensbesternten Militärkapellmeister<br />
[hier irrte Hauptmann], der sogar den Bogenstrich seiner Geiger exakt <strong>und</strong><br />
einheitlich regelte, haben wir Haydn, Mozart, Gluck, Beethoven, Schubert, Weber,<br />
Wagner <strong>und</strong> Brahms kennengelernt.“<br />
Tatsächlich hat Wagner 1873 <strong>und</strong> 1875 Stücke aus der Götterdämmerung vorgeführt,<br />
auch Saint-Saëns <strong>und</strong> Johann Strauß haben mit der Bilse’schen Kapelle konzertiert,<br />
letzterer fand sie beim klassischen Repertoire sogar besser als bei der Tanzmusik,<br />
wie sie für gewöhnlich jeden Donnerstag erklang. Strauß sollte in prophetischer<br />
Weise recht behalten. 1882 trennten sich 50 der 56 Musiker von Bilse, nachdem<br />
man sich über die Gage für einen Sommeraufenthalt in Warschau zerstritten hatte.<br />
Das Orchester beschloss, von nun als vormals Bilse’sche Kapelle aufzutreten, <strong>und</strong><br />
organisierten sich fortan demokratisch. Sie fanden Unterstützung bei dem damals<br />
wichtigsten Konzertagenten Deutschlands, Hermann Wolff. Ein neuer Name für<br />
die wenig geglückte Formulierung fand sich auch bald, das Ensemble nannte sich<br />
nunmehr Berliner Philharmonisches Orchester. Und das sind sie bis heute<br />
geblieben.<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 19
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Literatur: Weber, Schwab, Stiftung Berliner Philharmoniker, Handlos, Knepler,<br />
Scott, Linke<br />
7. Exkurs: Klavierbau <strong>und</strong> Klavierhandel<br />
(von Ludwig Kollenz)<br />
Das Klavier war im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert eines der wichtigsten Instrumente – geradezu<br />
ein Symbol für das Bürgertum.<br />
Um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, soll hier Pierre Bourdieus Modell<br />
der Kapitale aufgeriffen werden. Er spricht von ökonomischen, kulturellem <strong>und</strong><br />
sozialem Kapital. Ersteres muß wohl nicht weiter ausgeführt werden, es handelt<br />
sich schlicht um finanzielles Kapital. Kulturelles Kapital hingegen teilt sich wieder<br />
in drei Ausprägungen:<br />
Verinnerlichtes kulturelles Kapital ist an den eigenen Körper geb<strong>und</strong>en; Bildung<br />
setzt Lernzeit voraus die man persönlich investieren muß! Es ist ein fester Bestandteil<br />
einer Person – also ein Habitus. Ein sehr hohes solches Kapital kann<br />
Seltenheitswert haben, z. B. ein Starpianist kann besonders gut Klavier spielen <strong>und</strong><br />
sich so sein Geld verdienen, da ihn viele Leute (die vielleicht auch Klavier spielen)<br />
hören wollen.<br />
Objektiviertes Kulturkapital ist an Objekte geb<strong>und</strong>en. Man kann sich ein Klavier<br />
kaufen <strong>und</strong> so ein Stück Kultur besitzen, jedoch kann man es dann noch nicht<br />
spielen. Daraus folgt, das dieses Kapital zwar übertragbar ist,aber nur im Sinn des<br />
juristischen Eigentums.<br />
Institutionalisiertes Kulturkapital folgt aus einem Problem: verinnerlichtes<br />
Kulturkapital ist an eine Person geb<strong>und</strong>en <strong>und</strong> damit den biologischen<br />
Möglichkeiten derselben unterworfen. Mit einem z. B. schulischen Titel kann dem<br />
Abhilfe geschaffen werden, da so eine Nivellierung stattfindet <strong>und</strong> eine Art<br />
„Qualitätssicherung“ eingeführt werden kann. Ein Autodidakt steht unter<br />
ständigem Beweiszwang, während ein Akademiker sich auf seinen Titel <strong>und</strong> das<br />
damit verb<strong>und</strong>ene Bildungsniveau berufen kann. Das führt natürlich auch <strong>zur</strong><br />
Möglichkeit der Wertmessung, siehe Arbeitsmarkt.<br />
Soziales Kapital ist im Prinzip das, was man heute „Networking“ nennt. Eine<br />
Person hat ein bestimmtes ökonomisches <strong>und</strong> kulturelles Kapital. Dieselbe Person<br />
kennt andere Personen, die ebenso über eine bestimmte Kapitalkapazität verfügen.<br />
Das soziale Kapital des einzelnen hängt von seinen anderen Kapitalen <strong>und</strong> der<br />
Größe seines Beziehungsnetzwerks ab, sowie der Höhe der Kapitale der anderen<br />
Personen im Netzwerk. Es wirkt wie ein Multiplikator auf die eigenen Kapitale. Ein<br />
Beispiel: Adelige kennen untereinander <strong>und</strong> haben meist auch Geld. Ein<br />
Klavierbauer hätte Interesse daran einem Adeligen ein Klavier zu verkaufen, da er<br />
vielleicht an andere weiter empfohlen wird. Er kann bei seine anderen K<strong>und</strong>en<br />
auch vorweisen wer aller bei ihm einkauft. Der Adelige wäre hier ein Träger hohen<br />
sozialen Kapitals. Mit dem Kauf eines Klavieres schließt man sich einerseits einer<br />
Gruppe an, andererseits hebt man sich von anderen ab.<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 20
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
In solchen Gruppen ist eine Delegation möglich, eine Gruppe kann also von einer<br />
oder mehreren Personen repräsentiert werden. Damit muß es natürlich Regeln<br />
geben die <strong>zur</strong> Auswahl der Repräsentanten führen <strong>und</strong> da sich Gruppen schützen<br />
wollen gegen negative Einflüsse, die das Gefüge stören könnten, auch für die<br />
Aufnahme neuer Mitglieder. Das Alles führt zum Personenkult, wo sich<br />
Gruppenmitglieder mit einer Führungsperson identifizieren.<br />
Im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert findet man also ein aufstrebendes Bürgertum, das Geld hat<br />
<strong>und</strong> dem Adel nacheifert. Der wiederum grenzt sich ab (siehe soziales Kapital <strong>und</strong><br />
Gruppenbildung). Das Bürgertum sucht Vorbilder, aber nicht im Adel, der durch<br />
sein Abgrenzen zu einer Art „Feindbild“ wird. Komponisten <strong>und</strong> Virtuosen<br />
kommen meist aus den eigenen Reihen <strong>und</strong> werden auf Gr<strong>und</strong> ihrer Fähigkeiten<br />
(siehe kulturelles Kapital) vom Adel akzeptiert <strong>und</strong> sind somit prädestiniert <strong>zur</strong><br />
Vorbildrolle. Besitzt <strong>und</strong> spielt man ein Instrument, kann man sich der Gruppe der<br />
Musizierenden anschließen <strong>und</strong> eventuell Kontakte zu Intellektuellen (zB<br />
Universitätsprofessoren) <strong>und</strong>/ oder Adeligen knüpfen, wodurch das eigene soziale<br />
Kapital steigt.<br />
Ein Klavier ist ein extrem teures Instrument <strong>und</strong> wird vom Adel gekauft, so auch<br />
vom Bürgertum, das so zeigt, was es sich leisten kann <strong>und</strong> wie gebildet es ist.<br />
Das allein würde aber noch nicht begründen, warum ausgerechnet das Klavier so<br />
wichtig wurde. Eine These geht zu den Ursprüngen des Klaviers <strong>zur</strong>ück: Das<br />
Cembalo <strong>und</strong> das Clavichord sind die Vorläufer des Klaviers <strong>und</strong> haben beide das<br />
Problem, daß sie nur wenig Dynamik besitzen. Ein Ansatz, das zu korrigieren, ist,<br />
Hämmer statt Plektren zu verwenden.<br />
Das Clavichord war im häuslichen Bereich im deutschsprachigen Raum sehr<br />
verbreitet, offenbar war Hausmusik wichtig. Die These ist, daß dies aufgr<strong>und</strong> des<br />
Klimas so ist, da man oft nicht fortgehen konnte <strong>und</strong> sich Zuhause unterhalten<br />
mußte. Dies würde erhärtet durch die Tatsache, daß Cristofori 1698 ein Cembalo<br />
mit einer Hammermechanik baute <strong>und</strong> so das Klavier erfand, jedoch es in Italien<br />
keine weitere Entwicklung für sein Instrument gab – möglicherweise, da die Oper<br />
sehr beliebt war. Anders als in Deutschland, wo es sehr bald weiter entwickelt<br />
wurde <strong>und</strong> das Clavichord ersetzte.<br />
Cristofori veröffentlichte 1711 eine Beschreibung seiner Konstruktion in<br />
Venedig, die 1725 ins Deutsche übersetzt wurde. Silbermann in Freiburg adaptierte<br />
das Konzept erfolgreich <strong>und</strong> fing an Klaviere zu bauen. Einige seiner Schüler<br />
übertrugen die Mechanik auf das Clavichord <strong>und</strong> so wurde das Tafelklavier<br />
geboren. Dasselbe kam mit Zumpe nach England, als dieser (vermutlich wegen des<br />
siebenjährigen Krieges) auswanderte. Er spezialisierte sich auf Tafelklaviere <strong>und</strong><br />
sein Name stand eine Zeit lang symbolisch für das Instrument. Bereits um 1800<br />
wurden Eisenteile im Klavierbau eingeführt um die Haltbarkeit zu erhöhen.<br />
Nanette Stein verlegte ihr Unternehmen 1794 nach dem Tod ihres Vaters nach<br />
Wien. Er hatte eine eigene Mechanik entwickelt, die Stein’sche Mechanik, bei<br />
welcher der Hammer auf der Taste sitzt <strong>und</strong> sich an einer Prellzunge abstößt, wenn<br />
die Taste durchgedrückt wird. Von den Wiener Klavierbauern weiterentwickelt,<br />
wurde aus dieser Konstruktion die „Wiener Mechanik“.<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 21
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Wesentliche Klavierbauer waren Nanette Stein (später Streicher), Walter (Mozart<br />
hatte eines seiner Kalviere), Brodmann (dessen Unternehmen von seinem Schüler<br />
Ludwig Bösendorfer 1828 übernommen wurde) <strong>und</strong> noch etliche andere.<br />
Eine Eigenheit der Wiener Klaviere waren Effektpedale, die den Klang stark<br />
verändern konnten. Diese verloren sich aber bald wieder. Alle wesentlichen<br />
Erfindungen wurden in den 1820ern <strong>und</strong> -30ern gemacht. So etwa Kapseln, die als<br />
Gelenke für die Hämmer dienten. Friedrich Hoxa wird zugeschrieben, der erste<br />
Wiener Klavierbauer gewesen zu sein, der einen Gussrahmen verwendete (1839).<br />
Da im Laufe des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts ständig mehr Lautstärke gefordert wurde <strong>und</strong><br />
sich so die Spannung der Saiten erhöhte, mußten auch die Hämmer schwerer<br />
werden. Das führte zu einem inkonsistenten Anschlag. Hinzu kommt die<br />
langsamere Repetition. Somit war der Untergang der Wiener Mechanik abzusehen.<br />
Sie hielt sich bis ins 20. Jahrh<strong>und</strong>ert, da die Monarchie hohe Zölle einhob, die<br />
einer Einfuhrsperre gleich kamen. Die Wiener Klavierbauer hatten einen<br />
handwerklichen Zugang <strong>und</strong> mit dem Untergang der Monarchie konnten sie der<br />
technisch überlegenen Konkurrenz nichts entgegen setzen <strong>und</strong> mußten (mit<br />
wenigen Ausnahmen) schließen.<br />
In England waren Braodwood <strong>und</strong> Collard die beiden größten Firmen <strong>und</strong><br />
produzierten in Manufakturen. Um ein Klavier herzustellen, gab es etwa 40<br />
Arbeitsschritte <strong>und</strong> für jedes Teil einen eigenen Arbeiter. Fast alles wurde selbst<br />
hergestellt <strong>und</strong> praktisch ohne maschinelle Hilfe. Damit war die Produktion sehr<br />
teuer, was durch veraltete Transportmethoden nicht besser wurde. Der Produktion<br />
pro Jahr war zwar hoch, aber auf die beteiligten Arbeiter aufgeteilt, ergeben sich<br />
sieben Klaviere pro Kopf pro Jahr. Damit liegt die Produktion unter der eines<br />
kleinen Handwerksbetriebes.<br />
Um 1851 gab es ca. 200 Klavierbauer in England, die meisten in London ansässig.<br />
Nicht alle waren wirklich Klavierbauer, manche kauften Klaviere <strong>und</strong> versahen sie<br />
mit eigenem Emblem.<br />
Da das Klavier in Mode war, hatten viele K<strong>und</strong>en beim Kauf keinen Durchblick,<br />
was bei der Modellvielfalt auch schwer war. Die Nachfrage für billige Klavier <strong>und</strong><br />
die hohe Gewinnspanne im Klavierhandel führten zu dubiosen Praktiken. Neue<br />
schlechte Klaviere wurden unter falschem Namen oder als second hand verkauft. Oft<br />
wurden sie auch in die Provinzen verkauft <strong>und</strong> dafür alte gute Klaviere aus den<br />
Provinzen in London verkauft.<br />
Legale Händler mußten Klaviere auf Kredit kaufen <strong>und</strong> waren damit abhängig.<br />
Die Hersteller sahen auch keinen Gr<strong>und</strong> billiger zu produzieren, da französische<br />
Klaviere nicht robust waren.<br />
Anfang des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts gab es viel Innovation in Frankreich dank Firmen<br />
wie Erard, Pape <strong>und</strong> Pleyel. Erard erfand die Mechanik mit doppelter Auslösung,<br />
baute jedoch ab den 1850ern kein neues Modell mehr. Pape erfand den<br />
Hammerfilz <strong>und</strong> Pleyel verwendete 1826 schon Gussrahmen. Wie in England war<br />
die Erzeugung auf Autonomie <strong>und</strong> Manufakturen gestützt.<br />
Bemerkenswert ist Antoine Bord, der extrem billige Klaviere herstellte, die<br />
relative robust waren, wenn auch technisch weit unterlegen. Er verkaufte sie in die<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 22
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
ganze Welt, bis sie um 1880 keine Käufer mehr fanden, weil die Entwicklung zu<br />
weit fortgeschritten war.<br />
In den 1880ern schwanden die Märkte für französische Klaviere, aber auch hier<br />
war der interne Markt, ähnlich wie in Österreich, geschützt. So gab es keine<br />
Notwendigkeit, neue Produktionsformen oder Technologien zu übernehmen.<br />
Interessant ist Herrburger-Schwander, eine Firma, die sich auf die Herstellung<br />
von kompletten Mechaniken spezialisierte. 1880 verkaufte sie 35 000 pro Jahr in die<br />
ganze Welt. Das Prinzip der geringen Produktionstiefe begann sich durchzusetzen.<br />
Nach dem Bürgerkrieg herrschten in den USA eine wachsende Nachfrage, ein<br />
geschützter Markt, sowie flexible Finanzierung vor. Import wurde unwichtig, da<br />
1861 hohe Schutzzölle eingeführt wurden. Außerdem widerstanden importierte<br />
Klaviere dem Klima nicht lang. Europäische Pianisten, die auf Tournee waren,<br />
brachten ihre eigenen Instrumente mit, jedoch mußten sie bald amerikanische<br />
verwenden, die dank Gussrahmen die Tourneen aushielten. Das führte zu<br />
Konzerttourneen, die von den Firmen organisiert wurden <strong>und</strong> so Werbung<br />
machten. Der Export war niedrig, da einerseits ein großer Binnenmarkt vorhanden<br />
war, andererseits der Transport nach Europa teuer war <strong>und</strong> vor Ort andere<br />
Klavierbauer billiger waren.<br />
Das war ein guter Boden für Steinway. Steinweg, wie die Familie ursprünglich<br />
hieß, war aus Braunschweig, der Vater ging mit seinen Söhnen (außer Grotrian <strong>und</strong><br />
Theodor) 1850 in die USA, wo sich die Firma Steinway bald zum einzigen<br />
Konkurrenten für, die den Markt dominierenden, Chickerings. Theodor 1865 nach<br />
New York in die Firma <strong>und</strong> übernahm die technische Leitung. Er galt als<br />
außergewöhnlicher Klavierbauer <strong>und</strong> pflegte Kontakte zu Wissenschaftlern wie<br />
Helmholz, mit er die Duplex- Skala entwickelte. Er führte auch den<br />
kreuzverspannten Gussrahmen ein <strong>und</strong> verbesserte Erards Mechanik.<br />
Das Marketing übernahm sein Bruder William. Er verkaufte an Adelige <strong>und</strong><br />
bekannte Musiker um für die Firma zu werben, außerdem visierte er große<br />
Ausstellungen an um die Klaviere einem großen Publikum zu zeigen.<br />
Das Steinway Modell wurde in Europa erstmals in London 1862 ausgestellt <strong>und</strong><br />
erregte Aufmerksamkeit. In Paris 1867 hatten viele Klavierbauer das Konzept<br />
bereits übernommen (mit Ausnahme der Franzosen). Auf der Wiener Ausstellung<br />
1873 hatte sich das System weitgehend durchgesetzt. Vor allem deutsche<br />
Klavierbauer hatten Steinways Innovationen schnell übernommen.<br />
Deutschland war in der ersten Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts nicht wirklich vereint,<br />
es waren im Gr<strong>und</strong>e eigene Fürstentümer. Das wirkte sich auf den Markt aus, viele<br />
Klavierbauer gingen ins Ausland, siehe Erard (urspr. Erhard), Pape, Steinway. In<br />
dieser Zeit wurden von Instrumentenbauern wie Steibelt ausländische Klaviere<br />
importiert <strong>und</strong> nachgebaut, quasi „Reverse Engineering“.<br />
Nach 1860 begann der Markt zu wachsen, wurde durch Zölle geschützt <strong>und</strong><br />
Export nahm zu. Ein Gr<strong>und</strong> dürfte die Gründung des deutschen Reiches im<br />
Spiegelsaal von Versailles (1871) gewesen sein. Fortschritt war wichtig <strong>und</strong> so<br />
wurde maschinell gefertigt <strong>und</strong> Wissenschaft genutzt. Deutsche Musik genoß hohes<br />
Ansehen im Ausland, was man geschickt ausnutzte.<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 23
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Dank der industriellen Fertigung waren deutsche Klaviere halb so teuer wie<br />
englische oder französische.<br />
Die Firmen Bechstein <strong>und</strong> Blüthner sind repräsentativ für die Entwicklung des<br />
deutschen Klavierbaus in der 2. Hälfte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts, da beide spät<br />
gegründet wurden – nämlich 1853 – <strong>und</strong> von Beginn an modern produzierten.<br />
Firmen wie Isermann bildeten sich, die nur Mechaniken baute auf hohem Niveau<br />
<strong>und</strong> diese billiger herstellen konnte als alteingesessene große Firmen. Dank<br />
Krediten konnte ein Klavierbauer praktisch alle Teile ankaufen.<br />
Das war in groben Zügen die Entwicklung des Klavieres in verschiedenen<br />
Ländern. Man kann deutlich beobachten, wie traditionelle Firmen in<br />
althergebrachten Mustern feststecken <strong>und</strong> die Zentren sich verlagern zu neuen<br />
aufsteigenden Mächten, die neue Methoden anwenden <strong>und</strong> so überlegen sind,<br />
sowohl in Preis, wie auch in Technik.<br />
Betrachtet man die technische Entwicklung, merkt man, wie ein leises Instrument<br />
immer lauter <strong>und</strong> strapazierfähiger wird. Das mag an den Pianisten gelegen haben<br />
die sich in den Klavierbau einbrachten. Henri Herz gründete seine eigene Firma<br />
<strong>und</strong> verbesserte die Erard- Mechanik mit der, nach ihm benannten, Herz-Feder, die<br />
für höhere Präzision sorgt. Kalkbrenner war Teilhaber bei Pleyel, wobei Ignaz<br />
Pleyel selbst Komponist <strong>und</strong> Verleger war. Das Verlagswesen wurde von<br />
Klavierbaufirmen weidlich genutzt um ihre Produkte „an den Mann“ zu bringen,<br />
also den Markt mit Klaviermusik zu versorgen. Pleyel hatte 1796 einen Musikverlag<br />
gegründet, der 1834 aufgelassen wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Katalog<br />
mit mehreren tausend Titeln angelegt. Erard gründete ebenso einen Musikverlag.<br />
Die Forderung nach billigen Klavieren begegnet einem auch immer wieder,<br />
ebenso wie das Verlangen der Komponisten <strong>und</strong> Pianisten, Klaviere mögen doch<br />
lauter werden. Das Klavier in seiner heutigen Form ist eine Errungenschaft des 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>erts, denn im 20. Jahrh<strong>und</strong>ert hat es sich kaum verändert. Wohin es gehen<br />
wird, darüber werden zukünftige Geschichtsforscher berichten.<br />
Literatur<br />
Hubert Henkel, Art. „Klavier“, in Ludwig Finscher (Hrsg.), MGG 2 , Bärenreiter<br />
Kassel (1996), Sach. 5, Sp. 283 – 312.<br />
Christoph Kammertöns, Art. „Pleyel“, in Ludwig Finscher (Hrsg.), MGG 2 ,<br />
Bärenreiter Kassel (2005), Pers. 13, Sp. 689 – 690.<br />
Christoph Kammertöns, Art. „Pleyel & Co.“, in Ludwig Finscher (Hrsg.), MGG 2 ,<br />
Bärenreiter Kassel (2005), Pers. 13, Sp. 694 – 696.<br />
Hans Nautsch, Art. „Kalkbrenner“, in Ludwig Finscher (Hrsg.), MGG 2 ,<br />
Bärenreiter Kassel (2003), Pers. 9, Sp 1397 – 1403.<br />
Philip R. Belt/ Maribel Meisel/ Gert Hecher, Art. „Pianoforte, I, 5: History of the<br />
Instrument: The Viennese Piano from 1800“,in Stanley Sadie (Hrsg.), Grove,<br />
Macmillan Publishers 2001, Bd. 19, S. 666 – 668.<br />
Hubert Henkel, „Einflüsse auf den Wiener Klavierbau aus Deutschland“, in<br />
Beatrix Darmstädter/ Alfons Huber/ Rudolf Hopfner (Hhrsg.), Das Wiener Klavier<br />
bis 1850, Hans Schneider Tutzing 2007, S. 115 – 119.<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 24
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Eva Szoradova, „Klavierbau <strong>und</strong> Klavierhandel in den Ungarischen Kronländern<br />
vor 1850“, in Beatrix Darmstädter/ Alfons Huber/ Rudolf Hopfner (hrsg.), Das<br />
Wiener Klavier bis 1850, Hans Schneider Tutzing 2007, S.135 – 146.<br />
Gert Hecher, „Designentwicklung <strong>und</strong> bautechnische Datierungsmöglichkeiten“,<br />
in Beatrix Darmstädter/ Alfons Huber/ Rudolf Hopfner (Hhrsg.), Das Wiener<br />
Klavier bis 1850, Hans Schneider Tutzing 2007, S. 179 – 194.<br />
Eszter Fontana, „Privilegien <strong>und</strong> Patente Wiener Klavierbauer zwischen 1820 <strong>und</strong><br />
1850“, in Beatrix Darmstädter/ Alfons Huber/ Rudolf Hopfner (Hhrsg.), Das<br />
Wiener Klavier bis 1850, Hans Schneider Tutzing 2007, S. 201 – 214.<br />
Cyril Ehrlich, The Piano A History, New York 1976/ 1990.<br />
Joseph Fischhof, Versuch einer Geschichte des Clavierbaus – Mit besonderem Hinblicke auf<br />
die Londoner Große Industrie-Ausstellung im Jahre 1851, nebst statistischen darauf bezüglichen<br />
Andeutungen, Wien 1853.<br />
Pierre Bourdieu, „Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital“, in<br />
Reinhard Kreckel (Hrsg.), Soziale Ungleichheiten, Otto Schwarz & Co. 1983 (Soziale<br />
Welt Sonderband 2), S. 183 – 198.<br />
Andreas Beurmann, Das Buch vom Klavier, Georg Olms 2007.<br />
Abkürzungen:<br />
MGG 2 = Musik in Geschichte <strong>und</strong> Gegenwart, 2. Auflage<br />
Sach = Sachteil<br />
Pers = Personenteil<br />
Grove = The New Grove Dictionary of Music and Musicians<br />
8. Musik des „Volks“, der Unterschichten,<br />
der Straßenmusikanten<br />
Den Unterschichten, die sich ein Instrument <strong>und</strong> einen Lehrer nicht leisten<br />
können, bleibt meistens nur der Gesang. Seit Johann Gottfried Herder wird dieser<br />
Gesang „Volkslied“ genannt <strong>und</strong> dem „produktiven Volksgeist“ zugeschrieben.<br />
Von dieser These ist die Forschung in den letzten Jahrzehnten weit abgerückt.<br />
Wir sprechen statt dessen vom populären Lied <strong>und</strong> lassen es offen, ob dieses von<br />
unten („aus dem Volk“) oder von oben („von den Herrschenden/den<br />
Oberschichten“) kommt. Möglich war beides. Parallel zu Herder vertraten<br />
aufklärerische Pädagogen die genau entgegengesetzte Ansicht, dass nämlich dem<br />
Volk die „richtigen“ Lieder erst beigebracht werden müssten, <strong>und</strong> zwar eben von<br />
oben.<br />
Volkslieder „von oben“ <strong>und</strong> politische Lieder<br />
„Aber freilich müßt Ihr was Hübsches <strong>und</strong> Vernünftiges singen; denn sonst würde<br />
Euch das mehr schaden, als nützen. Wenn Ihr das bisher nicht konntet: so war’s<br />
gewiß nicht Eure Schuld. Ihr konntet wenig oder nichts gescheides singen, weil Ihr<br />
nichts hattet. Ihr sangt also Eure uralten, oft abgeschmackten <strong>und</strong> sinnlosen, oft<br />
auch niedrigen <strong>und</strong> schmutzigen Lieder fort, <strong>und</strong> das brachte Euch gewiß großen<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 25
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Schaden.“ Volksliederbuch oder frohe Gesänge für Bürger <strong>und</strong> Landsleute, Vorwort, ca.<br />
1796<br />
Heute noch ein prominentes Beispiel für diese Art von verordnetem Volkslied ist<br />
Joseph Haydns in der originalen Niederschrift der Orchesterfassung ausdrücklich<br />
als „Volck’s Lied“ bezeichnetes „Gott! erhalte Franz den Kaiser“. Dieses – zum<br />
Geburtstag des Kaisers am 12. Februar 1797 – verfasste Lied wurde sogleich in<br />
zahlreichen Drucken <strong>und</strong> allen Landessprachen der Donaumonarchie verbreitet.<br />
Gedichtet wurde es von Lorenz Leopold Haschka, in Auftrag gegeben hatte es der<br />
niederösterreichische Regierungspräsident Franz Josef Graf von Saurau.<br />
Auch hier handelt es sich um eine indirekte Wirkung der Französischen<br />
Revolution, um eine „Antwort“ auf die von Claude-Joseph Rouget de L’Isle 1792<br />
gedichtete <strong>und</strong> komponierte Marseillaise. Wo diese im Text die Nation <strong>und</strong> das<br />
Blutvergießen beschwört <strong>und</strong> musikalisch einen militärisch-straffen Duktus<br />
anstimmt, ist Haydns Hymne vom Text her ein Gebet an Gott um Schutz für den<br />
Kaiser, musikalisch ebenfalls eine Art Choral oder Kirchenlied.<br />
„Volks“-Lieder <strong>zur</strong> politischen Identitätsbildung, <strong>zur</strong> Mobilisierung von Massen<br />
wurden im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert immer wieder gedichtet; bei den Sängerfesten haben wir<br />
einige Beispiele erwähnt (darunter die Umdichtung von Haydns Kaiserhymne in die<br />
Hymne „Deutschland, Deutschland über alles“ durch Hoffmann von Fallersleben),<br />
<strong>und</strong> es ließen sich zahlreiche weitere Beispiele anführen, wie explizit auf einen<br />
konkreten politischen Anlass bezogene Lieder als „Volkslieder“ bezeichnet wurden.<br />
Daneben wurde das satirische politische Lied durch Pierre-Jean de Béranger<br />
geprägt. Friedrich Engels hat 1846 davon berichtet, dass die Polizei ein Bankett von<br />
h<strong>und</strong>ertfünzig Arbeitern, das zu Ehren der Franz. Revolution gegeben werden<br />
sollte, aufgelöst habe, weil sich die Arbeiter „nicht verpflichten wollten, keine<br />
politischen Reden zu führen <strong>und</strong> keine Bérangerschen Lieder zu singen“.<br />
Etwa im letzten Drittel beginnt die sich formierende Arbeiterbewegung ebenfalls<br />
damit, Lieder für ihre Zwecke schaffen zu lassen, wobei die Texte sehr<br />
unterschiedliche Zielrichtungen oder Themensetzungen aufwiesen. Beispielsweise<br />
sind zu nennen:<br />
- das „B<strong>und</strong>eslied des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV)“ (1863,<br />
Text Georg Herwegh, Musik: Hans von Bülow unter dem Pseudonym „W.<br />
Solinger“; 1920 hat Hanns Eisler es neu vertont.).<br />
Hier finden sich die berühmten Zeilen:<br />
„Mann der Arbeit aufgewacht<br />
<strong>und</strong> erkenne Deine Macht!<br />
Alle Räder stehen still,<br />
wenn Dein starker Arm es will!“<br />
– die ebenfalls für den ADAV 1864 von Jacob Audorf geschriebene Deutsche<br />
Arbeiter-Marseillaise auf die Melodie der Marseillaise.<br />
- das „Lied der Arbeit“ (1868, Text von Josef Zapf, Musik von Josef Scheu), das<br />
erstmals 1868 bei einer Mitgliederversammlung des 1867 gegründeten Wiener<br />
Arbeiterbildungsvereins gesungen wurde.<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 26
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
- die Internationale (1871 Text: Eugène Pottier, 1888 Musik: Pierre Degeyter), die<br />
mit einem kleinen Arbeiterchor auf einer Feier der Zeitungsverkäufer in Lille<br />
uraufgeführt worden ist.<br />
Literatur: Knepler, Fuhrmann, Seidl, Lammel<br />
Volkslieder „von unten“, Musik der Unterschichten <strong>und</strong> der Straßenmusikanten<br />
Volkslieder „von unten“ sind solche, die im Volk zwar nicht entstanden, aber<br />
doch von selbst populär wurden, sich verbreiteten, mit denen sich im allgemeinen<br />
keine Zielsetzungen politischer Natur verbanden. Es geht also um die Musik des<br />
eigentlichen „Volks“, der Unterschichten, in der diese ihren Alltag reflektieren oder<br />
auch ausklammern.<br />
Diese Lieder sind in den seltensten Fällen musikalisch aufgezeichnet worden, oft<br />
wurden sie auf wechselne Melodien gesungen, wobei sich auch die Texte ständig<br />
veränderten. Erst mit der Entwicklung einer kommerziellen musikalischen<br />
Unterhaltungsliteratur wird die Überlieferung von Notentexten häufiger.<br />
Als Beispiel haben wir Berlin erörtert, weil zum Berliner Gassenhauer eine<br />
ausgezeichnete Studie von Lukas Richter vorliegt, <strong>und</strong> weil Berlin im 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert eine ungeheure Veränderung erfahren hat. Hatte sie um 1800 keine<br />
200 000 Einwohner, so waren es bei Gründung des Deutschen Kaiserreichs, 1871,<br />
schon 800 000, <strong>und</strong> kurz nach der Wende zum 20. Jahrh<strong>und</strong>ert, 1905, waren es<br />
dann schon über zwei Millionen! Diese Verzehnfachung der Einwohnerzahl<br />
innerhalb eines knappen Jahrh<strong>und</strong>erts war eine Folge der ungeheuren<br />
Industrialisierung <strong>und</strong> wirtschaftliche Entfaltung der Stadt insbesondere nach 1871.<br />
Man hat ausgerechnet, dass in den 80 Jahren von 1790 bis 1870 in Preußen etwa<br />
300 Aktiengesellschaften gegründet wurden, aber allein 1871 <strong>und</strong> 1872 in Preußen<br />
etwa 780 Aktiengesellschaften, d. h. im Durchschnitt jeden Tag eine. Der<br />
Aufschwung der Gründerzeit, finanziert auch durch die ungeheuren<br />
Reparationszahlungen des besiegten Frankreich, führte zu einem Aufschwung der<br />
Industrialisierung, der Maschinenfabriken von Borsig, der Telegraphenbauanstalt<br />
Siemens & Halske, der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft (AEG), die ungeheure<br />
Menschenmassen anlockte, vor allem die Arbeitslosen der Agrarbevölkerung aus<br />
den ostelbischen Gebieten des damaligen Deutschen Reichs. Diese Fabriks-,<br />
Industrie-, Eisenbahn-, Straßenbauarbeiter bildeten das „Proletariat“. Sie arbeiteten<br />
im allgemeinen zwölf bis sechzehn St<strong>und</strong>en täglich. Ein Arbeiter verdiente 3 ½ bis<br />
4 Taler die Woche, aber wenn er eine vier- bis fünfköpfige Familie hatte, brauchte<br />
er schon die 3 ½ Taler, um sie auch nur durchzubringen.<br />
Der Berliner Gassenhauer kann in der Vielfalt seiner Themen nicht auf den Punkt<br />
gebracht werden. Wir haben u. a. an Beispielen vorgeführt:<br />
- die polemische Entgegensetzung von „gemütlichem“ Alt- <strong>und</strong> hektisch-lärmendem<br />
Neu-Berlin<br />
- das Bedürfnis nach einer Befreiung vom Arbeitsalltag, vor allem durch Alkohol<br />
<strong>und</strong> andere Vergnügungen<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 27
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
- der parodistische Umgang mit Elementen der „Hochkultur“ (Neutextierung von<br />
preußischen Militärmärschen, Persiflage von literarischen Texten)<br />
- gelegentliche politische Spottlieder, so beispielsweise das Lied auf den<br />
Bürgermeister Tschech, der ein misslungenes Attentat auf Friedrich Wilhelm IV.<br />
verübte.<br />
Die aussichtslose Situation der Straßenmusikanten – der Leierkastenmänner, die<br />
oft Kriegsinvalide waren <strong>und</strong> als einzige Entschädigung die Konzession für das<br />
Leierkastenspiel erhielten, der Bänkelsänger <strong>und</strong> Harfenspielerinnen – konnte nur<br />
kurz gestreift werden.<br />
Literatur: Richter<br />
Die Wiener Arbeitermusikbewegung<br />
Neben dem in der Arbeiterbewegung gepflegtem politischen Lied vertraten<br />
einzelne Vordenker auch die Ansicht, die Arbeiterklasse sei die wahre Erbin der<br />
bürgerlichen Kultur <strong>und</strong> müsse sich das vom Bürgertum verschleuderte kulturelle<br />
Erbe aneignen. Das führte im musikalischen Bereich <strong>zur</strong> sogenannten<br />
Arbeitermusikbewegung.<br />
Um deren Wege <strong>und</strong> Ziele zu schildern, gibt es keine bessere Erscheinung als<br />
eben den Komponisten des „Lieds der Arbeit“, das heute noch gesungen wird, den<br />
Chorsänger <strong>und</strong> Hornisten Josef Scheu (1841–1904). Scheu war gebürtiger Wiener<br />
<strong>und</strong> Sohn einer Handwerkerfamilie, er spielte das Horn zuerst im Orchester des<br />
Theaters an der Wien, dann im Burgtheater. Seine Brüder Andreas <strong>und</strong> Heinrich<br />
zählten zu den Pionieren der österreichischen Arbeiterbewegung, so engagierte er<br />
sich gleichfalls dafür. 1868 hat er eine Liedertafel im Arbeiterbildungsverein<br />
Gumpendorf gegründet, zehn Jahre später wurde daraus der Arbeiter-Sängerb<strong>und</strong><br />
Wien, dessen Leitung er übernahm. 1872 gründete er mit dem Wiener<br />
Musikerb<strong>und</strong> die erste Musikergewerkschaft in Österreich, die ein Jahr später<br />
behördlich aufgelöst, 1875 als „Wiener Musikverein“ neu gegründet wurde. Bis<br />
1878 gab er die „Österreichische Musiker-Zeitung“ heraus, die sich gleichfalls für<br />
die sozialen Belange der Musiker einsetzte, dann wurde auch diese behördlich<br />
eingestellt; 1902 gründete er die „Österreichische Arbeitersängerzeitung“ <strong>und</strong> einen<br />
Verbandsverlag. 1881 wurde Scheu aufgr<strong>und</strong> seiner politischen Haltung aus dem<br />
Burgtheaterorchester zwangspensioniert <strong>und</strong> auch mehrfach verhaftet. Er hat<br />
trotzdem weitergearbeitet: als Musiklehrer, als Korrepetitor, als Musikkritiker für<br />
die (von Victor Adler gegründete) „Arbeiter-Zeitung“, die von 1889-1991 existierte,<br />
Komponist zahlreicher sogenannter „Tendenzchöre“. Josef Scheu hat eine Reihe<br />
weiterer Chöre geleitet, der bedeutendste von ihnen, den er mitbegründet hat, war<br />
der Gesangverein der Wiener Druckereiarbeiter Freie Typographia. Dieser war<br />
nämlich ein gemischter Chor, was damals alles andere als selbstverständlich war,<br />
<strong>und</strong> er sollte bald zu Wiens wichtigstem Arbeiterchor werden <strong>und</strong> eine<br />
entscheidende Rolle auch bei den Wiener Arbeiter-Symphoniekonzerten spielen,<br />
auf die wir gleich kommen.<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 28
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Aus dem Gründungsaufruf des Druckereiarbeiterchors „Freie Typographia“<br />
Die Aufgabe des Chors sei es, „jederzeit im Interesse der Arbeiterschaft zu wirken<br />
<strong>und</strong> deren bescheidene Festlichkeiten durch ihre [der Genossen] musikalische<br />
Mitwirkung zu verschönern. […] Der Verein wird das wahrhaft freie sowie<br />
schlichte Proletarierlied pflegen. Er wird mit den Worten <strong>und</strong> Melodien der<br />
wirklichen Volkspoeten zum Herzen des Volkes zu dringen versuchen.“<br />
Hier zeigt sich, dass der Arbeitergesangverein ideell in der Nachfolge des<br />
bürgerlichen Gesangvereins steht <strong>und</strong> sich auch institutionell aus ihm heraus<br />
entwickelt hat <strong>und</strong> mit ihm teilweise im Repertoire übereinstimmte. Das „Arbeiter-<br />
Liederbuch für vierstimmigen Männerchor“, das Scheu um 1900 herausgab, erhielt<br />
natürlich an aller erster Stelle sein „Lied der Arbeit“ <strong>und</strong> zahlreiche<br />
Freiheitsgesänge, das zweite Heft begann mit dem „B<strong>und</strong>eslied des Allgemeinen<br />
Deutschen Arbeitervereins“ <strong>und</strong> so weiter. (Übrigens war es in der Zeit der<br />
Verbote auch üblich, die Texte zuvor in den Arbeiterzeitungen zu drucken <strong>und</strong> in<br />
der Aufführung ohne Worte vorzutragen – die sich jeder hinzudenken konnte.)<br />
Aber Scheus Arbeiterliederhefte enthielten auch Chorsätze von Friedrich Silcher,<br />
dem prototypischen Komponisten der bürgerlichen Liedertafel, darunter die Lore-<br />
Ley nach Heine.<br />
Die Tradition der Wiener Arbeiter-Symphonie-Konzerte begann 1905 mit einer<br />
„Schiller-Feier der Wiener Arbeiterschaft“ begannen, an deren Beginn Wagners<br />
Meistersinger-Vorspiel <strong>und</strong> an deren Ende Beethovens Fünfte Symphonie stand.<br />
Verantwortlich für dieses Konzept zeichnete ein junger Musikkritiker der Arbeiter-<br />
Zeitung, David Josef Bach, der für die weitere Entwicklung neben dem ja schon<br />
1904 gestorbenen Josef Scheu höchst bedeutsam werden sollte, vor allem durch die<br />
Gründung der Sozialdemokratischen Kulturstelle in der Zwischenkriegszeit. Aber<br />
schon vor dem Ersten Weltkrieg, noch 1905, haben die Arbeitersymphoniekonzerte<br />
eine feste Abonnementstruktur entwickelt, <strong>und</strong> sie haben vor allem, was<br />
nicht selbstverständlich war, auch ein begeistertes Publikum gef<strong>und</strong>en (im selben<br />
Jahr wurde in der Berliner Brauerei Lipps Beethovens Neunte vor Arbeitern<br />
aufgeführt, eine Folgeaufführung zwei Monate später war nur noch schwach<br />
besucht). Für die Saison 1909/10 in Wien hingegen sind 6970 Besucher gezählt,<br />
also r<strong>und</strong> 1700, 1800 pro Konzert. In der Folgesaison kam sogar ein<br />
Kammermusikabend <strong>und</strong> ein Historischer Abend in kleineren Sälen dazu. Und so<br />
weiter. Ihren unbestrittenen Höhepunkt erlebten die Arbeiter-Symphoniekonzerte<br />
allerdings erst in der Zwischenkriegszeit, vor ihrem Verbot im Ständestaat ab 1934;<br />
1921 dirigierte kein Geringerer als George Szell Beethovens Neunte, unter<br />
Beteiligung des Chors Freie Typographia übrigens, <strong>und</strong> ihr spektakulärstes Ereignis<br />
war sicherlich die Feier des 200. Konzerts mit einer Aufführung von Gustav<br />
Mahlers Achter Symphonie unter der Leitung von Anton Webern am 18. April<br />
1926 mit Arbeiterchören <strong>und</strong> einem Arbeiterpublikum. Aber von der Zwischenkriegszeit<br />
ist hier nicht mehr zu berichten.<br />
Literatur: Seidl, Lammel<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 29
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Hinweise <strong>zur</strong> Prüfung<br />
Es gibt einen schriftlichen Prüfungstermin am Mittwoch, dem 29. Juni 2011, <strong>zur</strong><br />
gewohnten <strong>Vorlesung</strong>szeit. Ich bitte Sie, sich etwa zehn Minuten vor 11 Uhr einzufinden,<br />
um sich in die Liste einzutragen. Bitte nehmen Sie Ihren Studentenausweis<br />
mit! Die schriftliche Prüfung wird einen zeitgenössischen Text vorlegen <strong>und</strong> dazu<br />
einige Fragen stellen; ferner gibt es weitere Fragen zu den in der <strong>Vorlesung</strong><br />
behandelten Gegenständen, vielleicht in der Art eines multiple-choice-Tests.<br />
Mündliche Prüfungstermine können ab sofort <strong>und</strong> während der folgenden zwei<br />
Semester per E-mail (fuhrmannwolfgang@gmail.com) vereinbart werden.<br />
(Während der Sommerferien bin ich allerdings nur sporadisch in Wien, etwa<br />
Anfang August.) Die mündliche Prüfung läuft folgendermaßen ab:<br />
Sie suchen sich einen Text, ein Bild, vielleicht auch ein musikalisches Stück aus.<br />
Dabei kann es sich um einen Pressebericht, etwa eine Kritik von Eduard Hanslick,<br />
handeln, um einen Brief von Robert Schumann, einen Ausschnitt aus einer<br />
Abhandlung von Richard Wagner, einen Programmzettel oder eine Werbeannonce,<br />
das Titelblatt eines Notendrucks, ein Gemälde oder ein Klavierstück. Auch eine<br />
Kombination aus verschiedenen Medien (z. B. Bild <strong>und</strong> Text) ist möglich. Ihrer<br />
Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt – überraschen Sie mich! Wichtig ist,<br />
dass es sich hier um ein zeitgenössisches Dokument handelt – also nicht um<br />
musikwissenschaftliche Sek<strong>und</strong>ärliteratur des 20. Jahrh<strong>und</strong>erts! Der Zeitrahmen<br />
entspricht dem „langen 19. Jahrh<strong>und</strong>ert“ von 1789 – 1914/18, wie wir es in der<br />
<strong>Vorlesung</strong> behandelt haben.<br />
Dieses – bitte nicht allzu umfangreiche – Dokument teilen Sie mir als Kopie oder<br />
Scan spätestens eine Woche vor der Prüfung mit. Am besten per E-mail; wenn Sie<br />
es mir in mein Postfach im Sekretariat legen, bitte ich um eine kurze Verständigung<br />
per E-mail. Sollte das Dokument mir nicht rechtzeitig mitgeteilt werden, kann ich<br />
die Prüfung ausfallen lassen.<br />
Zu diesem Dokument tragen Sie bei der Prüfung eine kleine Interpretation vor,<br />
wie wir sie in der <strong>Vorlesung</strong> immer wieder gemacht haben – bitte keine bloßen<br />
Paraphrasen <strong>und</strong> „Inhaltsangaben!“ Dabei können Sie sich auch gerne auf die<br />
genannte Literatur beziehen. Bei Weibel finden Sie beispielsweise jede Menge<br />
Presseberichte zitiert <strong>und</strong> interpretiert. Aber auch hier gilt: Selberdenken ist gefragt.<br />
Zur Recherche zeitgenössischer Presseberichte gibt es ein hervorragendes<br />
Hilfsmittel: den „Retrospective Index to Music Periodicals“ (RIPM), der online an<br />
den Computern der Fachbibliothek <strong>und</strong> der UB sowie der ÖNB zugänglich ist <strong>und</strong><br />
nach allen möglichen Stichwörtern durchsucht werden kann.<br />
Anschließend werde ich noch einige Überblicksfragen zu anderen Bereichen der<br />
<strong>Vorlesung</strong> stellen. Dabei kommt es mir weniger auf Detailwissen als darauf an, ob<br />
Sie die leitenden Frage- <strong>und</strong> Problemstellungen nachvollzogen haben.<br />
Bei Fragen können Sie sich jederzeit an mich wenden, am bequemsten wiederum<br />
per Mail.<br />
Wolfgang Fuhrmann, 20. Juni 2011<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 30
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Literaturhinweise *<br />
zu den soziologischen Gr<strong>und</strong>konzepten:<br />
Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft,<br />
Frankfurt am Main 1999 11 (1982)<br />
Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der<br />
bürgerlichen Gesellschaft, Frankfurt am Main 1990 (zuerst Darmstadt <strong>und</strong> Neuwied:<br />
Luchterhand, 1962)<br />
Bruno Latour, Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft. Einführung in die Akteur-<br />
Netzwerk-Theorie, Frankfurt am Main 2010<br />
Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Erster Band: Vom Feudalismus des<br />
Alten Reiches bis <strong>zur</strong> Defensiven Modernisierung der Reformära 1700–1815, München<br />
1989 2 (1987)<br />
Musikwissenschaftliche Literatur:<br />
William G. Atwood, The Parisian Worlds of Frédéric Chopin, New Haven etc. 1999<br />
Hans-Werner Boresch, Der „alte Traum vom alten Deutschland“. Musikfeste im<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>ert als Nationalfeste, in: Die Musikforschung 52 (1999), 55-69<br />
Dieter Düding, Organisierter Nationalismus in Deutschland 1808–1847, München 1984<br />
–, Das deutsche Nationalfest von 1814: Matrix der deutschen Nationalfeste im 19.<br />
Jahrh<strong>und</strong>ert, in: <strong>Öffentliche</strong> Festkultur. Politische Feste in Deutschland von der Aufklärung<br />
bis zum Ersten Weltkrieg, hrsg. v. Dieter Düding u. a., Reinbek bei Hamburg 1988<br />
(Rowohlts Enzyklopädie 462), 67–88<br />
Andreas Eichhorn, Vom Volksfest <strong>zur</strong> „musikalischen Prunkausstellung“: Das<br />
Musikfest im 19. Jahrh<strong>und</strong>ert als Forum bürgerlicher Selbstdarstellung, in: Die<br />
Musikforschung 52 (1999), 5-28<br />
Imogen Fellinger, Die Begriffe Salon <strong>und</strong> Salonmusik in der Musikanschauung des<br />
19. Jahrh<strong>und</strong>erts, in: Carl Dahlhaus (hg), Studien <strong>zur</strong> Trivialmusik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts,<br />
Regensburg 1967 (Studien <strong>zur</strong> Musikgeschichte des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts 8), 131–41<br />
Wolfgang Fuhrmann, Volck’s Lied. Haydns gegenrevolutionäre Kaiserhymne <strong>und</strong><br />
ihr ‚Gattungs’-Kontext (erscheint in: Haydn-Studien 2011, derzeit im Druck)<br />
Martha Handlos, Die Wiener „Concerts spirituels“ (1819-1848), in: Österreichische<br />
Musik – Musik in Österreich. Beiträge <strong>zur</strong> Musikgeschichte Mitteleuropas. Theophil Antonicek<br />
zum 60. Geburtstag (1998), hrsg. v. Elisabeth Th. Hilscher, Tutzing 1998, 283–319<br />
Alice M. Hanson, Die zensurierte Muse. Musikleben im Wiener Biedermeier, Wien –<br />
Köln – Graz 1987 (Wiener musikwissenschaftliche Beiträge 13)<br />
Claudia Heine, „Aus reiner <strong>und</strong> wahrer Liebe <strong>zur</strong> Kunst ohne äussere Mittel“. Bürgerliche<br />
Musikvereine in deutschsprachigen Städten des frühen 19. Jahrh<strong>und</strong>erts, Diss. Univ. Zürich,<br />
2009 (online abrufbar über http://opac.nebis.ch/)<br />
* Die Literatur zu dem Beitrag von Herrn Kollenz wird direkt im Anschluss an seinen Beitrag wiedergegeben<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 31
PD Dr. Wolfgang Fuhrmann, Institut für Musikwissenschaft der Universität Wien<br />
<strong>Vorlesung</strong> „<strong>Öffentliche</strong> <strong>und</strong> <strong>private</strong> Sphäre in der Musik des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts“, SoSe 2011<br />
Hans-Günter Klein (hrsg.), Die Musikveranstaltungen bei den Mendelssohns - ein<br />
„musikalischer Salon“? Die Referate des Symposions am 2. September 2006 in Leipzig,<br />
Leipzig 2006<br />
Hans-Günter Klein, „Wir haben viel Musik gemacht“ – Hausmusik <strong>und</strong> <strong>private</strong>s<br />
Musizieren bei Felix Mendelssohn Bartholdy, in: Simone Hohmaier (hrsg.), Jahrbuch<br />
2010 des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz, 9–17<br />
Georg Knepler, Musikgeschichte des XIX. Jahrh<strong>und</strong>erts, Berlin 1961, vor allem Band<br />
1: Frankreich – England<br />
Inge Lammel, Arbeitermusikkultur in Deutschland: 1844–1945. Bilder <strong>und</strong> Dokumente,<br />
Leipzig 1984<br />
Norbert Linke, Musik erobert die Welt, oder: Wie die Wiener Familie Strauß d.<br />
„Unterhaltungsmusik“ revolutionierte, Wien 1987<br />
Richard von Perger, Geschichte der k. k. Gesellschaft der Musikfre<strong>und</strong>e in Wien, 1.<br />
Abteilung 1812-1870, Wien 1912<br />
Carl Ferdinand Pohl, Zur Geschichte der Gründung <strong>und</strong> Entwicklung der Gesellschaft der<br />
Musikfre<strong>und</strong>e in Wien <strong>und</strong> ihres Conservatoriums, Wien 1868–1869<br />
–, Die Gesellschaft der Musikfre<strong>und</strong>e des österreichischen Kaiserstaates <strong>und</strong> ihr<br />
Conservatorium, Wien 1871<br />
Cecelia Hopkins Porter, The New Public and the Reordering of the Musical<br />
Establishment: The Lower Rhine Music Festivals, 1818-67, in: 19th-Century Music 3<br />
(1980), 211–224<br />
Lukas Richter, Der Berliner Gassenhauer. Darstellung – Dokumente – Sammlung, mit<br />
einem Register neu hrsg. vom Deutschen Volksliedarchiv, Münster 2004<br />
(Volksliedstudien 4) (zuerst Leipzig 1969)<br />
Walter Salmen, Haus- <strong>und</strong> Kammermusik: <strong>private</strong>s Musizieren im gesellschaftlichen Wandel<br />
zwischen 1600 <strong>und</strong> 1900, Leipzig 1969 (Musikgeschichte in Bildern II, 3)<br />
–, Das Konzert. Eine Kulturgeschichte, München 1988<br />
Heinrich W. Schwab, Konzert: öffentliche Musikdarbietung vom 17. bis 19. Jahrh<strong>und</strong>ert,<br />
Leipzig 1971 (Musikgeschichte in Bildern II, 4)<br />
Derek B. Scott, So<strong>und</strong>s of the Metropolis: The Nineteenth-Century Popular Music<br />
Revolution in London, New York, Paris, and Vienna, Oxford [u.a.] 2008<br />
Johann Wilhelm Seidl, Musik <strong>und</strong> Austromarxismus. Zur Musikrezeption der<br />
österreichischen Arbeiterbewegung im späten Kaiserreich <strong>und</strong> in der 1. Republik, Wien [u.a.]<br />
1989 (Wiener musikwissenschaftliche Beiträge 17)<br />
Stiftung Berliner Philharmoniker (hrsg.), Variationen mit Orchester. 125 Jahre Berliner<br />
Philharmoniker. Bd. 1: Orchestergeschichte, Berlin 2007<br />
William Weber, The Great Transformation of Musical Taste: Concert Programming from<br />
Haydn to Brahms, Cambridge 2008<br />
Samuel Weibel, Die deutschen Musikfeste des 19. Jahrh<strong>und</strong>erts im Spiegel der<br />
zeitgenössischen musikalischen Fachpresse: mit inhaltsanalytisch erschlossenem Artikelverzeichnis<br />
auf CD-ROM, Berlin [u.a.] 2006 (Beiträge <strong>zur</strong> rheinischen Musikgeschichte 168)<br />
© 2011 by Wolfgang Fuhrmann 32