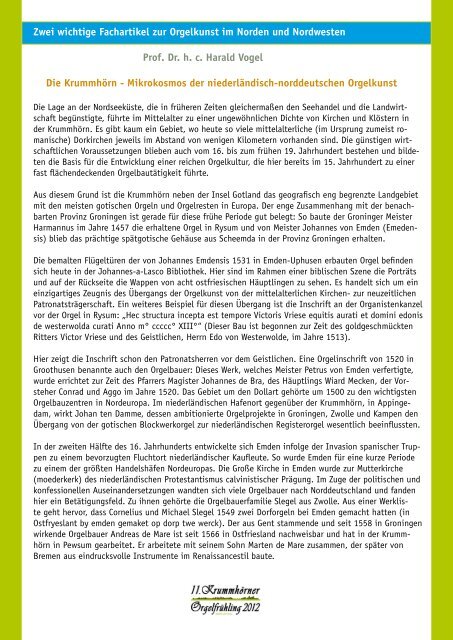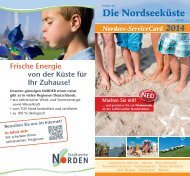Die Programme und Künstler des Orgelfrühlings vorgestellt: - Greetsiel
Die Programme und Künstler des Orgelfrühlings vorgestellt: - Greetsiel
Die Programme und Künstler des Orgelfrühlings vorgestellt: - Greetsiel
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Zwei wichtige Fachartikel zur Orgelkunst im Norden <strong>und</strong> Nordwesten<br />
Prof. Dr. h. c. Harald Vogel<br />
<strong>Die</strong> Krummhörn - Mikrokosmos der niederländisch-norddeutschen Orgelkunst<br />
<strong>Die</strong> Lage an der Nordseeküste, die in früheren Zeiten gleichermaßen den Seehandel <strong>und</strong> die Landwirtschaft<br />
begünstigte, führte im Mittelalter zu einer ungewöhnlichen Dichte von Kirchen <strong>und</strong> Klöstern in<br />
der Krummhörn. Es gibt kaum ein Gebiet, wo heute so viele mittelalterliche (im Ursprung zumeist romanische)<br />
Dorkirchen jeweils im Abstand von wenigen Kilometern vorhanden sind. <strong>Die</strong> günstigen wirtschaftlichen<br />
Voraussetzungen blieben auch vom 16. bis zum frühen 19. Jahrh<strong>und</strong>ert bestehen <strong>und</strong> bildeten<br />
die Basis für die Entwicklung einer reichen Orgelkultur, die hier bereits im 15. Jahrh<strong>und</strong>ert zu einer<br />
fast flächendeckenden Orgelbautätigkeit führte.<br />
Aus diesem Gr<strong>und</strong> ist die Krummhörn neben der Insel Gotland das geografisch eng begrenzte Landgebiet<br />
mit den meisten gotischen Orgeln <strong>und</strong> Orgelresten in Europa. Der enge Zusammenhang mit der benachbarten<br />
Provinz Groningen ist gerade für diese frühe Periode gut belegt: So baute der Groninger Meister<br />
Harmannus im Jahre 1457 die erhaltene Orgel in Rysum <strong>und</strong> von Meister Johannes von Emden (Emedensis)<br />
blieb das prächtige spätgotische Gehäuse aus Scheemda in der Provinz Groningen erhalten.<br />
<strong>Die</strong> bemalten Flügeltüren der von Johannes Emdensis 1531 in Emden-Uphusen erbauten Orgel befinden<br />
sich heute in der Johannes-a-Lasco Bibliothek. Hier sind im Rahmen einer biblischen Szene die Porträts<br />
<strong>und</strong> auf der Rückseite die Wappen von acht ostfriesischen Häuptlingen zu sehen. Es handelt sich um ein<br />
einzigartiges Zeugnis <strong>des</strong> Übergangs der Orgelkunst von der mittelalterlichen Kirchen- zur neuzeitlichen<br />
Patronatsträgerschaft. Ein weiteres Beispiel für diesen Übergang ist die Inschrift an der Organistenkanzel<br />
vor der Orgel in Rysum: „Hec structura incepta est tempore Victoris Vriese equitis aurati et domini edonis<br />
de westerwolda curati Anno m° ccccc° XIII°“ (<strong>Die</strong>ser Bau ist begonnen zur Zeit <strong>des</strong> goldgeschmückten<br />
Ritters Victor Vriese <strong>und</strong> <strong>des</strong> Geistlichen, Herrn Edo von Westerwolde, im Jahre 1513).<br />
Hier zeigt die Inschrift schon den Patronatsherren vor dem Geistlichen. Eine Orgelinschrift von 1520 in<br />
Groothusen benannte auch den Orgelbauer: <strong>Die</strong>ses Werk, welches Meister Petrus von Emden verfertigte,<br />
wurde errichtet zur Zeit <strong>des</strong> Pfarrers Magister Johannes de Bra, <strong>des</strong> Häuptlings Wiard Mecken, der Vorsteher<br />
Conrad <strong>und</strong> Aggo im Jahre 1520. Das Gebiet um den Dollart gehörte um 1500 zu den wichtigsten<br />
Orgelbauzentren in Nordeuropa. Im niederländischen Hafenort gegenüber der Krummhörn, in Appingedam,<br />
wirkt Johan ten Damme, <strong>des</strong>sen ambitionierte Orgelprojekte in Groningen, Zwolle <strong>und</strong> Kampen den<br />
Übergang von der gotischen Blockwerkorgel zur niederländischen Registerorgel wesentlich beeinflussten.<br />
In der zweiten Hälfte <strong>des</strong> 16. Jahrh<strong>und</strong>erts entwickelte sich Emden infolge der Invasion spanischer Truppen<br />
zu einem bevorzugten Fluchtort niederländischer Kaufleute. So wurde Emden für eine kurze Periode<br />
zu einem der größten Handelshäfen Nordeuropas. <strong>Die</strong> Große Kirche in Emden wurde zur Mutterkirche<br />
(moederkerk) <strong>des</strong> niederländischen Protestantismus calvinistischer Prägung. Im Zuge der politischen <strong>und</strong><br />
konfessionellen Auseinandersetzungen wandten sich viele Orgelbauer nach Norddeutschland <strong>und</strong> fanden<br />
hier ein Betätigungsfeld. Zu ihnen gehörte die Orgelbauerfamilie Slegel aus Zwolle. Aus einer Werkliste<br />
geht hervor, dass Cornelius <strong>und</strong> Michael Slegel 1549 zwei Dorforgeln bei Emden gemacht hatten (in<br />
Ostfryeslant by emden gemaket op dorp twe werck). Der aus Gent stammende <strong>und</strong> seit 1558 in Groningen<br />
wirkende Orgelbauer Andreas de Mare ist seit 1566 in Ostfriesland nachweisbar <strong>und</strong> hat in der Krummhörn<br />
in Pewsum gearbeitet. Er arbeitete mit seinem Sohn Marten de Mare zusammen, der später von<br />
Bremen aus eindrucksvolle Instrumente im Renaissancestil baute.