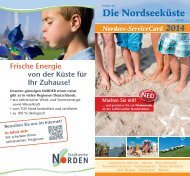Die Programme und Künstler des Orgelfrühlings vorgestellt: - Greetsiel
Die Programme und Künstler des Orgelfrühlings vorgestellt: - Greetsiel
Die Programme und Künstler des Orgelfrühlings vorgestellt: - Greetsiel
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Programme</strong>inführung<br />
Jan Pieterszoon Sweelinck wurde 1562, vor genau 450 Jahren, in eine Organistenfamilie hineingeboren.<br />
Im selben Jahr übersiedelte sein Vater von Deventer nach Amsterdam, um dort den Organistenposten in<br />
der Oude Kerk zu übernehmen, den Jan Pieterszoon später über 40 Jahre bis zu seinem Tode 1621 innehatte.<br />
Dort standen ihm <strong>und</strong> später seinem Sohn zwei repräsentative Orgelinstrumente zur Verfügung, die von<br />
Hendrik Niehoff, dem bedeutendsten Meister der altniederländischen Orgelkunst, zusammen mit Hans van<br />
Cavelen (große Orgel 1540-42) <strong>und</strong> Jasper Johansen (kleine Orgel 1544-45) gebaut wurden. Niehoff war<br />
eine dominierende Figur <strong>des</strong> niederländischen Orgelbaus in der vorreformatorischen Zeit <strong>und</strong> hinterließ<br />
Instrumente von höchster klanglicher <strong>und</strong> visueller Eleganz mit einem konstruktiven Konzept, das eine<br />
differenzierte Anschlagskultur in einem monumentalen Rahmen zuließ.<br />
Sweelinck verbrachte fast sein ganzes Leben in der „machtighe en over all de werelt bekende Coop-stadt<br />
Amsterdam“ <strong>und</strong> wurde der Begründer einer Schule <strong>des</strong> Orgelspiels, die bis in die Zeit <strong>des</strong> jungen Bach in<br />
Norddeutschland wirksam blieb. Johann Mattheson zeichnete noch in seiner 1740 erschienenen Gr<strong>und</strong>lage<br />
einer Ehrenpforte ein sehr lebendiges Bild Sweelincks als Organist, Orgellehrer <strong>und</strong> Komponist.<br />
Sweelinck lebte in einer Zeit <strong>des</strong> kirchlichen Umbruchs, als die Reformation sich in den Niederlanden<br />
durchsetzte. <strong>Die</strong> reiche niederländische Orgelkunst war im späten 16. Jahrh<strong>und</strong>ert allerdings durch die<br />
ablehnende Haltung der jungen calvinistischen Kirche gefährdet. Auf der Dordrechter Synode von 1574<br />
wurde der Gebrauch der Orgeln im Gottesdienst untersagt, so dass Sweelinck vor <strong>und</strong> nach den Gottesdiensten<br />
<strong>und</strong> zu bestimmten Nachmittagsst<strong>und</strong>en in der Woche spielte - entsprechend einer Tradition,<br />
die sich bereits in der ersten Hälfte <strong>des</strong> 16. Jahrh<strong>und</strong>erts herausgebildet hatte <strong>und</strong> den Rahmen für die<br />
hochentwickelte niederländische Improvisationskunst bildete. <strong>Die</strong> Organisten der Oude Kerk waren bereits<br />
vor der Reformation städtische Angestellte <strong>und</strong> die Orgeln befanden sich in städtischem Besitz. So blieb<br />
die Existenzgr<strong>und</strong>lage Sweelincks bis zu seinem Lebensende bestehen.<br />
Sweelincks Orgelstil konnte sich unabhängig von liturgischen Rahmenbedingungen entwickeln <strong>und</strong> so ein<br />
Maß von musikalischer Autonomie gewinnen, die im Bereich der Orgelmusik vorher nicht möglich war.<br />
Durch den Umfang seiner Kompositionen, die Proportionierung von Kontrapunkt <strong>und</strong> Figuration sowie die<br />
formale Durchgestaltung setzte Sweelinck neue Maßstäbe in der instrumentalen Polyphonie.<br />
<strong>Die</strong> größte Bekanntheit erlangte Sweelinck als Orgellehrer. Viele Schüler kamen aus den norddeutschen<br />
Hansestädten, wo er als „Organistenmacher“ bezeichnet wurde <strong>und</strong> wo ein Abschlusszeugnis Sweelincks<br />
die beste Empfehlung für die Übernahme einer bedeutenden Organistenstelle war. <strong>Die</strong> Liste seiner Schüler<br />
enthält so bedeutende Namen wie Samuel Scheidt (Halle), Jacob Praetorius, Heinrich Scheidemann<br />
(beide Hamburg), Paul Siefert (Danzig), Melchior Schildt (Kopenhagen <strong>und</strong> Hannover) oder Andreas<br />
Düben (Stockholm). <strong>Die</strong> deutschen Schüler veranlassten ihren Lehrer, sich auch mit den Melodien Luthers<br />
<strong>und</strong> seines Umkreises auseinanderzusetzen.<br />
<strong>Die</strong> Verbindung der virtuosen Spielmanieren der englischen Virginalisten mit der Balance <strong>und</strong> Eleganz<br />
<strong>des</strong> niederländischen Kontrapunkts, die Sweelinck in so genialer Weise vollzog, wurde durch die Berührung<br />
mit der streng liturgischen Organistenpraxis Norddeutschlands um ein weiteres Element bereichert:<br />
die Disziplin der liturgisch geb<strong>und</strong>enen Orgelverse. Sweelinck erscheint uns als ein universaler Musiker,<br />
der die wichtigsten Tendenzen der Orgelmusik seiner Zeit am Ende der Epoche <strong>des</strong> musikalischen Renaissancestils<br />
vereint, vergleichbar mit Johann Sebastian Bach, der 100 Jahre später eine ähnliche Rolle<br />
spielte. Beide hinterließen eine Schule, die über mehrere Generationen weiterwirkte.<br />
Durch die Verbannung <strong>des</strong> Orgelspiels aus dem Gottesdienst (1574) entwickelte sich in den Niederlanden<br />
verstärkt eine häusliche Pflege <strong>des</strong> Musizierens, wobei die Psalmen- <strong>und</strong> Volkslied-Melodien eine domi-