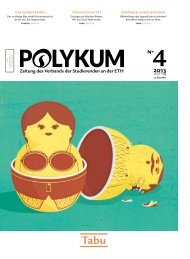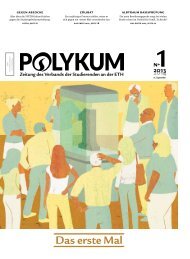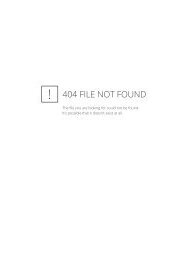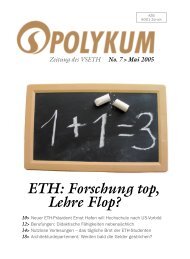Kommunikation - VSETH - ETH Zürich
Kommunikation - VSETH - ETH Zürich
Kommunikation - VSETH - ETH Zürich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Polykum Nr. 3/08–09<br />
«Frauen reden im normalfall weniger ausführlich als Männer», weiss Prof. Angelika Linke und widerlegt damit ein Klischee.<br />
heissen, dass Frauen über ein Gesprächsverhalten<br />
verfügen, das dazu führt, dass sich die<br />
Leute wohl fühlen. Das kann auch eine Ressource<br />
sein.<br />
die aber der gruppe zugute kommt<br />
und nicht der einzelnen Frau.<br />
Es sei denn, sie nutzt diese Sprachkompetenz<br />
aus. Je nachdem kann eine Frau sich durch<br />
diese Qualitäten in eine bestimmte Position<br />
bringen. Etwa in Betrieben, wo die Vorgesetzten<br />
ein Klima schaffen, in dem die Angestellten<br />
gern arbeiten kommen, weil sie sich<br />
wohl fühlen. Da können weibliche <strong>Kommunikation</strong>sstrategien<br />
von Vorteil sein. Wobei<br />
auch Männer ein entsprechendes Gesprächsverhalten<br />
haben können, genauso wie es viele<br />
Frauen gibt, die sich in Unterhaltungen nicht<br />
gerade angenehm verhalten.<br />
In flachen Hierarchien haben Frauen<br />
tatsächlich eine anständige Quote. in<br />
Kaderpositionen aber sind sie in der<br />
Minderheit.<br />
Ja, das stimmt. Man hat in der Soziolinguistik<br />
vielfach belegt, dass beruflicher Erfolg<br />
auch mit bestimmten Redeweisen zusammenhängt.<br />
Dass in der Schweiz auch heute noch<br />
prozentual weniger Arbeiterkinder die Matura<br />
machen als Kinder aus Akademikerfamilien,<br />
hat auch mit Sprachfertigkeiten zu tun,<br />
die Akademikerkinder schon zuhause lernen.<br />
Dass Frauen seltener beruflich erfolgreich<br />
sind als Männer, hat aber wohl sehr komplexe<br />
Gründe. Einer davon ist sicher auch die weibliche<br />
Selbstwahrnehmung.<br />
inwiefern?<br />
Frauen haben zum Beispiel sehr oft und sehr<br />
schnell das Gefühl, bereits viel zu viel gesagt<br />
zu haben – obwohl dies, gerade in öffentlichen<br />
Situationen, objektiv betrachtet meist<br />
gar nicht stimmt.<br />
an der universität <strong>Zürich</strong> ist ein rhetorik-Kurs<br />
ausgeschrieben – ausschliesslich<br />
für Frauen.<br />
Solange die Frauen das Gefühl haben, dass<br />
sie eine rhetorische Stütze brauchen, ist es<br />
wichtig, dass sie diese auch erhalten. Aber<br />
auch eine Frau, die einen Rhetorik-Kurs besucht<br />
hat, wird in gewissen Situationen vielleicht<br />
darauf verzichten, all das anzuwenden,<br />
was sie sich angeeignet hat. Man hat immer<br />
eine soziale Rolle zu erfüllen. Gleichzeitig<br />
kann man sich auch aktiv eine gewisse Identität<br />
geben, indem man in einer bestimmten<br />
Art und Weise verbal auftritt. Man stilisiert<br />
sich im Gespräch sozusagen ständig.<br />
geschieht diese Stilisierung bewusst?<br />
Im Normalfall ziemlich unbewusst. Insofern<br />
ist es natürlich positiv, dass das Thema heute<br />
vermehrt behandelt wird. Die Frauen müssen<br />
lernen, dass das nicht ihr persönliches Problem<br />
ist, sondern eben mit gesellschaftlichen<br />
Gegebenheiten und mit Gruppenverhalten zusammenhängt.<br />
KOMMuniKatiOn<br />
11<br />
Sie selbst sind deutsche, sprechen<br />
aber Schweizer Mundart. das ist ungewöhnlich.<br />
Ich stamme aus dem Schwäbischen, wo man<br />
einen Dialekt spricht, der dem Schweizerdeutschen<br />
näher ist als nördlichere Mundarten.<br />
Ausserdem bin ich bereits als Schülerin<br />
in die Schweiz gekommen. Schweizerdeutsch<br />
lernte ich aus lauter Verzweiflung. Erstens<br />
deshalb, weil ich merkte, dass alle so komisch<br />
mit mir sprechen. Zum anderen wird man<br />
sofort ausgeschlossen, wenn man nicht die<br />
gleiche Sprache spricht. Also tut man alles,<br />
um dazuzugehören.<br />
die Bezugsgruppe erschliesst sich<br />
über einen gemeinsamen Jargon?<br />
Ja. Wer die Sprache teilt, gehört dazu.<br />
Sprache ist – genauso wie Mode – Teil unseres<br />
sozialen Auftritts. Wie Kleidung, die man<br />
wählt, so wählt man auch eine bestimmte<br />
Sprache. Wobei man in der Sprache wie gesagt<br />
nicht ganz so frei ist wie in der Kleidung.<br />
Sprachen kann man sich nicht kaufen, nur aneigenen.<br />
Und vieles geschieht hier unbewusst.<br />
Aber wenn man sich ein Bewusstsein von der<br />
Funktion der Sprache erarbeitet, dann ist bereits<br />
ein grosser Schritt getan.<br />
Das vollständige Interview erscheint am 21. November im<br />
Strassenmagazin Surprise.<br />
das interview führten ivana Leiseder und reto aschwanden.<br />
Ivana Leiseder ist Redaktionsleiterin des Polykum<br />
und Reto Aschwanden Redaktor des Surprise. leiseder@polykum.ethz.ch<br />
/ r.aschwanden@strassenmagazin.ch