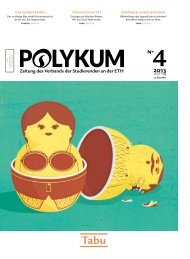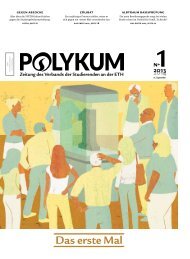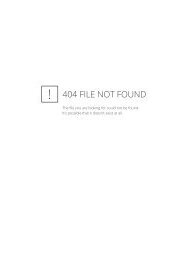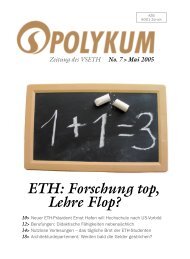Kommunikation - VSETH - ETH Zürich
Kommunikation - VSETH - ETH Zürich
Kommunikation - VSETH - ETH Zürich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Burchardt, Abgeordnete für Bildung und Forschung.<br />
Polykum Nr. 3/08–09 Bild: David Mrusek<br />
blikum geteilt: Die Sprecherin des AStA der<br />
Universität Kiel wies in dem Kontext auf zunehmende<br />
Ermüdungserscheinungen der Bachelor-/Master-Absolventen<br />
hin und forderte<br />
eine Anpassung des Lehrstoffes an die Möglichkeiten<br />
der Studierenden.<br />
Dr. Annette Julius, Leiterin des Deutschen<br />
Akademischen Austauschdienstes<br />
Berlin, und Dr. Volker Meyer-Guckel, stellvertretender<br />
Generalsekretär des Stifterverbandes,<br />
äusserten sich hinsichtlich der Bologna-Reform<br />
zuversichtlicher: Es seien keine<br />
vorschnellen Schlüsse zu ziehen, schliesslich<br />
sei Bologna gerade einmal drei Jahre alt.<br />
Der MLP-Hochschultag zeigte, dass sowohl<br />
bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit Europas<br />
als auch der Bologna-Reform Verbesserungen<br />
unbedingt notwendig sind. Trotz<br />
den vielfältigen Bestrebungen sind die Bedingungen<br />
für Hochschulmitglieder immer noch<br />
suboptimal. Bleibt also zu hoffen, dass sich<br />
die Studiensituation wenigstens für die nachfolgenden<br />
Studierendengenerationen angenehmer<br />
gestalten wird als für uns – wie eine<br />
Teilnehmerin des Hochschultages treffend<br />
äusserte – «Versuchskaninchen».<br />
Mehr infos: www.mlp-hochschultag.de<br />
ivana Leiseder (22) ist Redaktionsleiterin des Polykum und<br />
studiert im 5. Semester Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft<br />
an der Universität <strong>Zürich</strong>. leiseder@polykum.ethz.ch<br />
Magdalena Oehen (23) ist Administratorin des Polykum<br />
und studiert im 3. Semester Anglistik sowie im 5. Semester Sinologie<br />
an der Universität <strong>Zürich</strong>. moehen@polykum.ethz.ch<br />
Wir nannten eS arBeit<br />
radioaktives<br />
Mahnmal<br />
Am Eingang der Zone werden wir von Uniformierten<br />
kontrolliert. Unsere Besucherscheine<br />
wurden von einem kleinen Büro in<br />
Kiew organisiert, von dort hierher sind wir<br />
knapp drei Stunden gefahren. Die Nacht<br />
habe ich mit anderen Reisenden in einem<br />
Nachtklub verbracht, ein prunkhaftes Gebäude<br />
aus der Stalin-Zeit, direkt neben der<br />
japanischen Botschaft.<br />
Die Fahrt in die Zone, vorbei an den<br />
Grenzposten, ist nun so etwas wie die Antithese<br />
zu den vorangegangenen Stunden.<br />
Die Zone, Tschernobyl (russisch: «Tscher-<br />
NO-byl»), der Reaktor – das sind Schlagwörter<br />
einer Parallelwelt, die unbemerkt<br />
zwischen Science-Fiction-Literatur, Computerspielen<br />
und der Realität wechseln.<br />
Durch diese Ambivalenz haftet ihnen etwas<br />
Mysteriöses an, ein fremder Geschmack,<br />
ein Duft von jenseits, der uns in die Nase<br />
steigt, als wir das erste Mal aus dem Transporter<br />
steigen und von ferne auf die gigantischen,<br />
unfertigen Kühltürme der Reaktorblöcke<br />
5 und 6 blicken. Die Zone riecht<br />
nach Verrottetem, nach dem Uralten der<br />
Gebäude und Anlagen, oder vielleicht einfach<br />
nur nach Natur. Die Natur gedeiht hier<br />
uneingeschränkt, wächst in Form von zwei<br />
Meter langen Flusswelsen heran, die friedlich<br />
in den Kanälen herumschwimmen,<br />
deren Wasser einst die Reaktorblöcke 1 bis<br />
4 kühlte.<br />
atomare Friedenstaube<br />
Die Zone ist mit Denkmälern und Statuen<br />
geradezu vollgestellt, obwohl sie an<br />
sich Mahnmal genug wäre. Das Monumentale<br />
der Sowjetunion, die Liebe zum Ideal,<br />
zur Veranschaulichung ist hier wunderbar<br />
sichtbar. Im Randbereich der Zone, in<br />
dem Wohnungen und der Verwaltungsap-<br />
etHWeLt<br />
21<br />
parat untergebracht sind, begrüsst uns das<br />
Mahnmal der Feuerwehrmänner, die den<br />
Einsatz in der Nacht des 26. April 1986 mit<br />
ihrem Leben bezahlten. Sie, die ursprünglich<br />
ein einfaches Feuer löschen wollten,<br />
wurden noch am selben Tag auf Grund<br />
ihres schlechten Zustands in eine radiologische<br />
Klinik in Moskau gebracht, wo sie an<br />
der Strahlenkrankheit starben und in versiegelten<br />
Zinkkassetten beerdigt wurden,<br />
unter Betonplatten. 200 Meter von den<br />
Überresten des Schicksalsreaktors steht<br />
eine weitere Statue, diesmal Prometheus,<br />
der wie ein Gottesanbeter in einer dahingestreckten<br />
Haltung verharrt. Über seinem<br />
Kopf hält er die Flamme, die er den Menschen<br />
gebracht hat und die für die friedliche<br />
Nutzung von Atomkraft stehen soll, ein sowjetischer<br />
Fingerzeig auf die Bombenabwürfe<br />
der Amerikaner in Japan. Und als<br />
wäre es noch nicht genug mit den Symbolen<br />
und Kunstwerken, hängt an einem Gebäude<br />
in der Nähe eine gigantische Plastik, ein abstraktes<br />
Atom, komplett mit Elektronenhülle.<br />
Und aus dem Atom fliegt eine entfremdete<br />
Friedenstaube, wie sie Picasso<br />
nicht besser hinbekommen hätte.<br />
Dann sehen wir den stählernen Sarg,<br />
der das zerstörte Reaktorgebäude von Block<br />
4 abschirmt. Darin, wie ein Embryo im Mutterleib,<br />
glühen 180 Tonnen radioaktiver<br />
Überreste der atomaren Katastrophe vor<br />
sich hin. Draussen spüren wir nichts. Ukrainischer<br />
Herbstregen wäscht die Luft,<br />
hält sie frei von strahlenden Schwebeteilchen,<br />
die wir einatmen könnten. Erst im<br />
Innern des Körpers würde der Staub von<br />
Tschernobyl echten Schaden anrichten –<br />
nach Innen aber gelangt die Katastrophe<br />
nicht, sie muss auf ewig abgeschlossen in<br />
ihrer Zone bleiben, das Ausmass, der Charakter,<br />
er kann nie verstanden, verinnerlicht<br />
werden. (dm)<br />
david Mrusek (22) ist freier Mitarbeiter des Polykum<br />
und absolviert gerade ein Praktikum bei BASF in Mannheim.<br />
An dieser Stelle berichtet er regelmässig über seine Erlebnisse<br />
während seiner Studienpause. dr.mrusek@gmail.com<br />
einst Vorzeigearbeiterstadt, jetzt marodes Freilichtmuseum: Tschernobyl.