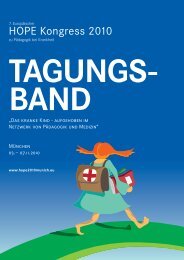HOPE Kongress 2010 - Hope Congress Munich 2010
HOPE Kongress 2010 - Hope Congress Munich 2010
HOPE Kongress 2010 - Hope Congress Munich 2010
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
7th European <strong>HOPE</strong> <strong>Congress</strong> <strong>2010</strong> 111<br />
• Basismodule für Pädagogik bei Krankheit in den Studienrichtungen aller<br />
Lehrämter<br />
• Spezialisierung für Lehrkräfte an Klinikschulen/im Hausunterricht<br />
• Schule für Kranke in der Funktion einer Seminarschule<br />
Der gemeinsame Gedanke, in allen Ländern eine Versorgung kranker Kinder<br />
und Jugendlicher durch Schulen für Kranke zu gewährleisten und zu verbessern,<br />
zeigte sich in einer regen Diskussion in beiden Perspektivenforen.<br />
Zur Vorbereitung einer Europäischen Lösung wurde von den Teilnehmern<br />
die Idee einer <strong>HOPE</strong> - Summerschool 2012/13 sehr begrüßt.<br />
Impulsreferat<br />
Wolfgang Oelsner<br />
Sonderschulrektor Johann-Christoph-Winters-Schule<br />
Schule für Kranke der Stadt Köln<br />
Guten Morgen meine Damen und Herren!<br />
Wenn doch die Metapher vom „Trommelfeuer“ nicht militärisch vorbelastet<br />
wäre! Wie gerne würde ich sie nutzen, um von der soeben erlebten,<br />
fantastischen Präsentation der jungen Trommler auf Themen überzuleiten,<br />
mit denen ich sie in einem Impulsreferat auf den Abschluss-Morgen<br />
einstimmen darf. Denn dieser <strong>Kongress</strong> in München wird wahrhaft als ein<br />
Trommelfeuer in die <strong>HOPE</strong>-Geschichte eingehen. Nicht nur des tollen Rahmens<br />
wegen, jenem Trommelfeuer von Klassik über Volkstümlichkeit bis<br />
hin zum Rock. Ein Paukenschlag war auch die Themenvielfalt, wie ich sie<br />
in den 22 Jahren, die ich jetzt leitend in Schule für Kranke tätig bin, bei<br />
<strong>HOPE</strong> so noch nicht gehört und erlebt habe. Mit dieser Tagung wurde ein<br />
Graben zugeschüttet, der sich latent immer auftat. Es war ein Graben, wie<br />
man ihn zuweilen zwischen nahen Verwandten kennt, die zwar alle den<br />
gleichen Familiennamen tragen, bei Familienfesten jedoch darum streiten,<br />
wer eigentlich der Eltern liebstes und legitimes Kind ist.<br />
Wer darf sich zu den legitimen Familienmitgliedern der Krankenpädagogik<br />
rechnen? Lange Zeit spaltete diese Frage. Da standen auf der einen Seite<br />
die Kolleginnen und Kollegen, die tradiert auf den somatischen Stationen<br />
arbeiten, und auf der anderen Seite die Kolleginnen und Kollegen, die in<br />
den neu entstandenen Kinder- und Jugendpsychiatrien arbeiten. Manchmal<br />
erschienen sie eher als Stiefverwandte. Seit München <strong>2010</strong> schlägt<br />
die Familienchronik neue Seiten auf. Seit München ist die trennende Abgrenzung<br />
passé. Wir Krankenpädagogen verstehen uns sämtlichst als pädagogische<br />
Fachkräfte für Kinder und Jugendliche mit krankheitsbedingten<br />
Lernschwierigkeiten. Lernprobleme, die krankheitsbedingt sind, gehen<br />
immer mit Lebensproblemen einher. Dieser Auftrag eint uns als Pädagogenfamilie.<br />
Wie alle Schulen haben auch wir Krankenpädagogen den Auftrag, zu unterrichten<br />
und zu erziehen. Wenn Lebensschwierigkeiten im Raum stehen,<br />
kann der Erziehungsauftrag aus unserer Arbeit nicht ausgeklammert werden.<br />
In beiden Tätigkeitsfeldern, dem psychischen wie dem somatischen,<br />
haben wir es mit langfristigen, oft chronifizierten Krankheitsverläufen zu<br />
tun. Begriffe wie „Liegezeiten“ und deren Quantifizierung wie „vierwöchig“<br />
oder „sechswöchig“ entstammen einer anderen Zeit und erfassen inhaltlich<br />
nicht mehr die anstehenden Aufgaben. Wir haben es zu tun mit hartnäckigen<br />
Krankheitsverläufen und wiederholten Krankenhausaufenthalten.<br />
Das ist nicht gleichbedeutend mit permanenter stationärer Unterbringung,<br />
aber immer mit langen Zeiten, in denen Kinder nicht in ihrer Heimatschule<br />
unterrichtet werden können.<br />
Am Eröffnungstag sagte der Kinderonkologe, Herr Professor Burdach:<br />
„Wer unterrichtet wird, hat Zukunft.“ Indem wir kranke Kinder, auch lebensbedrohlich<br />
erkrankte, unterrichten, wahren sie ihre Optionen auf Zukunft.<br />
Wer auf unserem Stundenplan steht, kann weder wert- noch hoffnungslos<br />
sein. Dennoch müssen wir neben einer Kultur der Ermutigung<br />
auch eine des Abschiednehmens akzeptieren und pflegen. Auch diese Ambivalenz<br />
eint uns Krankenpädagogen auf den unterschiedlichen Stationen.<br />
Abschiede von Bildungszielen sind auch Abschiede von Lebenskonzepten<br />
und wollen von uns begleitet werden. Mal steht die Diagnose „Tumor“<br />
IV. Zusammenfassung<br />
mit irreparablem Funktionsverlust dahinter. Mal erzwingt die Diagnose<br />
„Asperger Autismus“ ein Umdenken, etwa wenn ein Kind wegen ADHS in<br />
der Kinderpsychiatrie vorgestellt wird und sich während der Behandlung<br />
herausstellt, dass das ADHS lediglich Komorbidität einer bis dahin nicht<br />
erkannten tiefgreifenden Entwicklungsstörung war. In beiden Fällen verläuft<br />
das junge Leben nach der Diagnosestellung in anderen Bahnen. Es<br />
gilt Abschied zu nehmen von Planungen, Hoffnungen, Wünschen, Utopien.<br />
Ich will die Impulse meines Referats in jeweils kurzen Thesen komprimieren<br />
These 1:<br />
Die SfK pflegt eine Kultur sowohl der Ermutigung und Zukunftsfindung als<br />
auch des Abschiednehmens. Auch die Befähigung zur Trauerarbeit ist immanentes<br />
Ziel im Unterricht und bei Schullaufbahnberatungen vor allem<br />
chronisch kranker Schüler.<br />
Die Berufserfahrung lehrt uns, dass auch bei optimaler Förderung die<br />
Bildungswege nicht immer geradlinig, selten linear verlaufen. Sie sind<br />
durchaus auch wellenförmig. Manchmal verharren Kinder auch lange Zeit<br />
auf Entwicklungsplateaus, und es bleibt zunächst offen, ob und wie es<br />
weitergeht. Das braucht Geduld. Das verlangt auch eine gewisse Demut<br />
statt einer Bildungs- und Therapieeuphorie. Wir tun den Kindern, ihren<br />
Angehörigen und uns keinen Gefallen, wenn wir die Ziele unser krankenpädagogischen<br />
Intervention in den Dienst des gesellschaftlichen Hypes stellen,<br />
wonach nur das Abitur zum Glück und zur gesellschaftlichen Teilhabe<br />
führen kann. Mit einer relativierenden Haltung werden wir uns nicht immer<br />
beliebt machen. Wir sollten sie dennoch sehr offensiv kommunizieren und<br />
Gegenwind aushalten.<br />
These 2:<br />
Realitätsprüfung, Krankheitseinsicht und –bewältigung sind immanente Förderziele<br />
von Unterricht, Beratung und Diagnostik in einer Klinikschule. Zur Realitätsakzeptanz<br />
gehört auch eine Krankheits- und Verlustakzeptanz.<br />
Die beschriebene Haltung bleibt keineswegs auf den Klinikunterricht beschränkt.<br />
Wir haben sie in die Kollegien der Regelschulen hineinzutragen.<br />
Die Erkenntnis, dass Krankheit und Begrenzung Bestandteile des Lebens<br />
sind, ist beileibe kein Monopol der Krankenpädagogik. Sie lässt sich didaktisch<br />
aber nicht immer, nicht unmittelbar und nicht hinreichend gut im allgemeinen<br />
Schulleben umsetzen. Wenn sich der Umgang mit Begrenzungen<br />
vorerst nur im geschützten System der Krankenpädagogik umsetzen lässt,<br />
dann steht dies nicht im Widerspruch zum allseits geforderten Inklusionsgedanken.<br />
Der Weg zum Ziel braucht auch längere Zeit, als die stationäre<br />
Verweildauer sie den Kindern als Zugangberechtigung zur SfK zugesteht.<br />
Was ist die Schule für Kranke?<br />
Gestatten Sie mir eine etwas sibyllinisch klingende Formulierung<br />
„Die Schule für Kranke ist das, was es ohne sie nicht gäbe“.<br />
Dieser Versuch einer recht offenen Definition ist auch eine Referenz an<br />
die Medienstadt München. Denn meine Diktion ist die Variation einer Formulierung,<br />
die Heribert Prantl in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung<br />
zum Münchener Kirchentag <strong>2010</strong> wählte. Auf die Frage: „Was ist Kirche?“<br />
antwortete er: „Kirche ist das, was es ohne sie nicht gäbe.“<br />
In einigen Bundesländern (so in meinem Bundesland NRW) hat die Schule<br />
für Kranke den Rechtsstatus einer „Schule eigener Art“. Ich erlaube mir,<br />
dies in folgender These zu erweitern:<br />
These 3<br />
„Die Schule für Kranke ist das, was es ohne sie nicht gäbe“.<br />
Rechtlich ist sie eine „Schule eigener Art“. Sie ist auch eine Schule einzigartiger,<br />
notwendiger Art. Ihr Alleinstellungsmerkmal liegt in der Integration<br />
von Maßnahmen.<br />
Krankenpädagogik integriert den medizinisch-therapeutischen Aspekt,<br />
der sich aus der Tatsache ergibt, dass das Kind krank ist, und den schulischen<br />
Aspekt, der sich aus der Tatsache ergibt, dass es eben ein Kind,<br />
bzw. ein Jugendlicher ist. Wir Krankenpädagogen haben dabei - auch das<br />
hat München deutlich gezeigt - den Paradigmenwechsel vollzogen, den die<br />
Bezeichnung unserer Schulform schon vor Jahren anbahnte, und den ich<br />
mit folgender These zusammenfasse: