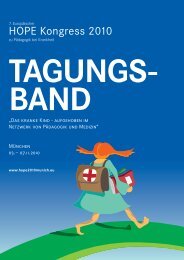HOPE Kongress 2010 - Hope Congress Munich 2010
HOPE Kongress 2010 - Hope Congress Munich 2010
HOPE Kongress 2010 - Hope Congress Munich 2010
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
II. Vorträge<br />
24 7th European <strong>HOPE</strong> <strong>Congress</strong> <strong>2010</strong><br />
dient. Zum einen kann es sich dabei um überbehütete, verwöhnte oder<br />
spät geborene Kinder handeln, die das Verlassen des sicheren häuslichen<br />
Milieus, in dem sie selbst stark den Ton angeben, quasi als Kontrollverlust<br />
erleben. Zum anderen sind von der Schulphobie speziell Jugendliche aus<br />
„Broken-Home“-Situationen betroffen, die, etwa mit einem allein erziehenden<br />
Elternteil, in enger, manchmal symbiotischer Verbindung stehen.<br />
In solchen parentifzierten Beziehungen nehmen sie gelegentlich die Rolle<br />
eines Ersatzpartners ein. Sie agieren „auf gleicher Augenhöhe“ etwa mit<br />
der Mutter und befürchten oft unbewusst, dass während ihrer Abwesenheit<br />
in der Schule zu Hause irgendetwas passiert oder sich verändert, das sie<br />
selbst nicht steuern können. Auf diese Weise bleiben Schulphobiker oft wochen-<br />
bis monatelang, in Einzelfällen auch jahrelang der Schule fern, wenn<br />
keine effektive Behandlung erfolgt.<br />
Psychisch kranke Schüler, was ist zu tun? - Anhand einiger prägnanter<br />
Beispiele von schulassoziierten Störungsbildern habe ich versucht, Ihnen<br />
zu demonstrieren, dass gerade in einer sozial prekären Epoche wie der<br />
jetzigen die Schule zur Bühne für diverse Verhaltensauffälligkeiten und<br />
psychiatrische Erkrankungen werden kann. Dafür jedoch immer a priori<br />
die Institution Schule verantwortlich zu machen, ist meiner Meinung nach<br />
aber völlig unangemessen. Denn meistens führt erst das Zusammenspiel<br />
von mehreren krankmachenden Faktoren zur Pathologie eines Kindes.<br />
Unsere Schulen dürfen nicht vorschnell zum Sündenbock abgestempelt<br />
werden, wenn bestimmte kindliche Störungen tatsächlich in erste Linie<br />
auf biologischen Ursachen, familiären Defiziten und gesellschaftlichen<br />
Fehlentwicklungen beruhen. Einseitige Vorwürfe würden nur viele engagierte<br />
Lehrer weiter entmutigen und einen qualifzierten Lehrernachwuchs<br />
einschränken.<br />
Wenn jedoch erkennbar wird, dass einzelne Kinder und Jugendliche oder<br />
bestimmte Gruppierungen im schulischen Kontext auffällig oder psychisch<br />
krank werden, müssen Schule und Lehrer gemeinsam mit den Eltern hellhörig<br />
und aufmerksam sein und auch schulbedingte Ursachen erkennen.<br />
Und natürlich muss dann, wenn nötig, rechtzeitig interveniert werden.<br />
Erforderlich sind dafür aufseiten der Schule eine entsprechende pädagogische<br />
Aus- und Fortbildung der Lehrer, eine ausreichende Zahl von sensiblen<br />
Beratungslehren und Schulpsychologen, funktionie-rende Leitungsstrukturen<br />
und gut organisierte Kommunikationsabläufe zwischen Schule<br />
und Elternhaus. Der Kinder- und Jugendpsychiater, der weiß, wie wichtig<br />
ein adäquates Schulangebot auch als ganz wesentliches Behandlungselement<br />
im Rahmen der stationären und auch am-bulanten Therapie in der<br />
Klinik ist, hat hier im Einzelfall eine wichtige diagnostische und therapeutische<br />
Aufgabe zu erfüllen.<br />
Die traditionsreiche Schule am Heckscher-Klinikum, das mit seinen 200<br />
stationären Behandlungsplätzen und seinen Institutsambulanzen an mittlerweile<br />
sieben Standorten zu den größten klinischen Einrichtungen für<br />
Kinder- und Jugendpsychiatrie in deutschsprachigen Raum zählt, ist ein<br />
Paradebeispiel für eine sehr gelungene Kooperation zwischen Pädagogik<br />
und Medizin. Gemeinsam mit 73 Ärzten, 42 Psychologen, weiteren 33<br />
diversen Therapeuten sowie Krankenpflegern und Stationserzieherinnen<br />
sind dort insgesamt auch 53 unterschiedliche spezialisierte Lehrkräfte<br />
aktiv. Sie unterrichten in 23 Klassen pro Jahr ca. 650 Patientenschüler.<br />
Neben einigen Ambulanzpatienten erhalten somit etwa zwei Drittel aller<br />
unserer stationär behandelten Patienten, bevorzugt die mit etwas längerer<br />
Verweildauer, in kleinen Gruppen einen für ihre erfolgreiche Behandlung<br />
unabdingbaren individuell geplanten und hoch differenzierten Schulunterricht.<br />
Welchen zentralen Stellenwert eine personell und fachlich gut<br />
ausgestattete Klinikschule im Rahmen des Therapiekonzeptes einer kinder-<br />
und jugendpsychiatrischen Klinik besitzt, wird besonders im Fokus<br />
unserer mehrtägigen Veranstaltung stehen.<br />
Bei der Analyse der Ursachen von psychischen Störungen bei Schülern<br />
sollten wir schließlich auch systemimmanente Schwächen unseres Bildungswesens<br />
erkennen und möglichst beheben. Nur stichpunktartig seien<br />
hier die Notwendigkeit der Früherkennung von Risikofaktoren und Defiziten<br />
noch vor Schulbeginn im Kindergartenalter oder der konsequenten frühen<br />
Förderung der Sprachentwicklung, vor allem bei Kindern aus Migrantenfamilien<br />
erwähnt. Später sollte jedes Kind in der Schulform unterrichtet<br />
werden, die seinen entwicklungsmäßigen und intellektuellen Voraussetzungen<br />
entspricht. Und wenn z. B. signifikante Teilleistungsschwächen<br />
vorliegen, muss dies im Unterricht bei der speziellen Förderung und auch<br />
bei der Benotung berücksichtigt werden. Geringere Klassenstärken, eine<br />
noch flexiblere Durchlässigkeit zwischen unterschiedlichen Schularten<br />
und mehr Möglichkeiten einer Ganztagsbeschulung würden bestimmt<br />
auch zum Ausgleich mancher sozialer Schieflagen und Ungerechtigkeiten<br />
beitragen. Sie könnten somit auch als protektive Faktoren für die seelische<br />
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wirken.<br />
Schaden würden wir unseren Schulkindern und Schullehrern aber obendrein,<br />
wenn wir vor lauter Schultristesse und angesichts vieler unerfüllter<br />
Reformhoffnungen in eine pessimistische Grundhaltung verfielen und<br />
damit auch ein wichtiges Element für eine gute Unterrichtsatmo-sphäre<br />
vertrieben: den Humor! Vielleicht sollten wir uns da ein bisschen von Wilhelm<br />
BUSCH inspirieren lassen. Bekanntermaßen haben in seiner berühmten<br />
Bubengeschichte die berüchtigten Schüler Max und Moritz einmal mit<br />
Hilfe von Flintenpulver die Pfeife ihres Lehrers Lämpel in die Luft gehen<br />
lassen – heute würde man natürlich von einem Sprengstoffanschlag sprechen.<br />
Der pflichtbewusste, aber wohl verhasste Schulmeister ging daraufhin<br />
rußverschmiert samt zerbrochener Pfeife zu Boden, überlebte aber<br />
Gott sei Dank diese Attacke ansonsten unversehrt. Wilhelm Busch leitete<br />
diesen vierten Streich seiner Bösewichte damals, 1865, mit folgendem<br />
Vers ein:<br />
Nicht allein am Schreiben, Lesen,<br />
übt sich ein vernünftig Wesen;<br />
nicht allein in Rechnungssachen<br />
soll der Mensch sich Mühe machen;<br />
sondern auch der Weisheit Lehren<br />
muss man mit Vergnügen hören.<br />
Wie psychiatrisch ist die Kinder- und Jugendpsychosomatik?<br />
Aktuelle Entwicklungen und ihre Folgen für die Schule für Kranke<br />
Dr. med. Nikolaus von Hofacker<br />
Chefarzt Klinik für Kinder- und Jugendpsychosomatik<br />
Klinikum Harlaching<br />
Abstract:<br />
Schulbezogene psychische Probleme, insbesondere Schulängste, Schulverweigerung<br />
und schulische soziale Probleme gehören zu den häufigsten<br />
Gründen einer stationären oder teilstationären Behandlung in der Kinder-<br />
und Jugendpsychosomatik. Die Hintergründe solcher Probleme sind<br />
vielfältig, häufig gehen sie aber mit weiteren kinder- und jugendpsychiatrischen<br />
komorbiden Störungen einher. Ihre Behandlung ist aufwändig und<br />
basiert auf einer engen Verzahnung der pädagogischen Arbeit in der klinikinternen<br />
Schule für Kranke mit der pädagogisch-therapeutischen Arbeit<br />
auf Station. In dem Vortrag wird auf die Hintergründe schulbezogener psychischer<br />
Probleme sowie die Schnittstellen zwischen Schule für Kranke<br />
und Station eingegangen und die Bedeutung einer adäquaten schulischen<br />
Versorgung für die Heilungs- und Reintegrationschancen der betroffenen<br />
Kinder und Jugendlichen aufgezeigt.<br />
Schulbezogene psychische Probleme – wie psychiatrisch ist die Kinder-<br />
und Jugendpsychosomatik?<br />
Schulrelevante psychische Probleme<br />
• Schulverweigerung (Schulabsentismus)<br />
• Chronische Kopf- und Bauchschmerzen<br />
• Depressionen<br />
• Essstörungen<br />
• Aufmerksameits- und Hyperaktivitätsstörungen<br />
• Störungen des Sozialverhaltens<br />
• Mobbing/Bullying/Cyberbullying<br />
Epidemiologie<br />
• Jeder 5.- 6. Schüler hat relevante psychische Probleme, mehr als jeder<br />
2. Jugendliche erlebt Schule als „häufigen Stressor“, die subjektive Belastung<br />
ist bei klinisch auffälligen Jugendlichen deutlich höher als bei