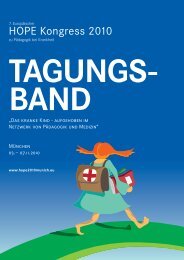HOPE Kongress 2010 - Hope Congress Munich 2010
HOPE Kongress 2010 - Hope Congress Munich 2010
HOPE Kongress 2010 - Hope Congress Munich 2010
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
7th European <strong>HOPE</strong> <strong>Congress</strong> <strong>2010</strong><br />
Das multiprofessionelle Team der Ambulanzklasse<br />
Sprachtherapeutin<br />
8 Stunden<br />
Kinder- und Jugendpsychiater<br />
der<br />
Ambulanzen<br />
Ambulanzklasse mit ca. 6 Kinder<br />
mit<br />
Sonderpädagogin und Heilpädagogin<br />
Psychologin<br />
8 Stunden<br />
Sozialdienst<br />
2 Stunden<br />
Erzieherin<br />
10 Stunden<br />
Was kann die Ambulanzklasse leisten?<br />
• Umfassende diagnostische Abklärung (im Team)<br />
• Lern- und Verhaltensbeobachtung im Gruppenkontext<br />
• Feststellung des Förderbedarfs und der therapeutischen Hilfen<br />
• Elternarbeit<br />
• Medikationseinstellung<br />
• Einleitung/Durchführung von Fördermaßnahmen und Therapieanbahnung<br />
(Sprachtherapie, Psychotherapie, Legasthenie- und Dyskalkulietherapie)<br />
• Verhaltenstraining (z.B. Aufbau schuladäquaten Verhaltens, Verhaltenssteuerung)<br />
• Korrektur der Schullaufbahn, Schulwechsel<br />
• Koordination der Maßnahmen<br />
• Nachsorge im pädagogischen Rahmen<br />
Organisation der Ambulanzklasse<br />
• Alterspektrum der Kinder zwischen 5,5 und 9,9 Jahre ( Vorschulalter bis<br />
3./4.Klasse)<br />
• Schüler bleiben an den Herkunftsschulen angemeldet<br />
• Unterricht/Therapie/Diagnostik in der Zeit von 8.00 bis 12.00<br />
• Nachmittagsbetreuungen bleiben erhalten<br />
• Die Kinder werden mit dem Taxi oder von den Eltern gebracht<br />
• Verweildauer 2 bis 10 Wochen<br />
• Wartezeit ca. 3 Wochen<br />
Diagnosespektrum<br />
• Störungen des Sozialverhaltens: 31%<br />
• Emotionale Störung: 35%<br />
• ADHS: 35%<br />
• Ausgeprägte Teilleistungsstörungen: 26%<br />
• Sprachstörungen : 31%<br />
• Autismus: 26%<br />
• Sonstiges (Mot.Stö./Tourette/Ticstö.): 5%<br />
Zahlen<br />
• 30 bis 35 Kinder pro Schuljahr in der Ambulanzklasse aufgenommen<br />
(2007–2011)<br />
• Durchschnittlich 3,5 Wochen Wartezeit<br />
• Verweildauer durchschnittlich 6 Wochen<br />
• Bei 45 % der Schüler/Patienten wird ein Schulwechsel notwendig<br />
Folgemaßnahmen<br />
• Fortführung und Vermittlung therapeutischer Hilfen<br />
• Weiterführung von Medikation<br />
• Beratung der Schulen/Päd.Nachsorge<br />
• Anbindung an spezifi sche Elterngruppen<br />
• Installation eines Integrationshelfers<br />
• Anbindung an Ambulanz (regelmäßige WV Angebot/kurzfristige Terminfenster)<br />
Erfahrungen<br />
• Ausgewogene Mischung der Diagnosen für Gruppenbildung am sinnvollsten<br />
• Schulrelevanz des beschriebenen Diagnosespektrums am höchsten<br />
III. Workshops und Foren<br />
• Nachsorgemaßnahmen im Verlauf sehr sinnvoll und nachhaltig<br />
Ausblick<br />
• Sehr gute Akzeptanz durch Klinik, Eltern und Schulen<br />
• Qualitative Verbesserung der ambulanten Versorgung<br />
• Vernetzung/Nachsorge Psychiatrie und Schule deutlich verdichtet<br />
• Steigende Nachfrage<br />
Grenzen und Gefahren<br />
• Klares Profi l schaffen und erhalten<br />
• Keine „offene Nebentür“ für alle problematischen Schüler schaffen<br />
• Keine „Warteschleife“ bei bereits bekanntem höherem Behandlungsbedarf<br />
Wie reagieren die Kinder?<br />
• Können sich gut auf neue Situation einlassen<br />
• Oft aus Krisensituation „erlöst“<br />
• Integration für Kinder mit Schulausschluss/„krank“ geschriebene Kinder<br />
• Schnelle Hilfe entlastet das gesamte System<br />
Grenzen kranker Kinder – Starke Eltern – Starke Kinder<br />
Andrea Huber<br />
Trainerin für Starke Eltern-Starke Kinder®, Moosburg<br />
53<br />
Einleitung:<br />
Die positive Bedeutung von Grenzen für das menschliche Leben, insbesondere<br />
für die Entwicklung von Kindern, ist unbestritten. Grenzen geben<br />
Sicherheit und Orientierung, sie vermitteln das Gefühl von Zugehörigkeit<br />
und Verlässlichkeit, lassen die eigene Stärke spüren und die eigene Einzigartigkeit.<br />
Aus diesen Gefühlen heraus fühlen sich Menschen ermutigt,<br />
neue Ziele anzugehen und in die Zukunft zu planen. Hingegen sind ohne<br />
Grenzen weder Individualität noch Identität möglich, die Ausbildung von<br />
Autonomie und Eigenständigkeit wird behindert.<br />
Im Krankenhaus werden die Grenzen der Patienten (gleich ob klein oder<br />
groß) immer wieder überschritten. Ich nehme sogar an, dass dies vielen<br />
Ärzten und Pfl egekräften gar nicht bewusst ist: jede erzwungene Tabletteneinnahme,<br />
jedes Blutabnehmen, jede Spritze ist ein Eingriff in die<br />
Selbstbestimmung und ein Überschreiten der körperlichen Grenzen des<br />
Patienten. Ganz klar: all diese Dinge müssen sein – dennoch plädiere ich<br />
dafür, sich die Grenzen kranker Kinder bewusst zu machen und, wo möglich,<br />
noch stärker darauf Rücksicht zu nehmen.<br />
Gleichzeitig tun sich fast alle Eltern von (lebensbedrohlich) erkrankten Kindern<br />
schwer damit, klare Grenzen zu setzen. Sowohl die eigenen Grenzen<br />
verschwimmen als auch die der Kinder – sie werden in Themenkomplexe<br />
involviert, die sie eigentlich nichts angehen; sie werden mit Entscheidungen<br />
konfrontiert, die sie überfordern. Immer wieder lässt sich beobachten,<br />
dass die Grenzen, die bislang ganz selbstverständlich in der Erziehung<br />
des Kindes galten, ihre Bedeutung verlieren: plötzlich ist alles erlaubt, jeder<br />
Wunsch des Kinder soll erfüllt werden – als Kompensation für all das<br />
Schlimme, das es erleiden muss und wohl auch aus der Angst heraus, das<br />
Kind könne sterben.<br />
Die Folgen sind oft erst viel später ersichtlich, weit nach der Gesundung<br />
des Kindes: Anpassungsschwierigkeiten in Schule und Familie, der Verlust<br />
des Gefühls für angemessene eigene Grenzen, extreme Grenzsetzungen,<br />
extrem grenzüberschreitendes Verhalten aber auch Ängste und Depressionen<br />
zeigen sich bei vielen Kindern, die eine schwere, lebensbedrohliche<br />
Krankheit überstanden haben.<br />
Einzel-, nachfolgend Gruppenarbeit zu folgenden Fragen:<br />
1. Wie markieren kranke Kinder ihre Grenzen?<br />
2. Kenne ich Kinder, die dies nicht tun? Wie verhalten sie sich?<br />
3. Was sind meine eigenen Grenzen im Umgang mit dem kranken Kind?<br />
4. Wie vertrete ich diese Grenzen? Wie mache ich sie deutlich?<br />
5. Wo fällt es (mir) schwer, Grenzen zu setzen?