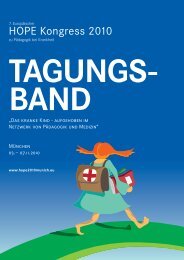HOPE Kongress 2010 - Hope Congress Munich 2010
HOPE Kongress 2010 - Hope Congress Munich 2010
HOPE Kongress 2010 - Hope Congress Munich 2010
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
III. Workshops und Foren<br />
92 7th European <strong>HOPE</strong> <strong>Congress</strong> <strong>2010</strong><br />
Die unterschiedlichen Schullaufbahnen und Jahrgangsstufen unserer<br />
Schüler/innen machen eine Differenzierung und Individualisierung des<br />
Unterrichts dringend notwendig. In Projekten, die wir etwa sechsmal im<br />
Schuljahr durchführen, kann dieses Ziel verwirklicht werden.<br />
Die Schüler/innen kommen alle zusammen (dann hat die Lerngruppe<br />
etwa die Größe einer „normalen“ Schulklasse). Sodann werden sie mit<br />
dem Thema des Projekts bekannt gemacht, haben auch noch selbst<br />
die Möglichkeit, das Thema zu gestalten und evt. zu akzentuieren. In<br />
einzelnen, thematisch bestimmten Arbeitsgruppen bearbeiten sie nun mit<br />
unterschiedlichen Methoden und Arbeitsweisen gemeinsam das Thema<br />
der Gruppe. Je nach Fähigkeit und Können arbeiten sie individuell und doch<br />
gemeinsam an einer Thematik und präsentieren die Arbeitsergebnisse<br />
in der Gruppe. Die Projekte decken Themen aus den Lehrplänen der<br />
unterschiedlichen Schularten ab und es wird versucht, eine Schnittmenge<br />
aus den Lehrplänen zu gewinnen. So konnte z.B. das Projekt: „Deutschland<br />
im 20. Jahrhundert“ fächer- und jahrgangsübergreifend behandelt werden.<br />
Den Abschluss eines jeden Projektes bildet ein gemeinsames Erlebnis<br />
(Fest, Essen, Modenschau durch die Jahrhunderte, Ausflug, usw.)<br />
Die Nachhaltigkeit des Lernerfolgs und die positive oder negative<br />
Rückmeldung der Jugendlichen wird am Ende des Projektes, das etwa zwei<br />
Wochen dauert, durch einen Evaluationsbogen festgehalten.<br />
Auf diese Weise kann individuell auf den einzelnen Schüler eingegangen<br />
werden, seine Stärken betont, sein Schwächen bearbeitet und das<br />
Lernen in der Gruppe (Teamarbeit und Soziales Lernen, Stärkung des<br />
Selbstbewusstseins) gefördert werden. Benotung und Leistungsdruck gibt<br />
es bei dieser Art des Lernens nicht. Gerade für Patienten mit Schulphobie<br />
und sozialen Ängsten kann diese Methode die Freude am Lernen und an<br />
der Schule fördern und so zur allgemeinen Gesundung beitragen.<br />
Die Teilnehmer/innen des Workshops lernten nach einem Rundgang<br />
durch Schule und Klinik die spezielle Arbeitsweise der Schule kennen<br />
und bekamen durch umfangreiches Filmmaterial einen Eindruck von<br />
dem projektorientierten und individuellen Unterrichten am Standort<br />
Rottmannshöhe.<br />
Talk 2 me: - Migration und Sprache - Sprache als Instrument der<br />
Integration - Was tun bei Sprachstörungen ?<br />
Dr. med. Martin Sobanski<br />
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie<br />
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin<br />
Oberärztliche Leitung der Abteilung Sprach- und Entwicklungsstörungen,<br />
Heckscher-Klinikum<br />
Sprachliche Kommunikation ist ein wesentlicher Mediator interpersoneller<br />
Beziehungen. Störungen der Sprache wirken sich daher potentiell als<br />
Gefahr für die Integration von Menschen in ihrem Umfeld aus. Etwa<br />
5-7% aller Kinder sind von einer sog. Teilleistungsstörung im Bereich<br />
Sprache betroffen. Diese expressiven und rezeptiven Sprachstörungen<br />
gehören damit zu den häufigsten Entwicklungsstörungen. Bei genauer<br />
Diagnostik finden sich zudem regelmäßig neurokognitive Defizite,<br />
welche sich klinisch und im Schulalltag auswirken können. Auch bergen<br />
Sprachentwicklungsstörungen ein hohes Risiko für die Ausbildung<br />
psychia t rischer Störungen.<br />
Bis vor wenigen Jahren war die Forschung im Bereich der Sprachstörungen<br />
rein monolingual geprägt. Mehrsprachigkeit ist heute weltweit eher<br />
der Normal- als der Ausnahmefall. Globalisierung und zunehmende<br />
Migrationsbewegungen lassen dies auch in Deutschland deutlich werden.<br />
Dabei kann Mehrsprachigkeit als Risiko und als Chance betrachtet<br />
werden. Wie allerdings wirkt sich eine Sprachentwicklungsstörung bei<br />
Mehrsprachigkeit aus? Erkennen wir die spezifische Störung genau genug,<br />
um die Hochrisikogruppe ‚Sprachstörungen bei Mehrsprachigkeit‘ weder<br />
unter- noch überzudiagnostizieren?<br />
Die Ergebnisse der PISA-Studien in Deutschland zeigen eine Benachteiligung<br />
von Menschen mit Migrationshintergrund im Schulsystem. Kinder mit einer<br />
Sprachstörung sind mit einem zusätzlichen Integrationsrisiko behaftet.<br />
Das Impulsreferat wird schlaglichtartig die Themenkomplexe ‚Migration<br />
- Mehrsprachigkeit - Sprachentwicklungsstörung - psychiatrische<br />
Komorbidität und Prognose‘ beleuchten. Klinische Fallbeispiele sollen<br />
exemplarisch die Lebensumstände von betroffenen Kindern verdeutlichen.<br />
Im zweiten Teil des Workshops sind Diskussionsbeiträge zu den<br />
angesprochenen Themen erwünscht. Sehr willkommen sind zudem<br />
Berichte über die entsprechenden Versorgungsstrukturen in den<br />
Herkunftsländern der Workshopteilnehmer.<br />
(siehe Website: www.hope<strong>2010</strong>.eu)<br />
Child Life Programs<br />
Integrating the educational, recreational and emotional needs<br />
Olga Lizasoain<br />
Dpt. Of Education, Lecturer, University of Navarra. SPAIN<br />
INTRODUCTION<br />
• This communication focuses on the American Child Life programs<br />
• designed to meet the educational and psychosocial needs of paediatric<br />
patients and their families generated as a result of hospitalization and<br />
illness<br />
What is the purpose of my presentation?<br />
1. Through this communication is intended to show a specific pattern of<br />
action as a mean to inform and promote the work of European hospital<br />
teachers with the idea to push them go far<br />
2. To insist on the idea that together with academic activities and the<br />
school curriculum is essential to take into account recreational and<br />
emotional aspects, focusing on the specific situation of illness and<br />
hospitalization of the students, including family support<br />
3. And to stress that Hospital teachers must integrate all this in their role,<br />
always collaborating with all professionals involved in the care of young<br />
patients.<br />
Objective of the Child Life programs<br />
In a general way, they have the goal of normalizing the life of young patients<br />
and their families basis on an environmental approach that involves health<br />
professionals, schools and the wider community.<br />
More specifically, I will focus on five points of these programs:<br />
I Psychological intervention<br />
II Recreational intervention<br />
III Family intervention<br />
IV Interdisciplinary collaboration<br />
Starting with the first point: Psychological intervention<br />
I can say that a central aspect in the major objective of the Child life<br />
program is to reduce patient’s fears and anxiety caused by hospitalization<br />
and illnesst At the same time a great importance is done to inform<br />
properly about illness, treatments and hospital context Information and<br />
preparation for hospitalization are offered using the following strategies:<br />
Specific Intervention Strategies<br />
INFORMATIVE TECHNIQUES<br />
Sensory and procedural information<br />
Interview<br />
Videos<br />
Guided Tour