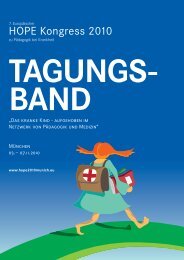HOPE Kongress 2010 - Hope Congress Munich 2010
HOPE Kongress 2010 - Hope Congress Munich 2010
HOPE Kongress 2010 - Hope Congress Munich 2010
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
78 7th European <strong>HOPE</strong> <strong>Congress</strong> <strong>2010</strong><br />
Bei der Interpretation der Ergebnisse ist jedoch zu beachten, dass der<br />
Anteil der Schüler/-innen, bei denen keine Angabe zum Schulbesuch zur<br />
Verfügung steht, bei der Treatmentgruppe nur 6,7% (T1, T3) bzw. 11,6% (T2)<br />
ist. In der Vergleichsgruppe liegt dieser Anteil zu allen drei Messzeitpunkten<br />
bei 21,4%. Demnach müssten die Schüler/-innen ohne Angabe zum<br />
Schulbesuch noch auf die Items regelmäßig, partiell und gar nicht verteilt<br />
werden, dadurch könnten sich die Ergebnisse der Treatmentgruppe und<br />
Vergleichsgruppe verändern und so auch ihre Relationen zueinander.<br />
Bedingt durch das Längsschnitt-Design des Forschungsprojektes nimmt<br />
die Stichprobengröße der Treatmentgruppe von T1 zu T3 ab. Darüber hinaus<br />
werden derzeit noch weitere Daten für die Vergleichsgruppe ermit<br />
telt. Eine weitere wichtige Fragestellung: Welche Reibungsverluste<br />
entstehen an den Schnittstellen Psychiatrie –Elternhaus–Heimat schule<br />
im Kontext psychischer Erkrankungen im Zusammenhang mit einer<br />
Schulverweigerungsproblematik und Schülern/-innen mit Schulproblemen?<br />
wird derzeit noch mit qualitativen Analyseverfahren untersucht.<br />
9. Fazit<br />
Ein Großteil der Schüler/-innen, die bei ihrer Wiedereingliederung in die<br />
Regelschule unter-stützt wurden, profitiert vom Unterstützungsangebot<br />
während ihres Klinikaufenthaltes und 2 Monate danach.<br />
Bei der Interpretation der Ergebniswerte zu T3 ist die Varianz der<br />
Stichprobengröße zu berücksichtigen. Zu diesem Zeitpunkt ist noch<br />
schwer einzuschätzen, wie erfolgreich diese Art der Intervention für einen<br />
regelmäßigen und dauerhaften Schulbesuch wirklich ist.<br />
10. Ausblick<br />
In zukünftigen Forschungsvorhaben sollte das Phänomen der<br />
Schulvermeidung auf individueller, institutioneller und systemischer<br />
Ebene untersucht werden. Die Ziele sind eine Syste-matisierung der<br />
Problematiken auf allen drei Ebenen, die Bestimmung der gravierendsten<br />
Problematiken und die Generierung von Lösungen hierfür. Der Zugang<br />
zum Feld sollte durch eine Intervention gewählt werden, die gleichzeitig<br />
erlaubt, die Entwicklungen auf der individuellen Ebene weiterzuverfolgen<br />
und zu untersuchen, wie wirksam die Anstrengungen der verschiedenen<br />
Systeme sind.<br />
11. Literaturangaben<br />
Ciompi, L. (1982). Affektlogik. Über die Struktur der Psyche und ihre Entwicklung. Ein Beitrag zur<br />
Schizophrenieforschung. Stuttgart: Klett-Cotta.<br />
Ellis, A. & Hoellen, B. (2004). Die Rational Emotive Verhaltenstherapie - Reflexionen und Neubestimmungen.<br />
Stuttgart: Pfeiffer.<br />
Haep, A., Weber, P.A., Welling, V. & Steins, G. (2011). Psychopathologisierung von Kindern und Jugendlichen,<br />
die Rolle des Elternhauses und der Schule und die Relevanz einer sozialpsychologischen Perspektive. In E.<br />
Witte (Hrsg.). Sozialpsychologie, Sozialisation und Schule, 26. Hamburger Symposium zur Methodologie der<br />
Sozialpsychologie (im Druck). Berlin: Pabst Science Publishers.<br />
Haep, A., Steins, G. & Wilde, J. (2011). Materialpaket Soziales Lernen Sekundarstufe I. Donauwörth: Auer.<br />
Harter-Meyer, R. & Weidenbach, M. (2001). Bildung und Krankheit. Herausforderungen für Lehrkräfte.<br />
Münster: LIT Verlag.<br />
Hirsch-Herzogenrath, S. & Schleider, K. (<strong>2010</strong>). Reintegration psychisch kranker Schülerinnen und Schüler<br />
in die Allgemeine Schule aus Sicht der Schulen für Kranke – empirische Befunde. In: Zeitschrift für<br />
Heilpädagogik, 9, 351-359.<br />
Kuchenbecker, A. (2002). Behandlungsende und Entlassvorbereitung: die Begleitung von Abschied,<br />
Trennung und Übergang. In: Kuchenbecker, A. (Hrsg.). Pädagogischpflegerische Praxis in der Kinder- und<br />
Jugendpsychiatrie, Dortmund, 137–153<br />
Steins, G. (2008). Schule trotz Krankheit – Eine Evaluation von Unterricht mit kranken Kindern und<br />
Jugendlichen und Implikationen für die allgemeinbildenden Schulen. Lengerich: Pabst Science Publishers.<br />
Waters, V., Schwartz, D., Gravemeier, R., Grünke, M. (2003). Fritzchen Flunder und Nora Nachtigall. Bern:<br />
Huber.<br />
III. Workshops und Foren<br />
Weber, P. A., Steins, G., Brendgen, A., Haep, A. (2008). Entwicklung weiterführender Maßnahmen. In: Steins<br />
Gisela: Schule trotz Krankheit – Eine Evaluation von Unterricht mit kranken Kindern und Jugendlichen und<br />
Implikationen für die allgemeinbildenden Schulen (316-353). Lengerich: Pabst Science Publishers.<br />
Wertgen, A. (2009). Auf den Übergang kommt es an! Pädagogisch begleitet Schulrückführung als Angebot der<br />
Schule für Kranke für Schüler nach einem Psychiatrieaufenthalt. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 8, 308-319.<br />
Resilienz – Kinder widerstandsfähig machen<br />
Dr. Edith Wölfl<br />
Sonderschulrektorin, Wichern-Zentrum, München<br />
Definition<br />
Psychische Widerstandsfähigkeit<br />
gegenüber<br />
• biologischen,<br />
• psychologischen und<br />
• psycholsozialen Entwicklungsrisiken.<br />
Wichtigste Studien<br />
• Emmy Werner 1993: Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz Kauai-Studie<br />
• Laucht et. al. 2000: Mannheimer Längsschnittstudie<br />
Risikofaktoren<br />
Risikofaktoren werden als krankheitsbegünstigende, risikoerhöhende und<br />
entwicklungshemmende Merkmale definiert, von denen eine Ge fähr dung<br />
der gesunden Entwicklung des Kindes ausgeht.<br />
(Holtmann/Schmidt 2004 nach Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2009 S. 20)<br />
Primäre<br />
Vulnerabilitätsfaktoren<br />
• Prä-, peri- und postnatale Faktoren<br />
• Neuropsychologische Defizite<br />
• Genetische Faktoren<br />
• Chronische Erkrankungen<br />
• Schwieriges Temperament<br />
• Frühes impulsives Verhalten<br />
• Geringe Fähigkeit zur Selbstregulation von Anspannung und<br />
Entspannung<br />
• Geringe kognitive Fähigkeiten<br />
Soziale Risikofaktoren<br />
• Niedriger sozioökonomischer Status<br />
• Armut<br />
• Migrationshintergrund bei niedrigem sozioökonomischem Status<br />
• Aversives Wohnumfeld<br />
• Kriminalität der Eltern<br />
• Obdachlosigkeit<br />
• Soziale Isolation der Familie<br />
• Mobbing /Ablehnung durch Gleichaltrige<br />
• Häufige Schulwechsel oder Umzüge<br />
Risikofaktoren in der Familie<br />
• Chronische Disharmonie<br />
• Elterliche Trennung/Scheidung<br />
• Alkohol-/Drogenmissbrauch der Eltern<br />
• Psychische Störungen oder Erkrankungen eines bzw. beider Elternteile<br />
• Chronische oder lang anhaltende schwere Erkrankung eines Elternteils<br />
• Niedriges Bildungsniveau der Eltern<br />
• Abwesenheit eines Elternteils/alleinerziehender Elternteil<br />
• Erziehungsdefizite und ungünstige Erziehungspraktiken<br />
• Schwangerschaft der Mutter unter 18 Jahren<br />
• Unerwünschte Schwangerschaft<br />
• Geschwister mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung<br />
• Mehr als vier Geschwister<br />
Sehr schwere Risikofaktoren<br />
• Sexueller Missbrauch<br />
• Verlust eines nahen Familienangehörigen<br />
• Gewalt in der Familie gegenüber dem Kind<br />
• Gewalt der Eltern untereinander<br />
• Kriegs- oder Terrorerlebnisse, Flucht<br />
• Naturkatastrophen<br />
Wirkmechanismen<br />
• Anhäufung der Belastungen<br />
• Dauer der Belastungen<br />
• Alter und Entwicklungsstand des Kindes