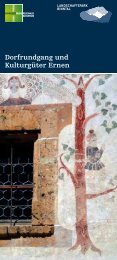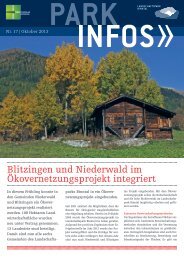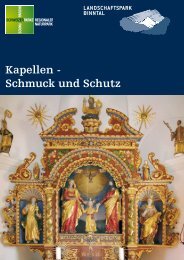RZ Inhalt A5 64 Seiten 2011-12.indd - Landschaftspark Binntal
RZ Inhalt A5 64 Seiten 2011-12.indd - Landschaftspark Binntal
RZ Inhalt A5 64 Seiten 2011-12.indd - Landschaftspark Binntal
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
DIE STALLSCHEUNE<br />
Die Stallscheune ist zahlenmässig<br />
der wichtigste Ökonomiebau.<br />
Im Grundschema setzt sie sich<br />
aus einem niederen Stallgeschoss<br />
und einem aufgesetzten<br />
höheren Heuspeicher zusammen.<br />
Das Stallgeschoss ist an der vorderen<br />
Giebelwand durch einen<br />
in der Gebäudeachse ausgesparten<br />
Eingang zugänglich. Beidseits<br />
des Stalleingangs ansteigende<br />
Aussentreppen erschliessen den<br />
Heuspeicher.<br />
DER STADEL<br />
Der Stadel ist das Gebäude des<br />
Getreidebaus. Dem gestelzten<br />
Oberbau kommt eine Doppelfunktion<br />
als Garbenspeicher und<br />
Dreschplatz zu. Im Innern befindet<br />
sich in der Gebäudeachse ein<br />
gangartiges Tenn. Hier wurde mit<br />
einem Flegel das Korn aus den<br />
Ähren geschlagen. In den <strong>Seiten</strong>achsen<br />
links und rechts des<br />
Tenns liegen die Garbenspeicher,<br />
die mit einer Konstruktion aus<br />
Bindbalken, Ständern und Latten<br />
in Gefache unterteilt werden.<br />
Hauslandschaft<br />
und Siedlung<br />
Die Lage des jeweiligen Kulturlandes bestimmt den<br />
Standort der Gebäude. In der Zone der Heimgüter stehen<br />
das Wohnhaus und der Speicher, zum Teil auch<br />
Stallscheune und Stadel in geschlossenen Siedlungen<br />
(Haufendorf-Typus). Die Stallscheunen sind teilweise<br />
aber auch als Ausfütterungsställe verstreut auf den<br />
Mähwiesen erbaut. Um den mühsamen Heutransport<br />
zurück ins Dorf zu umgehen, brachte man das Vieh<br />
zum Heu. Im Winter war der Umzug des Viehs von<br />
Stall zu Stall (im Goms «Firefare» genannt) oder die Besorgung<br />
des Viehs wegen der Lawinen oft gefährlich.<br />
So berichtet z. B. der «Walliser Bote» vom 13. Januar<br />
1912 von Binn:<br />
«Am Dreikönigstag abends hat es hier in einer für<br />
den Kundigen zu befürchtenden Weise angefangen zu<br />
schneien, so dass sich die Viehverpfleger, deren Vieh<br />
weiter vom Hause entfernt ist, stark verproviantiert<br />
und sonst mit dem Nötigsten versehen, noch am selben<br />
Abend in ihre Ställe begaben, um von ihren Herden<br />
nicht abgeschlossen zu werden.»<br />
Mühlebach und seine spätmittelalterlichen<br />
Häuser<br />
Mühlebach besitzt den ältesten Dorfkern der<br />
Schweiz in Holzbauweise. Die Siedlung liegt am alten<br />
Gommerweg südlich am Fusse des Hügels mit der Kapelle<br />
der Heiligen Familie. Gemäss Jahresringanalysen<br />
stehen hier auf kleinstem Raum zwölf Gebäude,<br />
die in der Zeit zwischen 1389 und 1497 errichtet worden<br />
sind, darunter das um 1435 erbaute Geburtshaus<br />
von Kardinal Matthäus Schiner (um 1465-1522), der<br />
als Bischof von Sitten mit seinen Söldnertruppen die<br />
europäische Politik mitbestimmt hat. In dieser Zeit erlebte<br />
Mühlebach eine eigentliche Hochblüte und stellte<br />
verschiedentlich den Landeshauptmann des Wallis.<br />
Nach dieser Zeit nahm aber die politische Bedeutung<br />
Mühlebachs ab. Und im 19. Jh. geriet Mühlebach - wie<br />
Ernen und Steinhaus - durch den Bau der Furkastrasse<br />
um 1860 auf der gegenüberliegenden Talseite ins<br />
verkehrstechnische Abseits. Im «Geographischen Lexikon»<br />
der Schweiz von 1908 wird Mühlebach als «abgelegener<br />
und ärmlicher Ort» bezeichnet.<br />
DER NAME<br />
MÜHLEBACH<br />
Johannes Stumpf erwähnt im<br />
Jahre 1548 in seiner Chronik die<br />
«milli nen» von Mühlebach. Am<br />
westlichen Rande der Siedlung<br />
war längs des Milibaches mit<br />
den Mühlen, der Säge und<br />
Walke sowie der «Salzribi»<br />
ein kleines «Industriequartier»<br />
ent standen. Noch zu Beginn des<br />
20. Jahrhunderts wurde laut<br />
Meldung im «Walliser Boten»<br />
vom 7. Dezember 1901 die alte<br />
Hammer schmiede neu eröffnet.<br />
Den Mühlen verdanken Dorf und<br />
Bach den Namen.