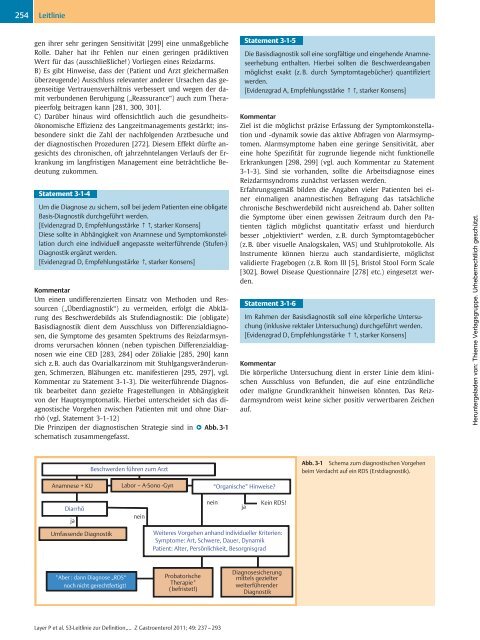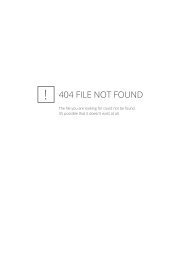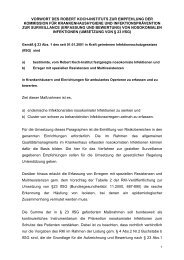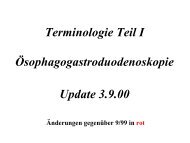S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie ... - DGVS
S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie ... - DGVS
S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie ... - DGVS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
254<br />
<strong>Leitlinie</strong><br />
gen ihrer sehr geringen Sensitivität [299] eine unmaßgebliche<br />
Rolle. Daher hat ihr Fehlen nur einen geringen prädiktiven<br />
Wert für das (ausschließliche!) Vorliegen eines Reizdarms.<br />
B) Es gibt Hinweise, dass der (Patient und Arzt gleichermaßen<br />
überzeugende) Ausschluss relevanter anderer Ursachen das gegenseitige<br />
Vertrauensverhältnis verbessert und wegen der damit<br />
verbundenen Beruhigung („Reassurance“) auch zum Therapieerfolg<br />
beitragen kann [281, 300, 301].<br />
C) Darüber hinaus wird offensichtlich auch die gesundheitsökonomische<br />
Effizienz des Langzeitmanagements gestärkt; insbesondere<br />
sinkt die Zahl der nachfolgenden Arztbesuche und<br />
der diagnostischen Prozeduren [272]. Diesem Effekt dürfte angesichts<br />
des chronischen, oft jahrzehntelangen Verlaufs der Erkrankung<br />
im langfristigen Management eine beträchtliche Bedeutung<br />
zukommen.<br />
Statement 3-1-4<br />
Um die Diagnose zu sichern, soll bei jedem Patienten eine obligate<br />
Basis-Diagnostik durchgeführt werden.<br />
[Evidenzgrad D, Empfehlungsstärke ↑↑, starker Konsens]<br />
Diese sollte in Abhängigkeit von Anamnese und Symptomkonstellation<br />
durch eine individuell angepasste weiterführende (Stufen-)<br />
Diagnostik ergänzt werden.<br />
[Evidenzgrad D, Empfehlungsstärke ↑, starker Konsens]<br />
Kommentar<br />
Um einen undifferenzierten Einsatz von Methoden und Ressourcen<br />
(„Überdiagnostik“) zu vermeiden, erfolgt die Abklärung<br />
des Beschwerdebilds als Stufendiagnostik: Die (obligate)<br />
Basisdiagnostik dient dem Ausschluss von Differenzialdiagnosen,<br />
die Symptome des gesamten Spektrums des <strong>Reizdarmsyndrom</strong>s<br />
verursachen können (neben typischen Differenzialdiagnosen<br />
wie eine CED [283, 284] oder Zöliakie [285, 290] kann<br />
sich z.B. auch das Ovarialkarzinom mit Stuhlgangsveränderungen,<br />
Schmerzen, Blähungen etc. manifestieren [295, 297], vgl.<br />
Kommentar zu Statement 3-1-3). Die weiterführende Diagnostik<br />
bearbeitet dann gezielte Fragestellungen in Abhängigkeit<br />
von der Hauptsymptomatik. Hierbei unterscheidet sich das diagnostische<br />
Vorgehen zwischen Patienten mit und ohne Diarrhö<br />
(vgl. Statement 3-1-12)<br />
Die Prinzipen der diagnostischen Strategie sind in ●▶ Abb. 3-1<br />
schematisch zusammengefasst.<br />
Anamnese + KU<br />
Diarrhö<br />
ja<br />
Umfassende Diagnostik<br />
Beschwerden führen zum Arzt<br />
*Aber : dann Diagnose „RDS“<br />
noch nicht gerechtfertigt!<br />
Labor – A-Sono -Gyn<br />
nein<br />
Probatorische<br />
Therapie*<br />
(befristet!)<br />
nein<br />
Statement 3-1-5<br />
Die Basisdiagnostik soll eine sorgfältige und eingehende Anamneseerhebung<br />
enthalten. Hierbei sollten die Beschwerdeangaben<br />
möglichst exakt (z. B. durch Symptomtagebücher) quantifiziert<br />
werden.<br />
[Evidenzgrad A, Empfehlungsstärke ↑↑, starker Konsens]<br />
Kommentar<br />
Ziel ist die möglichst präzise Erfassung der Symptomkonstellation<br />
und -dynamik sowie das aktive Abfragen von Alarmsymptomen.<br />
Alarmsymptome haben eine geringe Sensitivität, aber<br />
eine hohe Spezifität für zugrunde liegende nicht funktionelle<br />
Erkrankungen [298, 299] (vgl. auch Kommentar zu Statement<br />
3-1-3). Sind sie vorhanden, sollte die Arbeitsdiagnose eines<br />
<strong>Reizdarmsyndrom</strong>s zunächst verlassen werden.<br />
Erfahrungsgemäß bilden die Angaben vieler Patienten bei einer<br />
einmaligen anamnestischen Befragung das tatsächliche<br />
chronische Beschwerdebild nicht ausreichend ab. Daher sollten<br />
die Symptome über einen gewissen Zeitraum durch den Patienten<br />
täglich möglichst quantitativ erfasst und hierdurch<br />
besser „objektiviert“ werden, z. B. durch Symptomtagebücher<br />
(z.B. über visuelle Analogskalen, VAS) und Stuhlprotokolle. Als<br />
Instrumente können hierzu auch standardisierte, möglichst<br />
validierte Fragebogen (z.B. Rom III [5], Bristol Stool Form Scale<br />
[302], Bowel Disease Questionnaire [278] etc.) eingesetzt werden.<br />
Statement 3-1-6<br />
Weiteres Vorgehen anhand individueller Kriterien:<br />
Symptome: Art, Schwere, Dauer, Dynamik<br />
Patient: Alter, Persönlichkeit, Besorgnisgrad<br />
Layer P et al. <strong>S3</strong>-<strong>Leitlinie</strong> zur <strong>Definition</strong>,… Z Gastroenterol 2011; 49: 237 –293<br />
Im Rahmen der Basisdiagnostik soll eine körperliche Untersuchung<br />
(inklusive rektaler Untersuchung) durchgeführt werden.<br />
[Evidenzgrad D, Empfehlungsstärke ↑↑, starker Konsens]<br />
Kommentar<br />
Die körperliche Untersuchung dient in erster Linie dem klinischen<br />
Ausschluss von Befunden, die auf eine entzündliche<br />
oder maligne Grundkrankheit hinweisen könnten. Das <strong>Reizdarmsyndrom</strong><br />
weist keine sicher positiv verwertbaren Zeichen<br />
auf.<br />
“Organische” Hinweise?<br />
ja<br />
Kein RDS!<br />
Diagnosesicherung<br />
mittels gezielter<br />
weiterführender<br />
Diagnostik<br />
Abb. 3-1 Schema zum diagnostischen Vorgehen<br />
beim Verdacht auf ein RDS (Erstdiagnostik).<br />
Heruntergeladen von: Thieme Verlagsgruppe. Urheberrechtlich geschützt.