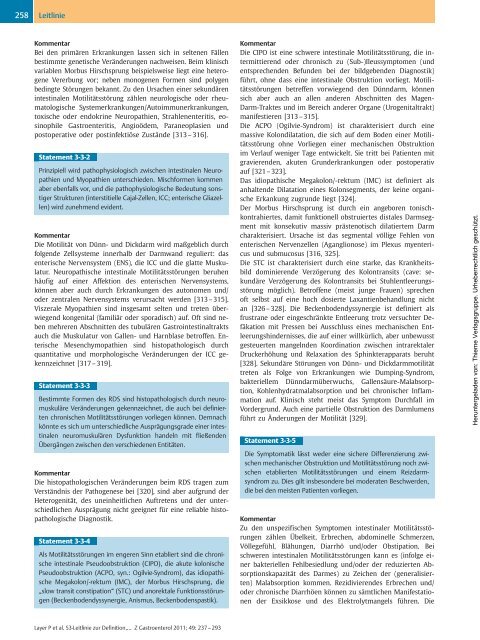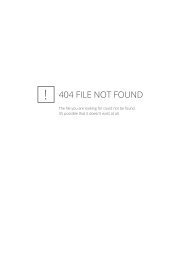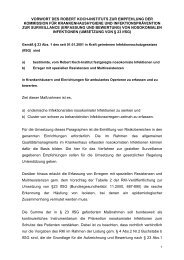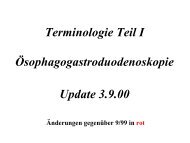S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie ... - DGVS
S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie ... - DGVS
S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie ... - DGVS
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
258<br />
<strong>Leitlinie</strong><br />
Kommentar<br />
Bei den primären Erkrankungen lassen sich in seltenen Fällen<br />
bestimmte genetische Veränderungen nachweisen. Beim klinisch<br />
variablen Morbus Hirschsprung beispielsweise liegt eine heterogene<br />
Vererbung vor; neben monogenen Formen sind polygen<br />
bedingte Störungen bekannt. Zu den Ursachen einer sekundären<br />
intestinalen Motilitätsstörung zählen neurologische oder rheumatologische<br />
Systemerkrankungen/Autoimmunerkrankungen,<br />
toxische oder endokrine Neuropathien, Strahlenenteritis, eosinophile<br />
Gastroenteritis, Angioödem, Paraneoplasien und<br />
postoperative oder postinfektiöse Zustände [313 – 316].<br />
Statement 3-3-2<br />
Prinzipiell wird pathophysiologisch zwischen intestinalen Neuropathien<br />
und Myopathien unterschieden. Mischformen kommen<br />
aber ebenfalls vor, und die pathophysiologische Bedeutung sonstiger<br />
Strukturen (interstitielle Cajal-Zellen, ICC; enterische Gliazellen)<br />
wird zunehmend evident.<br />
Kommentar<br />
Die Motilität von Dünn- und Dickdarm wird maßgeblich durch<br />
folgende Zellsysteme innerhalb der Darmwand reguliert: das<br />
enterische Nervensystem (ENS), die ICC und die glatte Muskulatur.<br />
Neuropathische intestinale Motilitätsstörungen beruhen<br />
häufig auf einer Affektion des enterischen Nervensystems,<br />
können aber auch durch Erkrankungen des autonomen und/<br />
oder zentralen Nervensystems verursacht werden [313 –315].<br />
Viszerale Myopathien sind insgesamt selten und treten überwiegend<br />
kongenital (familiär oder sporadisch) auf. Oft sind neben<br />
mehreren Abschnitten des tubulären Gastrointestinaltrakts<br />
auch die Muskulatur von Gallen- und Harnblase betroffen. Enterische<br />
Mesenchymopathien sind histopathologisch durch<br />
quantitative und morphologische Veränderungen der ICC gekennzeichnet<br />
[317 –319].<br />
Statement 3-3-3<br />
Bestimmte Formen des RDS sind histopathologisch durch neuromuskuläre<br />
Veränderungen gekennzeichnet, die auch bei definierten<br />
chronischen Motilitätsstörungen vorliegen können. Demnach<br />
könnte es sich um unterschiedliche Ausprägungsgrade einer intestinalen<br />
neuromuskulären Dysfunktion handeln mit fließenden<br />
Übergängen zwischen den verschiedenen Entitäten.<br />
Kommentar<br />
Die histopathologischen Veränderungen beim RDS tragen zum<br />
Verständnis der Pathogenese bei [320], sind aber aufgrund der<br />
Heterogenität, des uneinheitlichen Auftretens und der unterschiedlichen<br />
Ausprägung nicht geeignet für eine reliable histopathologische<br />
Diagnostik.<br />
Statement 3-3-4<br />
Als Motilitätsstörungen im engeren Sinn etabliert sind die chronische<br />
intestinale Pseudoobstruktion (CIPO), die akute kolonische<br />
Pseudoobstruktion (ACPO, syn.: Ogilvie-Syndrom), das idiopathische<br />
Megakolon/-rektum (IMC), der Morbus Hirschsprung, die<br />
„slow transit constipation“ (STC) und anorektale Funktionsstörungen<br />
(Beckenbodendyssynergie, Anismus, Beckenbodenspastik).<br />
Layer P et al. <strong>S3</strong>-<strong>Leitlinie</strong> zur <strong>Definition</strong>,… Z Gastroenterol 2011; 49: 237 –293<br />
Kommentar<br />
Die CIPO ist eine schwere intestinale Motilitätsstörung, die intermittierend<br />
oder chronisch zu (Sub-)Ileussymptomen (und<br />
entsprechenden Befunden bei der bildgebenden Diagnostik)<br />
führt, ohne dass eine intestinale Obstruktion vorliegt. Motilitätsstörungen<br />
betreffen vorwiegend den Dünndarm, können<br />
sich aber auch an allen anderen Abschnitten des Magen-<br />
Darm-Traktes und im Bereich anderer Organe (Urogenitaltrakt)<br />
manifestieren [313 –315].<br />
Die ACPO (Ogilvie-Syndrom) ist charakterisiert durch eine<br />
massive Kolondilatation, die sich auf dem Boden einer Motilitätsstörung<br />
ohne Vorliegen einer mechanischen Obstruktion<br />
im Verlauf weniger Tage entwickelt. Sie tritt bei Patienten mit<br />
gravierenden, akuten Grunderkrankungen oder postoperativ<br />
auf [321–323].<br />
Das idiopathische Megakolon/-rektum (IMC) ist definiert als<br />
anhaltende Dilatation eines Kolonsegments, der keine organische<br />
Erkankung zugrunde liegt [324].<br />
Der Morbus Hirschsprung ist durch ein angeboren tonischkontrahiertes,<br />
damit funktionell obstruiertes distales Darmsegment<br />
mit konsekutiv massiv prästenotisch dilatiertem Darm<br />
charakterisiert. Ursache ist das segmental völlige Fehlen von<br />
enterischen Nervenzellen (Aganglionose) im Plexus myentericus<br />
und submucosus [316, 325].<br />
Die STC ist charakterisiert durch eine starke, das Krankheitsbild<br />
dominierende Verzögerung des Kolontransits (cave: sekundäre<br />
Verzögerung des Kolontransits bei Stuhlentleerungsstörung<br />
möglich). Betroffene (meist junge Frauen) sprechen<br />
oft selbst auf eine hoch dosierte Laxantienbehandlung nicht<br />
an [326 –328]. Die Beckenbodendyssynergie ist definiert als<br />
frustrane oder eingeschränkte Entleerung trotz versuchter Defäkation<br />
mit Pressen bei Ausschluss eines mechanischen Entleerungshindernisses,<br />
die auf einer willkürlich, aber unbewusst<br />
gesteuerten mangelnden Koordination zwischen intrarektaler<br />
Druckerhöhung und Relaxation des Sphinkterapparats beruht<br />
[328]. Sekundäre Störungen von Dünn- und Dickdarmmotilität<br />
treten als Folge von Erkrankungen wie Dumping-Syndrom,<br />
bakteriellem Dünndarmüberwuchs, Gallensäure-Malabsorption,<br />
Kohlenhydratmalabsorption und bei chronischer Inflammation<br />
auf. Klinisch steht meist das Symptom Durchfall im<br />
Vordergrund. Auch eine partielle Obstruktion des Darmlumens<br />
führt zu Änderungen der Motilität [329].<br />
Statement 3-3-5<br />
Die Symptomatik lässt weder eine sichere Differenzierung zwischen<br />
mechanischer Obstruktion und Motilitätsstörung noch zwischen<br />
etablierten Motilitätsstörungen und einem <strong>Reizdarmsyndrom</strong><br />
zu. Dies gilt insbesondere bei moderaten Beschwerden,<br />
die bei den meisten Patienten vorliegen.<br />
Kommentar<br />
Zu den unspezifischen Symptomen intestinaler Motilitätsstörungen<br />
zählen Übelkeit, Erbrechen, abdominelle Schmerzen,<br />
Völlegefühl, Blähungen, Diarrhö und/oder Obstipation. Bei<br />
schweren intestinalen Motilitätsstörungen kann es (infolge einer<br />
bakteriellen Fehlbesiedlung und/oder der reduzierten Absorptionskapazität<br />
des Darmes) zu Zeichen der (generalisierten)<br />
Malabsorption kommen. Rezidivierendes Erbrechen und/<br />
oder chronische Diarrhöen können zu sämtlichen Manifestationen<br />
der Exsikkose und des Elektrolytmangels führen. Die<br />
Heruntergeladen von: Thieme Verlagsgruppe. Urheberrechtlich geschützt.