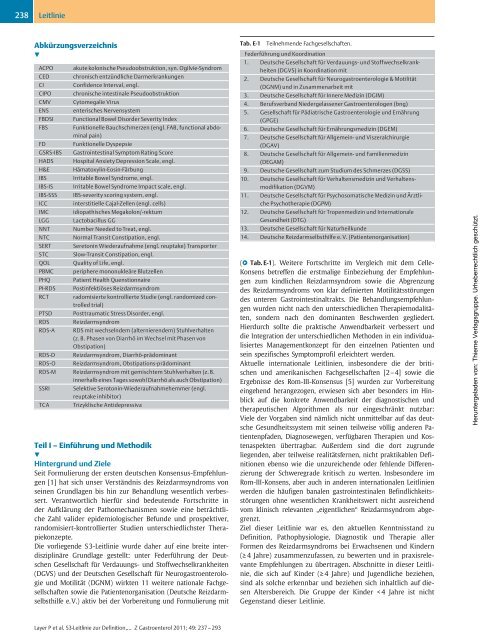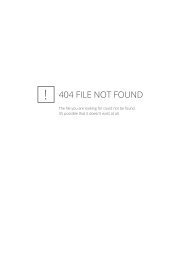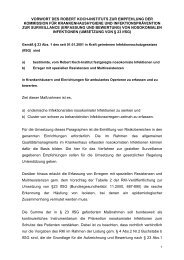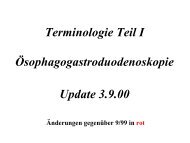S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie ... - DGVS
S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie ... - DGVS
S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie ... - DGVS
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
238<br />
<strong>Leitlinie</strong><br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
!<br />
ACPO akute kolonische Pseudoobstruktion, syn. Ogilvie-Syndrom<br />
CED chronisch entzündliche Darmerkrankungen<br />
CI Confidence Interval, engl.<br />
CIPO chronische intestinale Pseudoobstruktion<br />
CMV Cytomegalie Virus<br />
ENS enterisches Nervensystem<br />
FBDSI Functional Bowel Disorder Severity Index<br />
FBS Funktionelle Bauchschmerzen (engl. FAB, functional abdominal<br />
pain)<br />
FD Funktionelle Dyspepsie<br />
GSRS-IBS Gastrointestinal Symptom Rating Score<br />
HADS Hospital Anxiety Depression Scale, engl.<br />
H&E Hämatoxylin-Eosin-Färbung<br />
IBS Irritable Bowel Syndrome, engl.<br />
IBS-IS Irritable Bowel Syndrome Impact scale, engl.<br />
IBS-SSS IBS-severity scoring system, engl.<br />
ICC interstitielle Cajal-Zellen (engl. cells)<br />
IMC idiopathisches Megakolon/-rektum<br />
LGG Lactobacillus GG<br />
NNT Number Needed toTreat, engl.<br />
NTC Normal Transit Constipation, engl.<br />
SERT Seretonin Wiederaufnahme (engl. reuptake) Transporter<br />
STC Slow-Transit Constipation, engl.<br />
QOL Quality of Life, engl.<br />
PBMC periphere mononukleäre Blutzellen<br />
PHQ Patient Health Quenstionnaire<br />
PI-RDS Postinfektiöses <strong>Reizdarmsyndrom</strong><br />
RCT radomisierte kontrollierte Studie (engl. randomized controlled<br />
trial)<br />
PTSD Posttraumatic Stress Disorder, engl.<br />
RDS <strong>Reizdarmsyndrom</strong><br />
RDS-A RDS mit wechselndem (alternierendem) Stuhlverhalten<br />
(z. B. Phasen von Diarrhö im Wechsel mit Phasen von<br />
Obstipation)<br />
RDS-D <strong>Reizdarmsyndrom</strong>, Diarrhö-prädominant<br />
RDS-O <strong>Reizdarmsyndrom</strong>, Obstipations-prädominant<br />
RDS-M <strong>Reizdarmsyndrom</strong> mit gemischtem Stuhlverhalten (z. B.<br />
innerhalb eines Tages sowohl Diarrhö als auch Obstipation)<br />
SSRI Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (engl.<br />
reuptake inhibitor)<br />
TCA Trizyklische Antidepressiva<br />
Teil I – Einführung und Methodik<br />
!<br />
Hintergrund und Ziele<br />
Seit Formulierung der ersten deutschen Konsensus-Empfehlungen<br />
[1] hat sich unser Verständnis des <strong>Reizdarmsyndrom</strong>s von<br />
seinen Grundlagen bis hin zur Behandlung wesentlich verbessert.<br />
Verantwortlich hierfür sind bedeutende Fortschritte in<br />
der Aufklärung der Pathomechanismen sowie eine beträchtliche<br />
Zahl valider epidemiologischer Befunde und prospektiver,<br />
randomisiert-kontrollierter Studien unterschiedlichster Therapiekonzepte.<br />
Die vorliegende <strong>S3</strong>-<strong>Leitlinie</strong> wurde daher auf eine breite interdisziplinäre<br />
Grundlage gestellt: unter Federführung der Deutschen<br />
Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten<br />
(<strong>DGVS</strong>) und der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie<br />
und Motilität (DGNM) wirkten 11 weitere nationale Fachgesellschaften<br />
sowie die Patientenorganisation (Deutsche Reizdarmselbsthilfe<br />
e.V.) aktiv bei der Vorbereitung und Formulierung mit<br />
Layer P et al. <strong>S3</strong>-<strong>Leitlinie</strong> zur <strong>Definition</strong>,… Z Gastroenterol 2011; 49: 237 –293<br />
Tab. E-1 Teilnehmende Fachgesellschaften.<br />
Federführung und Koordination<br />
1. Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten<br />
(<strong>DGVS</strong>) in Koordination mit<br />
2. Deutsche Gesellschaft für Neurogastroenterologie & Motilität<br />
(DGNM) und in Zusammenarbeit mit<br />
3. Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM)<br />
4. Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen (bng)<br />
5. Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung<br />
(GPGE)<br />
6. Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM)<br />
7. Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie<br />
(DGAV)<br />
8. Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin<br />
(DEGAM)<br />
9. Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (DGSS)<br />
10. Deutsche Gesellschaft für Verhaltensmedizin und Verhaltensmodifikation<br />
(DGVM)<br />
11. Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche<br />
Psychotherapie (DGPM)<br />
12. Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin und Internationale<br />
Gesundheit (DTG)<br />
13. Deutsche Gesellschaft für Naturheilkunde<br />
14. Deutsche Reizdarmselbsthilfe e. V. (Patientenorganisation)<br />
(●▶ Tab. E-1). Weitere Fortschritte im Vergleich mit dem Celle-<br />
Konsens betreffen die erstmalige Einbeziehung der Empfehlungen<br />
zum kindlichen <strong>Reizdarmsyndrom</strong> sowie die Abgrenzung<br />
des <strong>Reizdarmsyndrom</strong>s von klar definierten Motilitätsstörungen<br />
des unteren Gastrointestinaltrakts. Die Behandlungsempfehlungen<br />
wurden nicht nach den unterschiedlichen Therapiemodalitäten,<br />
sondern nach den dominanten Beschwerden gegliedert.<br />
Hierdurch sollte die praktische Anwendbarkeit verbessert und<br />
die Integration der unterschiedlichen Methoden in ein individualisiertes<br />
Managementkonzept für den einzelnen Patienten und<br />
sein spezifisches Symptomprofil erleichtert werden.<br />
Aktuelle internationale <strong>Leitlinie</strong>n, insbesondere die der britischen<br />
und amerikanischen Fachgesellschaften [2–4] sowie die<br />
Ergebnisse des Rom-III-Konsensus [5] wurden zur Vorbereitung<br />
eingehend herangezogen, erwiesen sich aber besonders im Hinblick<br />
auf die konkrete Anwendbarkeit der diagnostischen und<br />
therapeutischen Algorithmen als nur eingeschränkt nutzbar:<br />
Viele der Vorgaben sind nämlich nicht unmittelbar auf das deutsche<br />
Gesundheitssystem mit seinen teilweise völlig anderen Patientenpfaden,<br />
Diagnosewegen, verfügbaren Therapien und Kostenaspekten<br />
übertragbar. Außerdem sind die dort zugrunde<br />
liegenden, aber teilweise realitätsfernen, nicht praktikablen <strong>Definition</strong>en<br />
ebenso wie die unzureichende oder fehlende Differenzierung<br />
der Schweregrade kritisch zu werten. Insbesondere im<br />
Rom-III-Konsens, aber auch in anderen internationalen <strong>Leitlinie</strong>n<br />
werden die häufigen banalen gastrointestinalen Befindlichkeitsstörungen<br />
ohne wesentlichen Krankheitswert nicht ausreichend<br />
vom klinisch relevanten „eigentlichen“ <strong>Reizdarmsyndrom</strong> abgegrenzt.<br />
Ziel dieser <strong>Leitlinie</strong> war es, den aktuellen Kenntnisstand zu<br />
<strong>Definition</strong>, <strong>Pathophysiologie</strong>, Diagnostik und Therapie aller<br />
Formen des <strong>Reizdarmsyndrom</strong>s bei Erwachsenen und Kindern<br />
(≥ 4 Jahre) zusammenzufassen, zu bewerten und in praxisrelevante<br />
Empfehlungen zu übertragen. Abschnitte in dieser <strong>Leitlinie</strong>,<br />
die sich auf Kinder (≥ 4 Jahre) und Jugendliche beziehen,<br />
sind als solche erkennbar und beziehen sich inhaltlich auf diesen<br />
Altersbereich. Die Gruppe der Kinder < 4 Jahre ist nicht<br />
Gegenstand dieser <strong>Leitlinie</strong>.<br />
Heruntergeladen von: Thieme Verlagsgruppe. Urheberrechtlich geschützt.