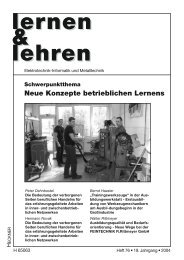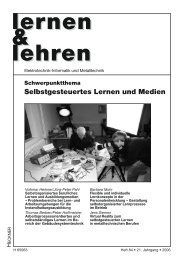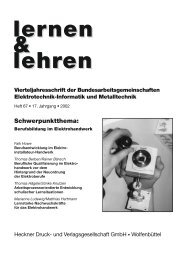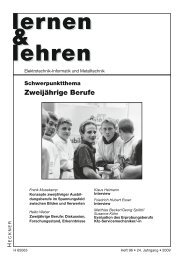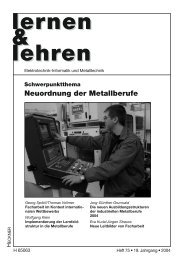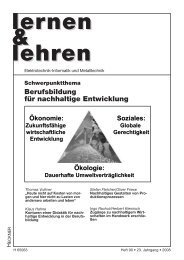Heft 95 - Lernen & Lehren
Heft 95 - Lernen & Lehren
Heft 95 - Lernen & Lehren
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Praxisbeiträge<br />
ein. Die Vorgehensweise bei dieser<br />
praktischen Umsetzung entspricht<br />
der Struktur des Artikulationsschemas<br />
für die „Instandsetzungsaufgabe“,<br />
einer Variante des Ausbildungs- und<br />
Unterrichtsverfahrens „Instandhaltungsaufgabe“,<br />
das in acht Handlungsschritte<br />
unterteilt ist (PAHL 2005,<br />
S. 192 f.). Hierbei kann situationsbedingt<br />
entschieden werden, einzelne<br />
Phasen abzuändern beziehungsweise<br />
entfallen zu lassen. Dabei sollte aber<br />
sichergestellt sein, dass der Charakter<br />
der vollständigen Handlung weiterhin<br />
gewährleistet wird.<br />
Einstieg durch Instandsetzungsauftrag<br />
mit Problemstellung<br />
Als Einstieg bietet sich hier ein fiktiver<br />
Kundenauftrag an, der den didaktischen<br />
Ansprüchen aus der Neuordnung<br />
des Berufes entspricht und das<br />
Interesse der Schüler wecken soll.<br />
Exemplarisch könnte dieser Kundenauftrag<br />
wie folgt lauten:<br />
„Der Besitzer eines Einfamilienhauses<br />
mit einer durch ein erdgasbefeuertes<br />
Brennwertgerät betriebenen Heizungsanlage<br />
(s. Installationsschema<br />
in Abb. 1) beklagt, dass am Anfang<br />
der Heizperiode im Herbst seine Heizungsanlage<br />
keine Raumwärme abgibt.<br />
Die Erzeugung von Warmwasser<br />
funktioniert jedoch einwandfrei. Sie<br />
werden von Ihrem Chef gebeten, die<br />
Störung zu beheben.“<br />
Um den positiven Effekt dieses Kundenauftrags<br />
weiter zu verstärken, wäre<br />
es bei der Umsetzung wünschenswert,<br />
den Text nicht nur auf dem Papier der<br />
Klasse vorzulegen, sondern durch einen<br />
Schüler der Klasse vortragen zu<br />
lassen.<br />
Intuitive Phase<br />
Nachdem es keine Verständnisprobleme<br />
in Bezug auf den fiktiven Kundenauftrag<br />
gibt, erhalten die <strong>Lernen</strong>den<br />
die Möglichkeit, eine spontane, intuitive<br />
Fehlerfindung bzw. Fehlerbehebung<br />
an der Brennwertheizungsanlage vorzunehmen.<br />
Dabei werden die Schüler<br />
erfahrungsgemäß auf produktspezifische<br />
und fachliche Schwierigkeiten<br />
stoßen, durch die eine sofortige Fehlerbeseitigung<br />
für sie unmöglich wird.<br />
Durch die Vorkenntnisse der <strong>Lernen</strong>den<br />
aus vorangegangenen Lernfeldern<br />
und Erfahrungen kommen sie jedoch<br />
bei ihren Lösungsansätzen meist zu<br />
dem Schluss, dass das Brennwertgerät<br />
aufgrund der funktionierenden<br />
Warmwasserbereitung nicht schadhaft<br />
sein kann. In dieser Phase können sie<br />
häufig bereits das Vorrangumschaltventil<br />
für Warmwasserbetrieb oder<br />
die Regelung mit den dazugehörigen<br />
Fühlern und Stellgliedern als mögliche<br />
Fehlerursache benennen. Ist dies<br />
nicht der Fall, muss lenkend eingegriffen<br />
werden, damit die Inhalte für die<br />
<strong>Lernen</strong>den überschaubar bleiben.<br />
Vielfach kommen die Schüler selbstständig<br />
auf die Idee, dass sie Informationsmaterial<br />
in Form von Herstellerunterlagen<br />
o. Ä. benötigen, um einen<br />
detaillierten und fachlich begründeten<br />
Arbeitsplan zu erstellen und damit<br />
letztlich die Funktionsstörung zu beseitigen.<br />
Ist dies nicht der Fall, muss<br />
von der Lehrkraft durch entsprechende<br />
Fragen darauf hingewirkt werden.<br />
Klärung der in dem Auftrag<br />
enthaltenen Probleme und Ziele<br />
sowie Planung des Problemlösungsweges<br />
In der Phase soll zunächst geklärt werden,<br />
ob es Verständnisprobleme bei<br />
dem Kundenauftrag gibt und ob eine<br />
Instandsetzung des Gerätes überhaupt<br />
möglich erscheint.<br />
Sind diese Punkte geklärt, muss den<br />
<strong>Lernen</strong>den bewusst werden, dass zur<br />
Fehlerbeseitigung nicht nur die Funktionsweise<br />
des Brennwertgeräts (Lernfeld<br />
9), sondern auch die der witterungsgeführten<br />
Regelung sowie die<br />
wechselseitige Beeinflussung beider<br />
Systeme verstanden sein muss, um<br />
erfolgreich und strukturiert an die Fehlerbeseitigung<br />
heranzugehen.<br />
Gelingt es den Schülern nicht, eigenständig<br />
die notwendigen Probleme<br />
zu erkennen, muss die Lehrkraft im<br />
fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch<br />
darauf hinarbeiten.<br />
Der zu entwickelnde Problemlösungsweg<br />
müsste dann auf jeden Fall die<br />
Punkte Informationsbeschaffung, Erstellung<br />
eines Arbeitsplans, Durchführung<br />
der Instandsetzung, Funktionsüberprüfung<br />
mit Übergabe an den<br />
Kunden und eine Auswertung der<br />
Instandsetzung beinhalten. Um den<br />
<strong>Lernen</strong>den ein strukturiertes Vorgehen<br />
zu ermöglichen, wäre ein Plakat mit<br />
diesen Punkten eine Möglichkeit, um<br />
ständig einen Überblick über die Folge<br />
der zu bearbeitenden Punkte zu<br />
haben.<br />
Sammeln von Informationen<br />
Den Schülern sollte aus Lernfeld 9 die<br />
Funktion einer Brennwertheizungsanlage<br />
bekannt sein, weshalb deren<br />
Funktion nicht erneut explizit berücksichtigt<br />
wird. Im Einzelfall muss aber<br />
eventuell der Wissensstand aufgefrischt<br />
werden.<br />
Von besonderer Bedeutung ist, dass<br />
sich die <strong>Lernen</strong>den Informationen zu<br />
den Bauteilen und Funktionen der witterungsgeführten<br />
Regelung beschaffen.<br />
Als hilfreich hat es sich erwiesen,<br />
dass sie zunächst den Regler und alle<br />
für diesen Heizkreis (s. Abb. 1) erforderlichen<br />
Fühler, Mess- und Steuerleitungen<br />
fachgerecht benennen sowie<br />
in das Installationsschema einzeichnen.<br />
Als Hilfestellung können hierbei<br />
Fachbücher, Herstellerunterlagen und<br />
eventuell vorhandene Brennwertgeräte<br />
genutzt werden, die als Anschauungsobjekt<br />
dienen. Letzteres hängt<br />
jedoch von der Ausstattung der jeweiligen<br />
Berufsschule ab.<br />
Anhand des Auftrages bekommen die<br />
Schüler eine Vorstellung davon, welche<br />
Bauteile den Regelkreis beeinflussen<br />
und als mögliche Fehlerursache in<br />
Betracht zu ziehen sind. Dieses bildet<br />
die Grundlage für die erfolgreiche Störungsanalyse<br />
der angehenden Fachkräfte.<br />
Erstellen eines Arbeits- bzw.<br />
Instandsetzungsplans<br />
Anhand der von den <strong>Lernen</strong>den gewonnenen<br />
Informationen soll nun ein<br />
Instandsetzungsplan erstellt werden,<br />
in den sie die bisher angestellten<br />
Überlegungen mit den neu dazu gewonnenen<br />
Erkenntnissen einfließen<br />
lassen. Da der Regelungsvorgang aber<br />
komplex ist, bereitet er den <strong>Lernen</strong>den<br />
durch die verschiedenen Abhängigkeiten<br />
der Bauteile untereinander häufig<br />
Probleme. Hilfreich kann für die Auszubildenden<br />
ein Arbeitsschritt sein, der<br />
über die technische Beschreibung von<br />
Funktionsweise und wechselseitigen<br />
Abhängigkeiten der verschiedenen<br />
Bauteile hinaus geht. Dies ist bei der<br />
grafischen Darstellung eines Ablaufplans<br />
der Fall, bei dessen Erstellung<br />
den <strong>Lernen</strong>den eine strukturierte Vorgehensweise<br />
beim problemlösenden<br />
132 lernen & lehren (l&l) (2009) <strong>95</strong>