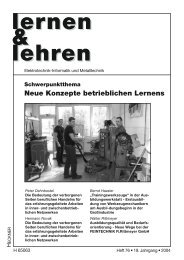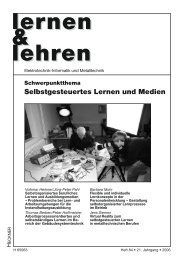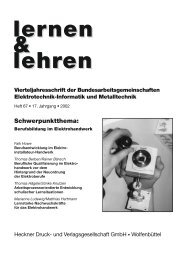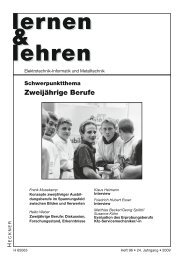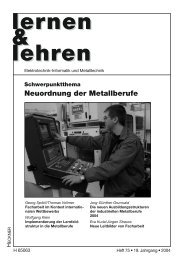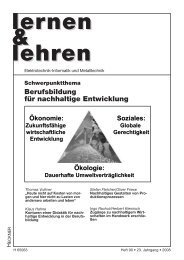Heft 95 - Lernen & Lehren
Heft 95 - Lernen & Lehren
Heft 95 - Lernen & Lehren
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schwerpunktthema: Messen und Diagnose als Gegenstand beruflicher Arbeits- und Lernprozesse<br />
Diese drei Angaben sind aber in der<br />
Regel über ein Bediengerät der Heizung<br />
von technisch versierten Kunden<br />
leicht feststellbar und bilden dann eine<br />
Informationsbasis für die Diagnose.<br />
Eine solche Problemstellung ist eine<br />
typische Diagnoseaufgabe für Anlagenmechanikerinnen<br />
und -mechaniker<br />
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.<br />
Wie kommt man diesem Fehler auf die<br />
Spur? Die Lösung des Diagnoseproblems<br />
ist im Ergebnis simpel und leicht<br />
nachvollziehbar. 1 Für denjenigen, der<br />
mit diesem Problem konfrontiert wird,<br />
ist jedoch ein systematisches Vorgehen<br />
nach einer Diagnosestrategie erforderlich.<br />
Mit „Systematik“ ist allerdings<br />
nicht unbedingt ein Fehlersuchplan<br />
gemeint, der abzuarbeiten ist.<br />
Vielmehr geht es zunächst um die Bestimmung<br />
eines geeigneten Diagnosewegs<br />
zur Eingrenzung des Suchraums<br />
(vgl. Abb. 1). Dabei spielen in der<br />
Facharbeit die Intuition (FISCHER 2000),<br />
ein subjektivierendes Arbeitshandeln<br />
und komplexe sinnliche Wahrnehmungen<br />
(BÖHLE/SCHULZE 1997; BAUER U. A.<br />
2002) sowie eine nicht-formalisierbare<br />
Rationalität (BECKER 2003, S. 247) eine<br />
entscheidende Rolle.<br />
Ein möglicher Weg der Unterstützung<br />
des Diagnoseprozesses ist, Hypothesen<br />
aufzustellen („es ist Luft in der Anlage“;<br />
„die Vorlaufpumpe ist defekt“<br />
…); ein anderer, Erklärungen für das<br />
Problem zu suchen: „Wenn die Heizkörper<br />
nicht warm werden, dann ist<br />
kein heißes Wasser in ihnen. Wenn<br />
kein heißes Wasser im Heizkörper ist,<br />
dann wird dieses nicht dorthin gepumpt<br />
…“.<br />
Bewegt man sich bei den Erklärungsversuchen<br />
von einer (möglichen) Fehlerursache<br />
zum Fehlersymptom, bezeichnet<br />
man diese Diagnosestrategie<br />
als Vorwärtsstrategie oder Vorwärtsverkettung<br />
(weil Erklärungsregeln miteinander<br />
verkettet werden). Geht man<br />
vom Fehlersymptom aus (Heizkörper<br />
werden nicht warm) und überprüft die<br />
Regeln, welche dieses Ziel bestätigen,<br />
nennt man dies Rückwärtsstrategie.<br />
Diese beiden Strategien sind algorithmische<br />
Strategien der Struktur „Wenn<br />
…, dann …“, die bei der Anwendung<br />
zu Fehlerbäumen führen (vgl. VDI<br />
2889, S. 3).<br />
Zur Überprüfung von Hypothesen setzt<br />
man auf fallbasierte oder modellbasierte<br />
Diagnosestrategien (vgl. BECKER/<br />
SPÖTTL 2002, S. 124 ff.; BECKER 2003,<br />
S. 200 ff.) und seit jüngerer Zeit sogar<br />
auf immobile Roboter (vereinfacht:<br />
„Roboter in der Diagnosesoftware der<br />
Anlage/des Systems“; vgl. BECKER<br />
2005a). Bei der fallbasierten Diagnosestrategie<br />
überprüft man die Hypothese<br />
vor dem Hintergrund der Kenntnis<br />
von bekannten Fällen (z. B. nach<br />
Häufigkeit von Fehlerursachen in der<br />
Vergangenheit); bei der modellbasierten<br />
Diagnosestrategie mithilfe eines<br />
Modells, welches das Funktionieren<br />
der Anlage/des Systems abbildet.<br />
Die Anwendbarkeit der genannten<br />
Basisstrategien (Vorwärtsstrategie,<br />
Rückwärtsstrategie, fallbasierte und<br />
modellbasierte Strategie) im Diagnoseprozess<br />
(vgl. Abb. 1) hängt von der<br />
Komplexität der Diagnoseaufgabe ab.<br />
Dabei soll auch nicht unerwähnt bleiben,<br />
dass Ad-hoc-Strategien (Versuch<br />
und Irrtum) auch heute noch in der<br />
Facharbeit zur Anwendung kommen.<br />
Abb. 1: Diagnoseprozess<br />
Bei der Umsetzung einer Diagnosestrategie<br />
kommt es im Fehlersuchprozess<br />
in den meisten Diagnoseschritten<br />
zur Anwendung der „klassischen“ Diagnosemethoden<br />
„Messen“ und „Prüfen“.<br />
Diese lassen sich allerdings erst<br />
anwenden, wenn ein klarer Prüfplan<br />
vorliegt, der sich wiederum auf prüfbare<br />
Komponenten bezieht.<br />
Messen und Prüfen als klassische<br />
Diagnosemethoden in der<br />
Facharbeit<br />
Das „Messen“ ist die zentrale Tätigkeit<br />
innerhalb eines Diagnoseprozesses.<br />
Anhand von Messergebnissen entscheidet<br />
sich in der Regel, wie weiter<br />
vorgegangen werden soll, und die<br />
Interpretation des Messergebnisses<br />
führt meist zur Bestimmung der Fehlerursache.<br />
Messen heißt zunächst nur,<br />
eine physikalische Größe nach Zahl<br />
und Einheit festzustellen (Vergleich der<br />
zu messenden Größe mit einer Maßskala;<br />
vgl. DIN 1319). Demgegenüber<br />
enthält das Prüfen den Vergleich des<br />
Messergebnisses mit vorgegebenen<br />
Werten (Soll-Werten). Für viele Aufgaben<br />
in der Diagnose existieren keine<br />
Maßzahlen für das Messergebnis<br />
(Gerüche, Eindrücke, optische Wahrnehmung:<br />
Aussehen). Der Vergleich<br />
wird auf der Basis von Erfahrung und<br />
Routine vorgenommen. Auch wenn<br />
theoretisch Messungen möglich wären,<br />
aber sich diese praktisch als zu<br />
komplex darstellen (wie etwa bei der<br />
Geräuschmessung), werden Zusammenhänge<br />
von Facharbeitern als ein<br />
„Bild“ vom Diagnoseproblem bewertet,<br />
und der Diagnoseprozess wird<br />
dadurch angeleitet. Das festgestellte<br />
Bild muss zur verinnerlichten Vorstellung<br />
über das richtige „Bild“ passen.<br />
Dies gilt auch, wenn zum Teil Messergebnisse<br />
vorliegen, diese aber zur<br />
102 lernen & lehren (l&l) (2009) <strong>95</strong>