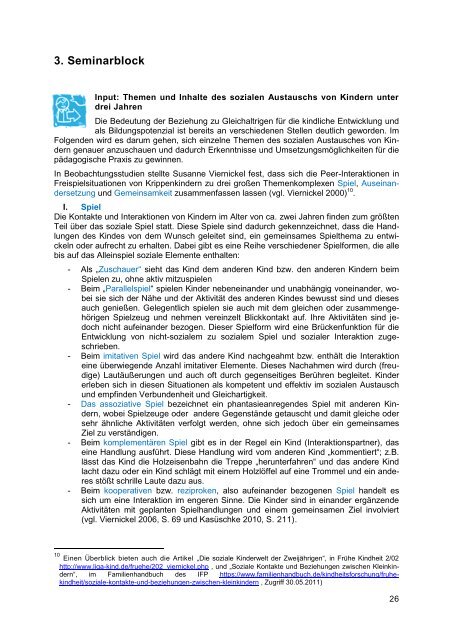Tätigkeitsbegleitende Fortbildung für ... - Frühe Chancen
Tätigkeitsbegleitende Fortbildung für ... - Frühe Chancen
Tätigkeitsbegleitende Fortbildung für ... - Frühe Chancen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3. Seminarblock<br />
Input: Themen und Inhalte des sozialen Austauschs von Kindern unter<br />
drei Jahren<br />
Die Bedeutung der Beziehung zu Gleichaltrigen <strong>für</strong> die kindliche Entwicklung und<br />
als Bildungspotenzial ist bereits an verschiedenen Stellen deutlich geworden. Im<br />
Folgenden wird es darum gehen, sich einzelne Themen des sozialen Austausches von Kindern<br />
genauer anzuschauen und dadurch Erkenntnisse und Umsetzungsmöglichkeiten <strong>für</strong> die<br />
pädagogische Praxis zu gewinnen.<br />
In Beobachtungsstudien stellte Susanne Viernickel fest, dass sich die Peer-Interaktionen in<br />
Freispielsituationen von Krippenkindern zu drei großen Themenkomplexen Spiel, Auseinandersetzung<br />
und Gemeinsamkeit zusammenfassen lassen (vgl. Viernickel 2000) 10 .<br />
I. Spiel<br />
Die Kontakte und Interaktionen von Kindern im Alter von ca. zwei Jahren finden zum größten<br />
Teil über das soziale Spiel statt. Diese Spiele sind dadurch gekennzeichnet, dass die Handlungen<br />
des Kindes von dem Wunsch geleitet sind, ein gemeinsames Spielthema zu entwickeln<br />
oder aufrecht zu erhalten. Dabei gibt es eine Reihe verschiedener Spielformen, die alle<br />
bis auf das Alleinspiel soziale Elemente enthalten:<br />
- Als „Zuschauer“ sieht das Kind dem anderen Kind bzw. den anderen Kindern beim<br />
Spielen zu, ohne aktiv mitzuspielen<br />
- Beim „Parallelspiel“ spielen Kinder nebeneinander und unabhängig voneinander, wobei<br />
sie sich der Nähe und der Aktivität des anderen Kindes bewusst sind und dieses<br />
auch genießen. Gelegentlich spielen sie auch mit dem gleichen oder zusammengehörigen<br />
Spielzeug und nehmen vereinzelt Blickkontakt auf. Ihre Aktivitäten sind jedoch<br />
nicht aufeinander bezogen. Dieser Spielform wird eine Brückenfunktion <strong>für</strong> die<br />
Entwicklung von nicht-sozialem zu sozialem Spiel und sozialer Interaktion zugeschrieben.<br />
- Beim imitativen Spiel wird das andere Kind nachgeahmt bzw. enthält die Interaktion<br />
eine überwiegende Anzahl imitativer Elemente. Dieses Nachahmen wird durch (freudige)<br />
Lautäußerungen und auch oft durch gegenseitiges Berühren begleitet. Kinder<br />
erleben sich in diesen Situationen als kompetent und effektiv im sozialen Austausch<br />
und empfinden Verbundenheit und Gleichartigkeit.<br />
- Das assoziative Spiel bezeichnet ein phantasieanregendes Spiel mit anderen Kindern,<br />
wobei Spielzeuge oder andere Gegenstände getauscht und damit gleiche oder<br />
sehr ähnliche Aktivitäten verfolgt werden, ohne sich jedoch über ein gemeinsames<br />
Ziel zu verständigen.<br />
- Beim komplementären Spiel gibt es in der Regel ein Kind (Interaktionspartner), das<br />
eine Handlung ausführt. Diese Handlung wird vom anderen Kind „kommentiert“; z.B.<br />
lässt das Kind die Holzeisenbahn die Treppe „herunterfahren“ und das andere Kind<br />
lacht dazu oder ein Kind schlägt mit einem Holzlöffel auf eine Trommel und ein anderes<br />
stößt schrille Laute dazu aus.<br />
- Beim kooperativen bzw. reziproken, also aufeinander bezogenen Spiel handelt es<br />
sich um eine Interaktion im engeren Sinne. Die Kinder sind in einander ergänzende<br />
Aktivitäten mit geplanten Spielhandlungen und einem gemeinsamen Ziel involviert<br />
(vgl. Viernickel 2006, S. 69 und Kasüschke 2010, S. 211).<br />
10 Einen Überblick bieten auch die Artikel „Die soziale Kinderwelt der Zweijährigen“, in <strong>Frühe</strong> Kindheit 2/02<br />
http://www.liga-kind.de/fruehe/202_viernickel.php , und „Soziale Kontakte und Beziehungen zwischen Kleinkindern“,<br />
im Familienhandbuch des IFP https://www.familienhandbuch.de/kindheitsforschung/fruhekindheit/soziale-kontakte-und-beziehungen-zwischen-kleinkindern<br />
, Zugriff 30.05.2011)<br />
26