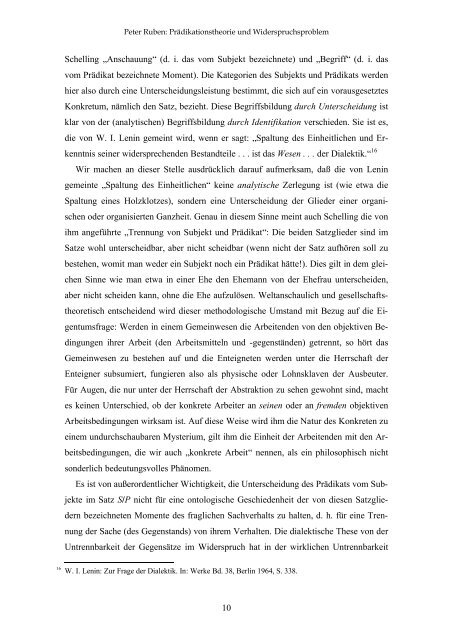Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Peter</strong> <strong>Ruben</strong>: PrÄdikationstheorie <strong>und</strong> <strong>Widerspruchsproblem</strong><br />
Schelling „Anschauung“ (d. i. das vom Subjekt bezeichnete) <strong>und</strong> „Begriff“ (d. i. das<br />
vom PrÇdikat bezeichnete Moment). Die Kategorien des Subjekts <strong>und</strong> PrÇdikats werden<br />
hier also durch eine Unterscheidungsleistung bestimmt, die sich auf ein vorausgesetztes<br />
Konkretum, nÇmlich den Satz, bezieht. Diese Begriffsbildung durch Unterscheidung ist<br />
klar von der (analytischen) Begriffsbildung durch Identifikation verschieden. Sie ist es,<br />
die von W. I. Lenin gemeint wird, wenn er sagt: „Spaltung des Einheitlichen <strong>und</strong> Er-<br />
kenntnis seiner widersprechenden Bestandteile . . . ist das Wesen . . . der Dialektik.“ 16<br />
Wir machen an dieser Stelle ausdrÅcklich darauf aufmerksam, daÉ die von Lenin<br />
gemeinte „Spaltung des Einheitlichen“ keine analytische Zerlegung ist (wie etwa die<br />
Spaltung eines Holzklotzes), sondern eine Unterscheidung der Glieder einer organi-<br />
schen oder organisierten Ganzheit. Genau in diesem Sinne meint auch Schelling die von<br />
ihm angefÅhrte „Trennung von Subjekt <strong>und</strong> PrÇdikat“: Die beiden Satzglieder sind im<br />
Satze wohl unterscheidbar, aber nicht scheidbar (wenn nicht der Satz aufhÄren soll zu<br />
bestehen, womit man weder ein Subjekt noch ein PrÇdikat hÇtte!). Dies gilt in dem glei-<br />
chen Sinne wie man etwa in einer Ehe den Ehemann von der Ehefrau unterscheiden,<br />
aber nicht scheiden kann, ohne die Ehe aufzulÄsen. Weltanschaulich <strong>und</strong> gesellschafts-<br />
theoretisch entscheidend wird dieser methodologische Umstand mit Bezug auf die Ei-<br />
gentumsfrage: Werden in einem Gemeinwesen die Arbeitenden von den objektiven Be-<br />
dingungen ihrer Arbeit (den Arbeitsmitteln <strong>und</strong> -gegenstÇnden) getrennt, so hÄrt das<br />
Gemeinwesen zu bestehen auf <strong>und</strong> die Enteigneten werden unter die Herrschaft der<br />
Enteigner subsumiert, fungieren also als physische oder Lohnsklaven der Ausbeuter.<br />
FÅr Augen, die nur unter der Herrschaft der Abstraktion zu sehen gewohnt sind, macht<br />
es keinen Unterschied, ob der konkrete Arbeiter an seinen oder an fremden objektiven<br />
Arbeitsbedingungen wirksam ist. Auf diese Weise wird ihm die Natur des Konkreten zu<br />
einem <strong>und</strong>urchschaubaren Mysterium, gilt ihm die Einheit der Arbeitenden mit den Ar-<br />
beitsbedingungen, die wir auch „konkrete Arbeit“ nennen, als ein philosophisch nicht<br />
sonderlich bedeutungsvolles PhÇnomen.<br />
Es ist von auÉerordentlicher Wichtigkeit, die Unterscheidung des PrÇdikats vom Sub-<br />
jekte im Satz S/P nicht fÅr eine ontologische Geschiedenheit der von diesen Satzglie-<br />
dern bezeichneten Momente des fraglichen Sachverhalts zu halten, d. h. fÅr eine Tren-<br />
nung der Sache (des Gegenstands) von ihrem Verhalten. Die dialektische These von der<br />
Untrennbarkeit der GegensÇtze im Widerspruch hat in der wirklichen Untrennbarkeit<br />
16 W. I. Lenin: Zur Frage der Dialektik. In: Werke Bd. 38, Berlin 1964, S. 338.<br />
10