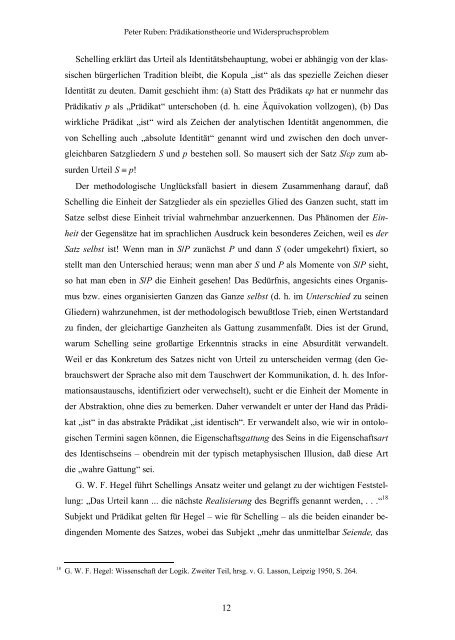Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Peter</strong> <strong>Ruben</strong>: PrÄdikationstheorie <strong>und</strong> <strong>Widerspruchsproblem</strong><br />
Schelling erklÇrt das Urteil als IdentitÇtsbehauptung, wobei er abhÇngig von der klas-<br />
sischen bÅrgerlichen Tradition bleibt, die Kopula „ist“ als das spezielle Zeichen dieser<br />
IdentitÇt zu deuten. Damit geschieht ihm: (a) Statt des PrÇdikats εp hat er nunmehr das<br />
PrÇdikativ p als „PrÇdikat“ unterschoben (d. h. eine áquivokation vollzogen), (b) Das<br />
wirkliche PrÇdikat „ist“ wird als Zeichen der analytischen IdentitÇt angenommen, die<br />
von Schelling auch „absolute IdentitÇt“ genannt wird <strong>und</strong> zwischen den doch unver-<br />
gleichbaren Satzgliedern S <strong>und</strong> p bestehen soll. So mausert sich der Satz S/εp zum ab-<br />
surden Urteil S p!<br />
Der methodologische UnglÅcksfall basiert in diesem Zusammenhang darauf, daÉ<br />
Schelling die Einheit der Satzglieder als ein spezielles Glied des Ganzen sucht, statt im<br />
Satze selbst diese Einheit trivial wahrnehmbar anzuerkennen. Das PhÇnomen der Ein-<br />
heit der GegensÇtze hat im sprachlichen Ausdruck kein besonderes Zeichen, weil es der<br />
Satz selbst ist! Wenn man in S/P zunÇchst P <strong>und</strong> dann S (oder umgekehrt) fixiert, so<br />
stellt man den Unterschied heraus; wenn man aber S <strong>und</strong> P als Momente von S/P sieht,<br />
so hat man eben in S/P die Einheit gesehen! Das BedÅrfnis, angesichts eines Organis-<br />
mus bzw. eines organisierten Ganzen das Ganze selbst (d. h. im Unterschied zu seinen<br />
Gliedern) wahrzunehmen, ist der methodologisch bewuÉtlose Trieb, einen Wertstandard<br />
zu finden, der gleichartige Ganzheiten als Gattung zusammenfaÉt. Dies ist der Gr<strong>und</strong>,<br />
warum Schelling seine groÉartige Erkenntnis stracks in eine AbsurditÇt verwandelt.<br />
Weil er das Konkretum des Satzes nicht von Urteil zu unterscheiden vermag (den Ge-<br />
brauchswert der Sprache also mit dem Tauschwert der Kommunikation, d. h. des Infor-<br />
mationsaustauschs, identifiziert oder verwechselt), sucht er die Einheit der Momente in<br />
der Abstraktion, ohne dies zu bemerken. Daher verwandelt er unter der Hand das PrÇdi-<br />
kat „ist“ in das abstrakte PrÇdikat „ist identisch“. Er verwandelt also, wie wir in ontolo-<br />
gischen Termini sagen kÄnnen, die Eigenschaftsgattung des Seins in die Eigenschaftsart<br />
des Identischseins – obendrein mit der typisch metaphysischen Illusion, daÉ diese Art<br />
die „wahre Gattung“ sei.<br />
G. W. F. Hegel fÅhrt Schellings Ansatz weiter <strong>und</strong> gelangt zu der wichtigen Feststel-<br />
lung: „Das Urteil kann ... die nÇchste Realisierung des Begriffs genannt werden, . . .“ 18<br />
Subjekt <strong>und</strong> PrÇdikat gelten fÅr Hegel – wie fÅr Schelling – als die beiden einander be-<br />
dingenden Momente des Satzes, wobei das Subjekt „mehr das unmittelbar Seiende, das<br />
18 G. W. F. Hegel: Wissenschaft der Logik. Zweiter Teil, hrsg. v. G. Lasson, Leipzig 1950, S. 264.<br />
12