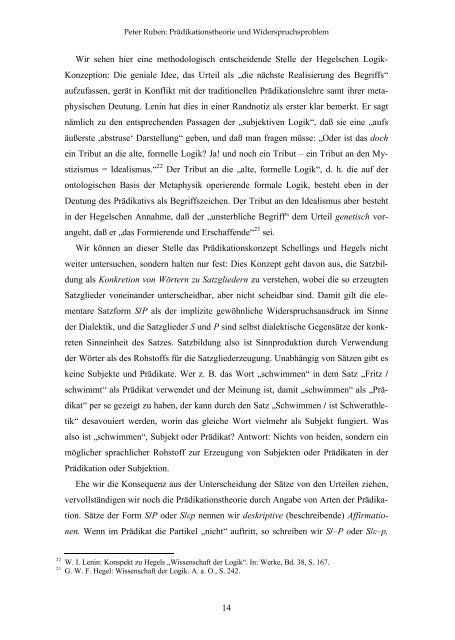Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Peter</strong> <strong>Ruben</strong>: PrÄdikationstheorie <strong>und</strong> <strong>Widerspruchsproblem</strong><br />
Wir sehen hier eine methodologisch entscheidende Stelle der Hegelschen Logik-<br />
Konzeption: Die geniale Idee, das Urteil als „die nÇchste Realisierung des Begriffs“<br />
aufzufassen, gerÇt in Konflikt mit der traditionellen PrÇdikationslehre samt ihrer meta-<br />
physischen Deutung. Lenin hat dies in einer Randnotiz als erster klar bemerkt. Er sagt<br />
nÇmlich zu den entsprechenden Passagen der „subjektiven Logik“, daÉ sie eine „aufs<br />
ÇuÉerste ,abstruse‘ Darstellung“ geben, <strong>und</strong> daÉ man fragen mÅsse: „Oder ist das doch<br />
ein Tribut an die alte, formelle Logik? Ja! <strong>und</strong> noch ein Tribut – ein Tribut an den My-<br />
stizismus = Idealismus.“ 22 Der Tribut an die „alte, formelle Logik“, d. h. die auf der<br />
ontologischen Basis der Metaphysik operierende formale Logik, besteht eben in der<br />
Deutung des PrÇdikativs als Begriffszeichen. Der Tribut an den Idealismus aber besteht<br />
in der Hegelschen Annahme, daÉ der „unsterbliche Begriff“ dem Urteil genetisch vor-<br />
angeht, daÉ er „das Formierende <strong>und</strong> Erschaffende“ 23 sei.<br />
Wir kÄnnen an dieser Stelle das PrÇdikationskonzept Schellings <strong>und</strong> Hegels nicht<br />
weiter untersuchen, sondern halten nur fest: Dies Konzept geht davon aus, die Satzbil-<br />
dung als Konkretion von WÜrtern zu Satzgliedern zu verstehen, wobei die so erzeugten<br />
Satzglieder voneinander unterscheidbar, aber nicht scheidbar sind. Damit gilt die ele-<br />
mentare Satzform S/P als der implizite gewÄhnliche Widerspruchsausdruck im Sinne<br />
der Dialektik, <strong>und</strong> die Satzglieder S <strong>und</strong> P sind selbst dialektische GegensÇtze der konk-<br />
reten Sinneinheit des Satzes. Satzbildung also ist Sinnproduktion durch Verwendung<br />
der WÄrter als des Rohstoffs fÅr die Satzgliederzeugung. UnabhÇngig von SÇtzen gibt es<br />
keine Subjekte <strong>und</strong> PrÇdikate. Wer z. B. das Wort „schwimmen“ in dem Satz „Fritz /<br />
schwimmt“ als PrÇdikat verwendet <strong>und</strong> der Meinung ist, damit „schwimmen“ als „PrÇ-<br />
dikat“ per se gezeigt zu haben, der kann durch den Satz „Schwimmen / ist Schwerathle-<br />
tik“ desavouiert werden, worin das gleiche Wort vielmehr als Subjekt fungiert. Was<br />
also ist „schwimmen“, Subjekt oder PrÇdikat? Antwort: Nichts von beiden, sondern ein<br />
mÄglicher sprachlicher Rohstoff zur Erzeugung von Subjekten oder PrÇdikaten in der<br />
PrÇdikation oder Subjektion.<br />
Ehe wir die Konsequenz aus der Unterscheidung der SÇtze von den Urteilen ziehen,<br />
vervollstÇndigen wir noch die PrÇdikationstheorie durch Angabe von Arten der PrÇdika-<br />
tion. SÇtze der Form S/P oder S/εp nennen wir deskriptive (beschreibende) Affirmatio-<br />
nen. Wenn im PrÇdikat die Partikel „nicht“ auftritt, so schreiben wir S/–P oder S/ε–p,<br />
22 W. I. Lenin: Konspekt zu Hegels „Wissenschaft der Logik“. In: Werke, Bd. 38, S. 167.<br />
23 G. W. F. Hegel: Wissenschaft der Logik. A. a. O., S. 242.<br />
14