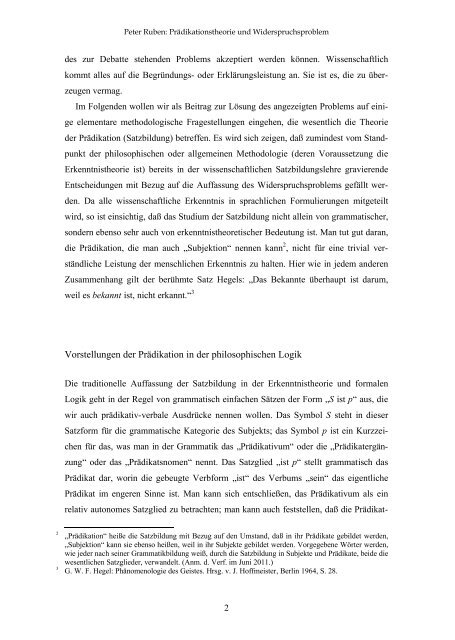Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Peter</strong> <strong>Ruben</strong>: PrÄdikationstheorie <strong>und</strong> <strong>Widerspruchsproblem</strong><br />
des zur Debatte stehenden Problems akzeptiert werden kÄnnen. Wissenschaftlich<br />
kommt alles auf die BegrÅndungs- oder ErklÇrungsleistung an. Sie ist es, die zu Åber-<br />
zeugen vermag.<br />
Im Folgenden wollen wir als Beitrag zur LÄsung des angezeigten Problems auf eini-<br />
ge elementare methodologische Fragestellungen eingehen, die wesentlich die Theorie<br />
der PrÇdikation (Satzbildung) betreffen. Es wird sich zeigen, daÉ zumindest vom Stand-<br />
punkt der philosophischen oder allgemeinen Methodologie (deren Voraussetzung die<br />
Erkenntnistheorie ist) bereits in der wissenschaftlichen Satzbildungslehre gravierende<br />
Entscheidungen mit Bezug auf die Auffassung des <strong>Widerspruchsproblem</strong>s gefÇllt wer-<br />
den. Da alle wissenschaftliche Erkenntnis in sprachlichen Formulierungen mitgeteilt<br />
wird, so ist einsichtig, daÉ das Studium der Satzbildung nicht allein von grammatischer,<br />
sondern ebenso sehr auch von erkenntnistheoretischer Bedeutung ist. Man tut gut daran,<br />
die PrÇdikation, die man auch „Subjektion“ nennen kann 2 , nicht fÅr eine trivial ver-<br />
stÇndliche Leistung der menschlichen Erkenntnis zu halten. Hier wie in jedem anderen<br />
Zusammenhang gilt der berÅhmte Satz Hegels: „Das Bekannte Åberhaupt ist darum,<br />
weil es bekannt ist, nicht erkannt.“ 3<br />
Vorstellungen der PrÇdikation in der philosophischen Logik<br />
Die traditionelle Auffassung der Satzbildung in der Erkenntnistheorie <strong>und</strong> formalen<br />
Logik geht in der Regel von grammatisch einfachen SÇtzen der Form „S ist p“ aus, die<br />
wir auch prÇdikativ-verbale AusdrÅcke nennen wollen. Das Symbol S steht in dieser<br />
Satzform fÅr die grammatische Kategorie des Subjekts; das Symbol p ist ein Kurzzei-<br />
chen fÅr das, was man in der Grammatik das „PrÇdikativum“ oder die „PrÇdikatergÇn-<br />
zung“ oder das „PrÇdikatsnomen“ nennt. Das Satzglied „ist p“ stellt grammatisch das<br />
PrÇdikat dar, worin die gebeugte Verbform „ist“ des Verbums „sein“ das eigentliche<br />
PrÇdikat im engeren Sinne ist. Man kann sich entschlieÉen, das PrÇdikativum als ein<br />
relativ autonomes Satzglied zu betrachten; man kann auch feststellen, daÉ die PrÇdikat-<br />
2 „PrÇdikation“ heiÉe die Satzbildung mit Bezug auf den Umstand, daÉ in ihr PrÇdikate gebildet werden,<br />
„Subjektion“ kann sie ebenso heiÉen, weil in ihr Subjekte gebildet werden. Vorgegebene WÄrter werden,<br />
wie jeder nach seiner Grammatikbildung weiÉ, durch die Satzbildung in Subjekte <strong>und</strong> PrÇdikate, beide die<br />
wesentlichen Satzglieder, verwandelt. (Anm. d. Verf. im Juni 2011.)<br />
3 G. W. F. Hegel: PhÇnomenologie des Geistes. Hrsg. v. J. Hoffmeister, Berlin 1964, S. 28.<br />
2