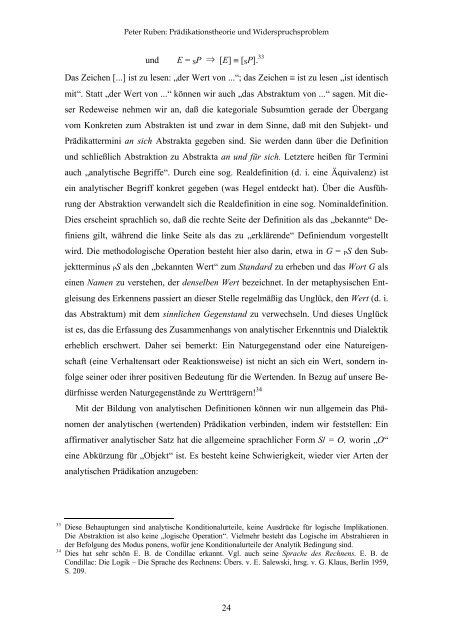Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Peter</strong> <strong>Ruben</strong>: PrÄdikationstheorie <strong>und</strong> <strong>Widerspruchsproblem</strong><br />
<strong>und</strong> E = SP ⇒ [E][SP]. 33<br />
Das Zeichen [...] ist zu lesen: „der Wert von ...“; das Zeichen ist zu lesen „ist identisch<br />
mit“. Statt „der Wert von ...“ kÄnnen wir auch „das Abstraktum von ...“ sagen. Mit die-<br />
ser Redeweise nehmen wir an, daÉ die kategoriale Subsumtion gerade der Übergang<br />
vom Konkreten zum Abstrakten ist <strong>und</strong> zwar in dem Sinne, daÉ mit den Subjekt- <strong>und</strong><br />
PrÇdikattermini an sich Abstrakta gegeben sind. Sie werden dann Åber die Definition<br />
<strong>und</strong> schlieÉlich Abstraktion zu Abstrakta an <strong>und</strong> für sich. Letztere heiÉen fÅr Termini<br />
auch „analytische Begriffe“. Durch eine sog. Realdefinition (d. i. eine áquivalenz) ist<br />
ein analytischer Begriff konkret gegeben (was Hegel entdeckt hat). Über die AusfÅh-<br />
rung der Abstraktion verwandelt sich die Realdefinition in eine sog. Nominaldefinition.<br />
Dies erscheint sprachlich so, daÉ die rechte Seite der Definition als das „bekannte“ De-<br />
finiens gilt, wÇhrend die linke Seite als das zu „erklÇrende“ Definiendum vorgestellt<br />
wird. Die methodologische Operation besteht hier also darin, etwa in G = PS den Sub-<br />
jektterminus PS als den „bekannten Wert“ zum Standard zu erheben <strong>und</strong> das Wort G als<br />
einen Namen zu verstehen, der denselben Wert bezeichnet. In der metaphysischen Ent-<br />
gleisung des Erkennens passiert an dieser Stelle regelmÇÉig das UnglÅck, den Wert (d. i.<br />
das Abstraktum) mit dem sinnlichen Gegenstand zu verwechseln. Und dieses UnglÅck<br />
ist es, das die Erfassung des Zusammenhangs von analytischer Erkenntnis <strong>und</strong> Dialektik<br />
erheblich erschwert. Daher sei bemerkt: Ein Naturgegenstand oder eine Natureigen-<br />
schaft (eine Verhaltensart oder Reaktionsweise) ist nicht an sich ein Wert, sondern in-<br />
folge seiner oder ihrer positiven Bedeutung fÅr die Wertenden. In Bezug auf unsere Be-<br />
dÅrfnisse werden NaturgegenstÇnde zu WerttrÇgern! 34<br />
Mit der Bildung von analytischen Definitionen kÄnnen wir nun allgemein das PhÇ-<br />
nomen der analytischen (wertenden) PrÇdikation verbinden, indem wir feststellen: Ein<br />
affirmativer analytischer Satz hat die allgemeine sprachlicher Form S/ = O, worin „O“<br />
eine AbkÅrzung fÅr „Objekt“ ist. Es besteht keine Schwierigkeit, wieder vier Arten der<br />
analytischen PrÇdikation anzugeben:<br />
33 Diese Behauptungen sind analytische Konditionalurteile, keine AusdrÅcke fÅr logische Implikationen.<br />
Die Abstraktion ist also keine „logische Operation“. Vielmehr besteht das Logische im Abstrahieren in<br />
der Befolgung des Modus ponens, wofÅr jene Konditionalurteile der Analytik Bedingung sind.<br />
34 Dies hat sehr schÄn E. B. de Condillac erkannt. Vgl. auch seine Sprache des Rechnens. E. B. de<br />
Condillac: Die Logik – Die Sprache des Rechnens: Übers. v. E. Salewski, hrsg. v. G. Klaus, Berlin 1959,<br />
S. 209.<br />
24