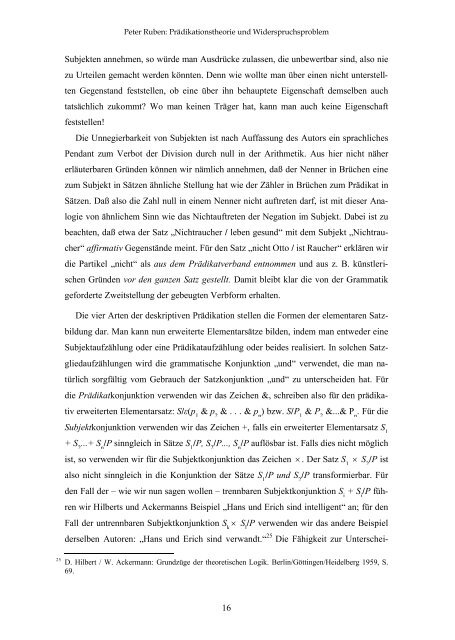Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Peter</strong> <strong>Ruben</strong>: PrÄdikationstheorie <strong>und</strong> <strong>Widerspruchsproblem</strong><br />
Subjekten annehmen, so wÅrde man AusdrÅcke zulassen, die unbewertbar sind, also nie<br />
zu Urteilen gemacht werden kÄnnten. Denn wie wollte man Åber einen nicht unterstell-<br />
ten Gegenstand feststellen, ob eine Åber ihn behauptete Eigenschaft demselben auch<br />
tatsÇchlich zukommt? Wo man keinen TrÇger hat, kann man auch keine Eigenschaft<br />
feststellen!<br />
Die Unnegierbarkeit von Subjekten ist nach Auffassung des Autors ein sprachliches<br />
Pendant zum Verbot der Division durch null in der Arithmetik. Aus hier nicht nÇher<br />
erlÇuterbaren GrÅnden kÄnnen wir nÇmlich annehmen, daÉ der Nenner in BrÅchen eine<br />
zum Subjekt in SÇtzen Çhnliche Stellung hat wie der ZÇhler in BrÅchen zum PrÇdikat in<br />
SÇtzen. DaÉ also die Zahl null in einem Nenner nicht auftreten darf, ist mit dieser Ana-<br />
logie von Çhnlichem Sinn wie das Nichtauftreten der Negation im Subjekt. Dabei ist zu<br />
beachten, daÉ etwa der Satz „Nichtraucher / leben ges<strong>und</strong>“ mit dem Subjekt „Nichtrau-<br />
cher“ affirmativ GegenstÇnde meint. FÅr den Satz „nicht Otto / ist Raucher“ erklÇren wir<br />
die Partikel „nicht“ als aus dem PrÄdikatverband entnommen <strong>und</strong> aus z. B. kÅnstleri-<br />
schen GrÅnden vor den ganzen Satz gestellt. Damit bleibt klar die von der Grammatik<br />
geforderte Zweitstellung der gebeugten Verbform erhalten.<br />
Die vier Arten der deskriptiven PrÇdikation stellen die Formen der elementaren Satz-<br />
bildung dar. Man kann nun erweiterte ElementarsÇtze bilden, indem man entweder eine<br />
SubjektaufzÇhlung oder eine PrÇdikataufzÇhlung oder beides realisiert. In solchen Satz-<br />
gliedaufzÇhlungen wird die grammatische Konjunktion „<strong>und</strong>“ verwendet, die man na-<br />
tÅrlich sorgfÇltig vom Gebrauch der Satzkonjunktion „<strong>und</strong>“ zu unterscheiden hat. FÅr<br />
die PrÄdikatkonjunktion verwenden wir das Zeichen &, schreiben also fÅr den prÇdika-<br />
tiv erweiterten Elementarsatz: S/ε(p 1 & p 2 & . . . & p n ) bzw. S/P 1 & P 2 &...& P n . FÅr die<br />
Subjektkonjunktion verwenden wir das Zeichen +, falls ein erweiterter Elementarsatz S 1<br />
+ S 2 ...+ S n /P sinngleich in SÇtze S 1 /P, S 2 /P..., S n /P auflÄsbar ist. Falls dies nicht mÄglich<br />
ist, so verwenden wir fÅr die Subjektkonjunktion das Zeichen . Der Satz S 1 S 2 /P ist<br />
also nicht sinngleich in die Konjunktion der SÇtze S 1 /P <strong>und</strong> S 2 /P transformierbar. FÅr<br />
den Fall der – wie wir nun sagen wollen – trennbaren Subjektkonjunktion S i + S j /P fÅh-<br />
ren wir Hilberts <strong>und</strong> Ackermanns Beispiel „Hans <strong>und</strong> Erich sind intelligent“ an; fÅr den<br />
Fall der untrennbaren Subjektkonjunktion S k S l /P verwenden wir das andere Beispiel<br />
derselben Autoren: „Hans <strong>und</strong> Erich sind verwandt.“ 25 Die FÇhigkeit zur Unterschei-<br />
25 D. Hilbert / W. Ackermann: Gr<strong>und</strong>zÅge der theoretischen Logik. Berlin/GÄttingen/Heidelberg 1959, S.<br />
69.<br />
16