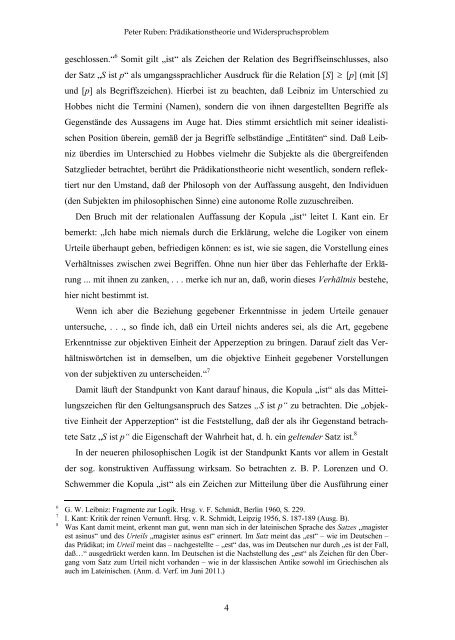Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Prädikationstheorie und Widerspruchsproblem - Peter Ruben ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Peter</strong> <strong>Ruben</strong>: PrÄdikationstheorie <strong>und</strong> <strong>Widerspruchsproblem</strong><br />
geschlossen.“ 6 Somit gilt „ist“ als Zeichen der Relation des Begriffseinschlusses, also<br />
der Satz „S ist p“ als umgangssprachlicher Ausdruck fÅr die Relation [S] [p] (mit [S]<br />
<strong>und</strong> [p] als Begriffszeichen). Hierbei ist zu beachten, daÉ Leibniz im Unterschied zu<br />
Hobbes nicht die Termini (Namen), sondern die von ihnen dargestellten Begriffe als<br />
GegenstÇnde des Aussagens im Auge hat. Dies stimmt ersichtlich mit seiner idealisti-<br />
schen Position Åberein, gemÇÉ der ja Begriffe selbstÇndige „EntitÇten“ sind. DaÉ Leib-<br />
niz Åberdies im Unterschied zu Hobbes vielmehr die Subjekte als die Åbergreifenden<br />
Satzglieder betrachtet, berÅhrt die PrÇdikationstheorie nicht wesentlich, sondern reflek-<br />
tiert nur den Umstand, daÉ der Philosoph von der Auffassung ausgeht, den Individuen<br />
(den Subjekten im philosophischen Sinne) eine autonome Rolle zuzuschreiben.<br />
Den Bruch mit der relationalen Auffassung der Kopula „ist“ leitet I. Kant ein. Er<br />
bemerkt: „Ich habe mich niemals durch die ErklÇrung, welche die Logiker von einem<br />
Urteile Åberhaupt geben, befriedigen kÄnnen: es ist, wie sie sagen, die Vorstellung eines<br />
VerhÇltnisses zwischen zwei Begriffen. Ohne nun hier Åber das Fehlerhafte der ErklÇ-<br />
rung ... mit ihnen zu zanken, . . . merke ich nur an, daÉ, worin dieses VerhÄltnis bestehe,<br />
hier nicht bestimmt ist.<br />
Wenn ich aber die Beziehung gegebener Erkenntnisse in jedem Urteile genauer<br />
untersuche, . . ., so finde ich, daÉ ein Urteil nichts anderes sei, als die Art, gegebene<br />
Erkenntnisse zur objektiven Einheit der Apperzeption zu bringen. Darauf zielt das Ver-<br />
hÇltniswÄrtchen ist in demselben, um die objektive Einheit gegebener Vorstellungen<br />
von der subjektiven zu unterscheiden.“ 7<br />
Damit lÇuft der Standpunkt von Kant darauf hinaus, die Kopula „ist“ als das Mittei-<br />
lungszeichen fÅr den Geltungsanspruch des Satzes „S ist p“ zu betrachten. Die „objek-<br />
tive Einheit der Apperzeption“ ist die Feststellung, daÉ der als ihr Gegenstand betrach-<br />
tete Satz „S ist p“ die Eigenschaft der Wahrheit hat, d. h. ein geltender Satz ist. 8<br />
In der neueren philosophischen Logik ist der Standpunkt Kants vor allem in Gestalt<br />
der sog. konstruktiven Auffassung wirksam. So betrachten z. B. P. Lorenzen <strong>und</strong> O.<br />
Schwemmer die Kopula „ist“ als ein Zeichen zur Mitteilung Åber die AusfÅhrung einer<br />
6<br />
G. W. Leibniz: Fragmente zur Logik. Hrsg. v. F. Schmidt, Berlin 1960, S. 229.<br />
7<br />
I. Kant: Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. v. R. Schmidt, Leipzig 1956, S. 187-189 (Ausg. B).<br />
8<br />
Was Kant damit meint, erkennt man gut, wenn man sich in der lateinischen Sprache des Satzes „magister<br />
est asinus“ <strong>und</strong> des Urteils „magister asinus est“ erinnert. Im Satz meint das „est“ – wie im Deutschen –<br />
das PrÇdikat; im Urteil meint das – nachgestellte – „est“ das, was im Deutschen nur durch „es ist der Fall,<br />
daÉ…“ ausgedrÅckt werden kann. Im Deutschen ist die Nachstellung des „est“ als Zeichen fÅr den Übergang<br />
vom Satz zum Urteil nicht vorhanden – wie in der klassischen Antike sowohl im Griechischen als<br />
auch im Lateinischen. (Anm. d. Verf. im Juni 2011.)<br />
4