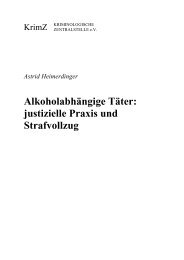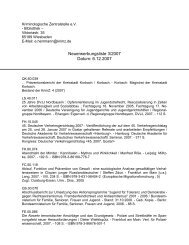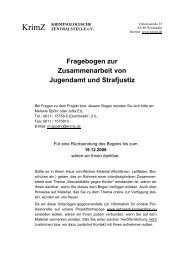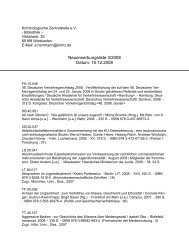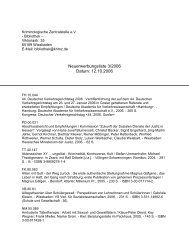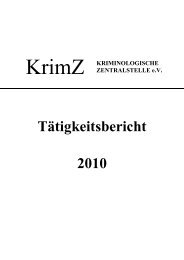Lebenslange Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung
Lebenslange Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung
Lebenslange Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3 <strong>Sicherungsverwahrung</strong><br />
tungszeitraums von 2 Jahren nach der Entlassung bei 28 % der Verurteilten zu einer neuen<br />
Straftat, die eine <strong>Freiheitsstrafe</strong> ohne Bewährung, darunter bei 8 % sogar eine Sicherungs-<br />
verwahrung zur Folge hatte.<br />
Zusätzliche Schwierigkeiten stellen sich für einen internationalen Vergleich zur Dauer<br />
der <strong>Sicherungsverwahrung</strong>. Dies hängt zunächst schlicht damit zusammen, dass es nur<br />
wenige Rechtsordnungen gibt, die eine mit den Regelungen der §§ 66 ff. StGB unmittel-<br />
bar vergleichbare Sanktion gegen schuldfähige gefährliche Straftäter kennen. 14 Das be-<br />
reits mehrfach zitierte Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall<br />
M. nennt unter den 47 Mitgliedsstaaten des Europarats Belgien, Dänemark, Frankreich,<br />
Italien, Liechtenstein, Österreich, San Marino, die Schweiz <strong>und</strong> die Slowakei. 15 Nicht<br />
alle diese Sanktionen stellen nach nationaler Rechtsauffassung Sicherungsmaßregeln dar;<br />
die Funktion der Sicherung lässt sich auch durch lange oder unbefristete <strong>Freiheitsstrafe</strong>n<br />
erreichen. Die Möglichkeiten empirischer Sanktionsforschung hängen zudem davon ab,<br />
dass solche Sanktionen in relevantem Ausmaß verhängt werden. Die Situation in einigen<br />
Nachbarländern Deutschlands stellt sich gegenwärtig folgendermaßen dar:<br />
• In Frankreich wurde 2008 eine Sanktion eingeführt, die in gewisser Weise der deut-<br />
schen nachträglichen <strong>Sicherungsverwahrung</strong> entspricht. 16 Die rétention de sûreté<br />
war nach der Vorstellung des Gesetzgebers als Maßregel mit Rückwirkung aus-<br />
gestaltet, was durch eine Entscheidung des Conseil constitutionnel unter dem ver-<br />
fassungsrechtlichen Gesichtspunkt des Rückwirkungsverbots verhindert wurde. Im<br />
März 2010 erfolgten einige gesetzgeberische Modifikationen. Es wird damit ge-<br />
rechnet, dass diese Sanktion erst auf längere Sicht praktische Bedeutung gewinnen<br />
wird.<br />
• Die in Österreich im Anschluss an den Vollzug einer <strong>Freiheitsstrafe</strong> vorgesehene<br />
Unterbringung gefährlicher Rückfallstäter wird nur äußerst selten praktiziert. Die<br />
Zahl der Personen im Vollzug dieser Maßnahme lag seit 1989 nie über vier Betrof-<br />
fenen; zuletzt war es ein einziger Untergebrachter (Bruckmüller 2011, 149; Bun-<br />
desministerium für Justiz 2011, 87).<br />
14 Einige Hinweise zu internationalen Vergleichen finden sich z.B. bei Padfield (2010) <strong>und</strong> Trips-Hebert<br />
(2010). Auf einer allgemeineren Ebene argumentieren Dünkel et al. (2010).<br />
15 EGMR, Kammerurteil vom 17. Dezember 2009, M. ./. Deutschland – 19359/04 (= EuGRZ 2010, 25<br />
).<br />
16 Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité<br />
pénale pour cause de trouble mental (Journal officiel de la République française, n° 0048, p. 3266). Zur<br />
Entstehung dieses Gesetzes <strong>und</strong> zu einer systematischen Einordnung der Sanktionsform etwa Wyvekens<br />
(2010).<br />
36