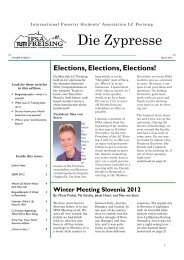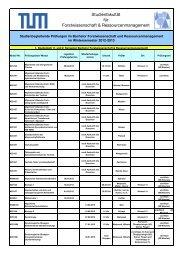Abschlußbericht zum Forschungsprojekt ST121 - Technische ...
Abschlußbericht zum Forschungsprojekt ST121 - Technische ...
Abschlußbericht zum Forschungsprojekt ST121 - Technische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
24<br />
Grundlagen<br />
genutzten Wälder in vorsalinarischer Zeit ermittelte Zierhut (2003) eine<br />
Baumartenzusammensetzung von 37% Fichte, 29% Tanne und 22% Buche. Gegen Ende der<br />
Salinenzeit nahm durch die gezielte Förderung die Fichte auf 67,5% zu, die Tanne auf 12,4%<br />
und die Buche auf 19,1% ab. Aus den totholzreichen, mehrschichtigen Beständen mit ca. 865<br />
fm/ha entstanden so bis <strong>zum</strong> 19. Jahrhundert einschichtige, fichtenreiche oder<br />
Fichtenreinbestände mit nur rd. 2/3 der usprünglichen Vorratshöhe. Mit dem 1.1.1868 wurde<br />
der Sonderstatus der Salinenwaldungen aufgehoben und diese dem „Staatsforstärar“<br />
überwiesen (Gödde 1997).<br />
Ausführlich beschäftigte sich Meister (1969a, 1969b) mit einer Analyse für den Staatswald.<br />
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatte auch hier die Begründung von Fichtenbeständen z.T.<br />
auch mit Tanne und geringen Laubbaumanteilen höchste Priorität. Schließlich wurden das<br />
höhere Kalamitätsrisiko, der negative Einfluß auf den Boden und folglich die geringere<br />
Produktionskraft von Fichtenbeständen im Vergleich <strong>zum</strong> Bergmischwald erkannt. Seit Mitte<br />
des 19. Jahrhunderts war daher die Begründung von Fichten-Tannen-Buchenbeständen das<br />
oberste Ziel für die bayerischen Staatswaldungen im Gebirge. Dies wurde auch in den<br />
Forsteinrichtungsoperaten der Forstämter deutlich hervorgehoben. Trotzdem wurden aus<br />
Kostengründen häufig Kahlschläge (bzw. oft auch eine kurz Abfolge der aufeinander<br />
folgenden Schläge “Vorbereitungshieb-Angriffshieb-Läuterung zur Entnahme des ehemaligen<br />
Unterstandes”) und Saumhiebe bis in die 60‘er Jahre des vergangenen Jahrhunderts<br />
fortgeführt (Meister 1969a, Kornprobst 2004, pers. Mittlg.). Zum Teil kam auch der für die<br />
Verjüngung günstigere, von der Erstmaßnahme (Schirmschlag) bis <strong>zum</strong> letzten Abtriebshieb<br />
(Entnahme des Schutzgestänges) etwa 20 Jahre umfassende Dunkelschlag zur Anwendung.<br />
Vereinfacht läßt sich demnach bis 1840 im westlichen, von klösterlichen Besitzungen<br />
geprägten, oberbayerischen Gebirge plenterartige Schlagführung und in den östlichen<br />
Salinengebieten Kahlschlag mit kurzzeitigen Überhalt des Schutzgestänges unterscheiden. Ab<br />
1840 dominierte dann in den gesamten Staatswaldungen der Kahlschlag.<br />
Trotz dieser Hiebsführung und soweit nicht, wie in den Salinenwäldern das Nadelholz aktiv<br />
gefördert wurde, konnte sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts der Bergwald noch<br />
ausreichend <strong>zum</strong> Mischwald verjüngen. Dies belegen Reste naturnaher Fichten-Tannen-<br />
Buchen-Altbestände. Diese konnten, wie dieser mäßig trockene Bergmischwald (Aposerido-<br />
Fagetum caricetosum albae) in Abb. 4 zeigt, auch auf flachgründigen, südexponierten<br />
Rendzinen aus Hauptdolomit bis heute die volle Schutzfunktion bewahren. Dem Ziel der<br />
Begründung gemischter Bestände im Staatswald stand dann jedoch in eklatanter Weise der