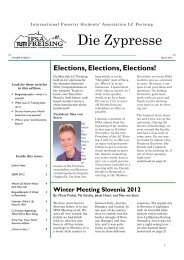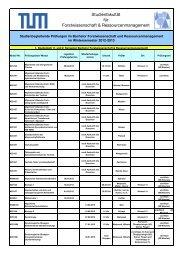- Seite 1: Technische Universität München Wi
- Seite 5: Vorwort Vorwort Diese Studie wurde
- Seite 8 und 9: IV Inhalt 4.2. Untersuchungsansätz
- Seite 11 und 12: Zusammenfassung Zusammenfassung Die
- Seite 13 und 14: Zusammenfassung Umweltbedingungen d
- Seite 15 und 16: Abstract Abstract Norway spruce is
- Seite 17 und 18: Abstract horizon specific physico-c
- Seite 19 und 20: TEIL A: Synthese 1. Einleitung Einl
- Seite 21 und 22: Einleitung Abb. 1: Schadbilder eine
- Seite 23 und 24: Grundlagen Schneeschurf auf 47% der
- Seite 25 und 26: Grundlagen Eine Besonderheit bilden
- Seite 27 und 28: Grundlagen auch Hangquellmoore und
- Seite 29 und 30: Grundlagen rezenten, flachgründige
- Seite 31 und 32: Grundlagen nur für gleiche Bodenty
- Seite 33 und 34: Grundlagen humusreicher und krümel
- Seite 35 und 36: Grundlagen 2.5. Ökologische Eigens
- Seite 37 und 38: Grundlagen Außer für Ca und Mg si
- Seite 39 und 40: Grundlagen Jahren vor Heute (b.p.)
- Seite 41 und 42: 2.7.1. Nutzungsgeschichte Grundlage
- Seite 43 und 44: Grundlagen dramatische Anstieg der
- Seite 45 und 46: Grundlagen 0,08 t/ha x 0,8 ein maxi
- Seite 47: Grundlagen Baumwachstum steigen. En
- Seite 51 und 52: Grundlagen Seslerio-Fagetum (Felsha
- Seite 53 und 54: Grundlagen Widersprüchlich hierzu
- Seite 55 und 56: Grundlagen Untersuchungszeitraum -
- Seite 57 und 58: Grundlagen Die noch geringe Erfahr
- Seite 59 und 60: Ziel und konzeptionelles Vorgehen 3
- Seite 61 und 62: Ziel und konzeptionelles Vorgehen W
- Seite 63 und 64: 4. Material und Methoden 45 4.1. Un
- Seite 65 und 66: Material und Methoden trockenen Kar
- Seite 67 und 68: Material und Methoden geworbenen. J
- Seite 69 und 70: Material und Methoden Sanierungsfl
- Seite 71 und 72: Material und Methoden ausschließli
- Seite 73 und 74: wurden nach Trocknung bei 105°C er
- Seite 75 und 76: Material und Methoden Gesamtnährel
- Seite 77 und 78: 5. Ergebnisse Ergebnisse Ergänzend
- Seite 79 und 80: Ergebnisse höheren Gesamtwurzellä
- Seite 81 und 82: Kollektiv n Baumhöhen Ergebnisse Z
- Seite 83 und 84: Ergebnisse adäquaten P-Anreicherun
- Seite 85 und 86: Anzahl verschiedener Mykorrhizen 12
- Seite 87 und 88: Ergebnisse Typen waren bei den Bäu
- Seite 89 und 90: 6. Diskussion Diskussion 6.1. Wurze
- Seite 91 und 92: Diskussion 1997, Lüscher 1990). Se
- Seite 93 und 94: Diskussion 6.2. Ernährung und Biom
- Seite 95 und 96: Diskussion Hohe pH-Werte und eine g
- Seite 97 und 98: Diskussion bodenchemisch bedingte N
- Seite 99 und 100:
Diskussion Kahlschläge gekennzeich
- Seite 101 und 102:
Diskussion durchgehend unausgewogen
- Seite 103 und 104:
fest. Diskussion Düngemaßnahmen s
- Seite 105 und 106:
Diskussion spielen die Eigenschafte
- Seite 107 und 108:
Diskussion Die optimalen Bedingunge
- Seite 109 und 110:
Diskussion mit bereits standortsang
- Seite 111 und 112:
Diskussion 14). Neben der mögliche
- Seite 113 und 114:
Diskussion 6.4. Verjüngungsnischen
- Seite 115 und 116:
Diskussion Bodenvegetationsverhält
- Seite 117 und 118:
Naturnaher, mäßig trockener Karbo
- Seite 119 und 120:
Resümee Rendzinastandorte, z.T. je
- Seite 121 und 122:
Empfehlungen für die Forstpraxis 8
- Seite 123 und 124:
Bergmischwälder Empfehlungen für
- Seite 125 und 126:
Empfehlungen für die Forstpraxis M
- Seite 127 und 128:
9. Forschungsanregungen Forschungsa
- Seite 129 und 130:
Literatur Literatur Abuzinadah RA,
- Seite 131 und 132:
Literatur Bosch C (1986) Standorts-
- Seite 133 und 134:
Literatur Ford ED (2000) Scientific
- Seite 135 und 136:
Literatur Katzensteiner K (2005) Un
- Seite 137 und 138:
Literatur Landesanstalt für Wald u
- Seite 139 und 140:
Waldforschung aktuell, 4 S. Literat
- Seite 141:
Naturschutzgebieten Bayerns 1, 73 S
- Seite 144 und 145:
Publikation I 126 Publikation I
- Seite 146 und 147:
Publikation I Abstract 128 Publikat
- Seite 148 und 149:
Publikation I 2. MATERIAL AND METHO
- Seite 150 und 151:
Publikation I 2.2. Soil processing
- Seite 152 und 153:
Publikation I 134 Publikation I sub
- Seite 154 und 155:
Publikation I 136 Publikation I Tab
- Seite 156 und 157:
Publikation I 138 Publikation I Mea
- Seite 158 und 159:
140 Publikation I 3.3. Seedling nut
- Seite 160 und 161:
142 Publikation I
- Seite 162 und 163:
Publikation I 144 Publikation I tio
- Seite 164 und 165:
Publikation I 4. DISCUSSION 146 Pub
- Seite 166 und 167:
Publikation I 148 Publikation I sho
- Seite 168 und 169:
Publikation I 150 Publikation I ten
- Seite 170 und 171:
Publikation I 152 Publikation I [14
- Seite 172 und 173:
Publikation I 154 Publikation I [40
- Seite 174 und 175:
Publikation II 156 Publikation II E
- Seite 176 und 177:
Publikation II 158 Publikation II 1
- Seite 179 und 180:
Publikation II Tabelle 1: Kurzbesch
- Seite 181 und 182:
Publikation II 2.3 Untersuchte Baum
- Seite 183 und 184:
Publikation II Im Einzelbaumansatz
- Seite 185 und 186:
Publikation II Tabelle 3: Stickstof
- Seite 187 und 188:
Publikation II Tabelle 4: Gesamtnä
- Seite 189 und 190:
Publikationen II Tabelle 5: Nährel
- Seite 191 und 192:
Publikationen II Tabelle 6: Nährel
- Seite 193 und 194:
Publikationen II Tabelle 7: Nährel
- Seite 195 und 196:
Publikation II „Humuschwund“ be
- Seite 197 und 198:
Publikation II verändern. Erkenntn
- Seite 199 und 200:
Publikation II Abbildung 1: Höhenz
- Seite 201 und 202:
Publikation II zogen worden. Daher
- Seite 203 und 204:
Publikation II zelentwicklung sein.
- Seite 205 und 206:
Zusammenfassung Publikation II Jung
- Seite 207 und 208:
Publikation II BACHMANN, M., T. PRE
- Seite 209 und 210:
Publikation II GLATZEL, G. (1971):
- Seite 211 und 212:
Publikation II MÖßNANG, M. (1992)
- Seite 213 und 214:
Publikation III Publikation III Bai
- Seite 215 und 216:
Abstract Publikation III The vertic
- Seite 217 und 218:
Materials and methods Study site de
- Seite 219 und 220:
Results ECM community structure 15.
- Seite 221 und 222:
Publikation III quently in the orga
- Seite 223 und 224:
Publikation III types, which result
- Seite 225 und 226:
Publikation III mus contents, and l
- Seite 227 und 228:
Publikation III teolytic enzymes to
- Seite 229 und 230:
Publikation III Düngeversuches an
- Seite 231 und 232:
Publikation III Hedin LO, Armesto J
- Seite 233 und 234:
Publikation III Read DJ, Perez-More
- Seite 235:
Publikation III 161, leg. 09.10.02
- Seite 238 und 239:
Publikation IV 220 Publikation IV R
- Seite 240 und 241:
Publikation IV 222 Publikation IV a
- Seite 242 und 243:
Publikation IV 224 Publikation IV F
- Seite 244 und 245:
Publikation IV Publikation IV proac
- Seite 246 und 247:
228 Publikation IV Values in the bi
- Seite 248 und 249:
Publikation IV 230 Publikation IV 3
- Seite 250 und 251:
Publikation IV 232 Publikation IV 3
- Seite 252 und 253:
Publikation IV 234 Publikation IV T
- Seite 254 und 255:
236 Variable Order of affiliation P
- Seite 256 und 257:
Publikation IV 238 Publikation IV 4
- Seite 258 und 259:
Publikation IV 240 Publikation IV I
- Seite 260 und 261:
Publikation IV 242 Publikation IV A
- Seite 262 und 263:
Publikation IV 244 Publikation IV G
- Seite 264 und 265:
Publikation IV 246 Publikation IV O
- Seite 267 und 268:
Danksagung Danksagung Die vorliegen