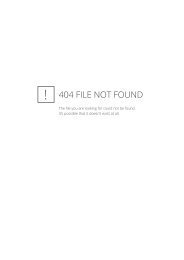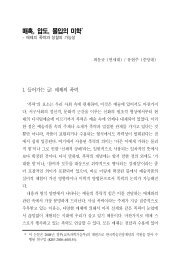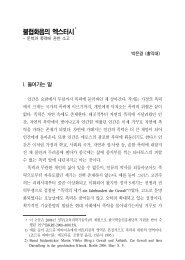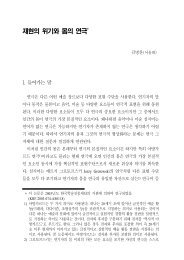Die Idealisierung der Frau und die Negation der weiblichen Sexualität
Die Idealisierung der Frau und die Negation der weiblichen Sexualität
Die Idealisierung der Frau und die Negation der weiblichen Sexualität
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Die</strong> <strong>Idealisierung</strong> <strong>der</strong> <strong>Frau</strong> <strong>und</strong> <strong>die</strong> <strong>Negation</strong><br />
<strong>der</strong> <strong>weiblichen</strong> Sexualitä t * 1)<br />
.<br />
Roh, Yeong-Don (Chung-Ang Uni)<br />
<strong>Die</strong> Absicht <strong>der</strong> vorliegenden Arbeit ist es, auf <strong>der</strong> Basis von Hauptmanns<br />
naturalistischen Werken Aufschluß über <strong>die</strong> Darstellung seiner idealen Müttergestalten<br />
zu geben <strong>und</strong> <strong>die</strong>se Problematik beson<strong>der</strong>s unter dem Blickwinkel bestimmter,<br />
kulturhistorisch bedeuten<strong>der</strong> Sujets wie Ehe, Familie <strong>und</strong> <strong>Sexualität</strong> aufzugreifen. Es<br />
ist zu beobachten, dass das Mütterliche bei Hauptmann sowohl in seinem<br />
dichterischen Anfang als auch im späteren Schaffen immer noch einen positiven<br />
Ausdruck findet. Bemerkenswert erscheint im Zusammenhang <strong>der</strong> vorliegenden<br />
Arbeit, dass auch in den naturalistischen Werken Hauptmanns zum großen Teil<br />
Ansätze zu einer idealistischen Charakteristik des klassischen Mutterbildes zu<br />
beobachten sind, obwohl sich <strong>die</strong> Muttergestalten meist dem mo<strong>der</strong>nen Leben sowie<br />
dem wirklichen Problem gegenüber als unzulänglich erweisen.<br />
Beson<strong>der</strong>s in drei Muttergestalten seiner naturalistischen Werke zeichnet<br />
Hauptmann das Wesen des idealen Muttertypus: <strong>die</strong>s sind <strong>Frau</strong> Buchner in Das<br />
Friedensfest (1889), <strong>Frau</strong> Vockerat in Einsame Menschen (1891) <strong>und</strong> <strong>Frau</strong> Flamm in<br />
Rose Bernd (1903). Mit dem treu harrenden, still duldenden Wesen, das seiner<br />
Familie mit Pflege <strong>und</strong> Liebe einer selbstlosen Mutter entgegenkommt, nähert sich<br />
* 이 논문은 2008년도 중앙대학교 우수연구자연구비 지원에 의한 것임.<br />
Hauptmann offenbar dem Bild des traditionsgeb<strong>und</strong>enen Mutterideals. Charakteristisch<br />
für <strong>die</strong>se mütterliche <strong>Frau</strong> ist, dass kaum erotische Ausstrahlung von ihr ausgeht. Im<br />
idealen Fall kommt sie gar nicht erst den heftigen Aufregungen <strong>der</strong> Erotik näher. Sie<br />
wird auch in vielen Fällen ohne wahrnehmbare Körperlichkeit dargestellt. Sowohl in<br />
<strong>der</strong> traditionellen Betrachtungsweise <strong>der</strong> Männer als auch in <strong>der</strong> Literatur gibt eine<br />
de-sexualisierte, in ihren Pflichten für Mann <strong>und</strong> Kin<strong>der</strong> aufgehende <strong>Frau</strong> prinzipiell<br />
eine lebendige Verkörperung des idealen Muttertums ab. Das ist - folgt man Otto<br />
Weininger - eine durchgehende Denkweise <strong>der</strong> Männer, dass “<strong>die</strong> absolute Mutter<br />
den Koitus nie als Selbstzweck, um <strong>der</strong> Lust willen, herbeiwünschen würde”. 1)<br />
In Das Friedensfest bemüht sich Hauptmann das innere Wesen <strong>Frau</strong> Buchners, von<br />
dem nur Harmonie <strong>und</strong> Ruhe ausströmt, auszumalen, <strong>und</strong> vermeidet es, ihre<br />
Körperlichkeit zu beschreiben:<br />
Ihr ganzes Wesen drückt eine ungewöhnliche Herzlichkeit aus, <strong>die</strong> durchaus echt ist, auch<br />
wenn <strong>die</strong> Art, mit <strong>der</strong> sie sich k<strong>und</strong>gibt, zuweilen den Eindruck <strong>der</strong> Ziererei macht. Ihre<br />
Sprache ist geflissentlich rein, in Momenten des Affekts deklamatorisch. Ein Hauch <strong>der</strong><br />
Zufriedenheit <strong>und</strong> des Wohlbehagens scheint von ihr auszugehen. (CA I 105) 2)<br />
<strong>Die</strong> äußeren Züge <strong>der</strong> edlen, mütterlichen <strong>Frau</strong> Buchner werden auch sehr<br />
plastisch beschrieben: “eine ges<strong>und</strong> aussehende, gutgenährte, fre<strong>und</strong>lich blickende<br />
Person, einfach, solid <strong>und</strong> sehr adrett gekleidet. Schlichte Haartracht.” (CA I 105)<br />
Durch <strong>die</strong>se anschauliche Darstellung des Äußeren blickt mittelbar <strong>die</strong> hohe<br />
Wertschätzung <strong>der</strong> verborgenen Haltung <strong>der</strong> Güte, <strong>der</strong> Hingebung, des Erbarmens <strong>und</strong><br />
des Pflegens sowie <strong>die</strong> große Tugendgesinnung <strong>der</strong> stillen Daseinsform <strong>der</strong> <strong>Frau</strong><br />
1) Otto Weininger, Geschlecht <strong>und</strong> Charakter, Eine prinzipielle Untersuchung, München:<br />
Matthes & Seitz 1980, S. 283.<br />
2) Gerhart Hauptmann Sämtliche Werke, hg. v. Hans Egon Hass, fortgeführt v. M. Machatzke<br />
u. W. Bungies (ab Bd. 10), 11 Bde., Frankfurt/M, Berlin, (Wien): Propyläen 1962.<br />
(Centanar-Ausgabe zum 100. Geburtstag des Dichters, 15. Nov. 1962) <strong>Die</strong> folgenden<br />
Belegstellen aus <strong>der</strong> Centanar-Ausgabe sind durch <strong>die</strong> Abkürzung CA vor <strong>der</strong> Bandzahl <strong>und</strong><br />
Seitenangabe gekennzeichnet.
durch. Selbst in <strong>die</strong>ser <strong>Frau</strong> sind so stark <strong>die</strong> überlieferten bürgerlichen<br />
Anschauungen über <strong>die</strong> Rolle <strong>der</strong> <strong>Frau</strong> verwurzelt, dass von ihr auch das traditionelle<br />
Weiblichkeitsideal gepriesen wird. <strong>Frau</strong> Buchner betrachtet sich selbst vor allem als<br />
Mutter: “Ich habe das Kind erzogen. Es ist mir alles in allem gewesen; an seinem<br />
Glück zu arbeiten ist auf <strong>der</strong> Welt mein einziger Beruf gewesen.” (CA I 156) Sie<br />
findet den Beruf <strong>der</strong> <strong>Frau</strong>, “auf den sie durch ihre bürgerliche Erziehung <strong>und</strong><br />
Charakterbildung innerlich angewiesen ist”, worauf Horkheimer bei <strong>der</strong><br />
Rollenbeschreibung <strong>der</strong> bürgerlichen Hausfrau hinweist, ausschließlich in einer Ehe,<br />
“in <strong>der</strong> sie selbst Versorgung findet <strong>und</strong> sich um ihre Kin<strong>der</strong> sorgen kann”. 3)<br />
An <strong>der</strong> echten, idealen Weiblichkeit gemessen kennt <strong>Frau</strong> Buchner gewiss weniger<br />
Pflichten gegen sich selbst als Pflichten gegen an<strong>der</strong>e, sei es als Mutter o<strong>der</strong> als<br />
Gattin. So tritt ihr eigenes Leben ganz hinter dem Leben zurück, dem sie das eigene<br />
zum Opfer bringt. <strong>Die</strong> tiefe Verankerung ihrer Denk- sowie Lebensweise in <strong>der</strong> alten<br />
Religiosität <strong>und</strong> dem überkommenen Brauchtum zeigt sich auch ausdrücklich darin,<br />
dass für sie <strong>der</strong> Weihnachtsabend nicht vollkommen ist, wenn nicht Weihnachtslie<strong>der</strong><br />
von Kin<strong>der</strong>n gesungen werden. (CA I 144)<br />
<strong>Die</strong>se hilfsbereite, opfermutige <strong>Frau</strong> Buchner tritt in <strong>die</strong> prekäre Familiensituation<br />
<strong>der</strong> Scholzens ein, um Versöhnung <strong>und</strong> Liebe in <strong>die</strong>se von gegenseitiger Missachtung<br />
<strong>und</strong> Feindseligkeit geprägte Familie einzubringen. In ihrem einfachen Lebensmut <strong>und</strong><br />
ihrer Herzensgüte glaubt sie <strong>die</strong> Aussöhnung zwischen den Familienmitglie<strong>der</strong>n<br />
herbeiführen zu können. Sie traut sich sogar zu, den Umgang mit den komplizierten<br />
Menschen <strong>die</strong>ser Familie zu meistern, da ihr Mann selber Künstler war: “Mit<br />
Künstlern muß man umzugehen wissen. Ich hab's gelernt, mein seliger Mann war<br />
auch einer.” (CA I 111) Während <strong>Frau</strong> Buchner alles Scheußliche <strong>und</strong> Schwere, was<br />
das Familienleben <strong>der</strong> Scholzens heraufbeschworen hat, mit ihrer Milde <strong>und</strong><br />
Herzensgüte aufzufangen versucht, sieht sie vor allem in Wilhelm den Schuldigen an<br />
<strong>die</strong>ser Familienkatastrophe <strong>und</strong> verlangt von ihm, sich vor dem Vater zu demütigen:<br />
3) Max Horkheimer/Erich Fromm/Herbert Marcuse, Stu<strong>die</strong>n über Autorität <strong>und</strong> Familie.<br />
Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialforschung, Paris 1936, S. 70.<br />
Sie müssen sich vor Ihrem armen Vater erniedrigen. - Erst dann werden Sie sich wie<strong>der</strong><br />
ganz frei fühlen. Rufen Sie ihn an! Beten Sie ihn an! Ach Wilhelm! Das müssen Sie tun!<br />
Seine Knie müssen Sie um klammern - <strong>und</strong> wenn er Sie mit dem Fuß tritt, wehren Sie<br />
sich nicht! Reden Sie kein Wort! Geduldig wie ein Lamm! (CA I 128)<br />
Damit unterstützt <strong>Frau</strong> Buchner, <strong>die</strong> in dem Drama als eine vernunftmäßig<br />
Handelnde <strong>und</strong> eine über gute Menschenkenntnis Verfügende auftritt, das<br />
überkommene patriarchalische Wertsystem <strong>der</strong> bürgerlichen Gesellschaft. Sie befindet<br />
sich ganz in Übereinstimmung mit <strong>der</strong> bürgerlichen Familienideologie, indem sie<br />
Wilhelm zur bedingungslosen Unterwerfung unter <strong>die</strong> Vaterautorität zwingt, 4) <strong>und</strong><br />
trägt dadurch Züge jener ‘autoritätsstärkenden Funktion’, <strong>die</strong> Max Horkheimer<br />
beschreibt. Sie erweist sich als ein “<strong>die</strong> Autorität in <strong>die</strong>ser Gesellschaft<br />
reproduzieren<strong>der</strong> Faktor”, da sie “sich dem Gesetz <strong>der</strong> patriarchalischen Familie<br />
beugt”. 5)<br />
Trotz all ihrer ehrlichen Bestrebungen fühlt <strong>Frau</strong> Buchner sich dem Ausmaß <strong>der</strong><br />
Mißstände in <strong>die</strong>ser Familie nicht gewachsen. Sie muss jetzt gestehen, dass mit<br />
bloßem Willen nichts auszurichten ist. Angesichts solcher trostlosen<br />
Familienatmosphäre von Missbehagen <strong>und</strong> Bitterkeit wird ihr “so angst <strong>und</strong> bange”<br />
(CA I 154), dass sie sich “entsetzlich um Ida” sorgt (CA I 154), obwohl sie immer<br />
noch mit Wilhelms gutem Willen rechnet. Sie sieht ein, dass sie Unmögliches<br />
erstrebt hat <strong>und</strong> dass all ihr Tun daher von Beginn an unverantwortlich war <strong>und</strong> das<br />
Leben ihrer Tochter gefährdet, vielleicht schon negativ beeinflusst hat. 6)<br />
Folglich macht sie sich selbst wegen Idas Schicksal Vorwürfe: “Ich schäme mich<br />
förmlich. Was habe ich mir zugetraut! Solche Naturen wollte ich lenken, ich<br />
schwache, einfältige Person! - Nun wankt alles. Ich fühle auf einmal meine<br />
4) Vgl. Helmut Scheuer, Gerhart Hauptmanns Das Friedensfest. Zum Familiendrama im<br />
deutschen Naturalismus. In: R. Leroy/E. Pastor (Hg.): Deutsche Dichtung um 1890, Bern<br />
u.a. 1991, S. 399-416, hier S. 414.<br />
5) M. Horkheimer/E. Fromm/H. Marcuse, a.a.O., S. 69.<br />
6) Vgl. Karl S. Guthke/Hans M. Wolff, Das Leid im Werke Gerhart Hauptmanns, Bern 1958,<br />
S. 62.
furchtbare Verantwortung: für mein Kind, für meine Ida bin ich doch verantwortlich.”<br />
(CA I 155) <strong>Frau</strong> Buchner, <strong>die</strong> Hauptmanns Glauben an echte Weiblichkeit zu<br />
beweisen scheint, ist <strong>der</strong> Größe <strong>der</strong> Probleme intellektuell nicht gewachsen. Sie wird<br />
selbst auf einmal von Ratlosigkeit sowie Verzweiflung ergriffen. Angesichts <strong>der</strong><br />
Hoffnungslosigkeit <strong>und</strong> <strong>der</strong> fehlenden Perspektive für ihre Tochter verstummt <strong>Frau</strong><br />
Buchner <strong>und</strong> verläßt im 3. Akt <strong>die</strong> Bühne. Auch eine solche ideale Mutterfigur ist<br />
also zum Scheitern verurteilt.<br />
.<br />
<strong>Die</strong> Mutter Vockerat in dem Drama Einsame Menschen kommt auch aus <strong>der</strong><br />
bürgerlichen Welt christlicher Gläubigkeit. Ihr Leben erweist sich als ein<br />
ununterbrochenes Verb<strong>und</strong>ensein mit Religiosität, mit <strong>der</strong> Hauptmann das<br />
Weiblichkeitsideal verbindet: “Eine <strong>Frau</strong> muß fromm sein.” (GH Tb. 1892-1894, S.<br />
64f) 7) Hauptmann stellt das Weiblichkeitsideal sogar in <strong>die</strong> Ebene <strong>der</strong> Religiosität,<br />
<strong>der</strong> gegenüber er sich aber sonst stark ablehnend stellt. 8) Er läßt hier <strong>Frau</strong> Vockerat<br />
7) Gerhart Hauptmann Tagebuch 1892 bis 1894, Hg. v. M. Machatzke, Frankfurt a. M., Berlin,<br />
Wien: Propyläen 1985.<br />
8) Um <strong>die</strong> Zeit <strong>der</strong> zweiten Ehe mit Margarete Marschalk sind bei Hauptmann neben<br />
erotischen Träumen doch zumeist Verzweiflung <strong>und</strong> Flucht ins Irreale zu beobachten, denn<br />
noch bleibt <strong>die</strong> Ehe- <strong>und</strong> Geschlechtsmoral in dem traditionellen Sittenbild befangen. In <strong>der</strong><br />
Beschäftigung mit dem Begriff <strong>der</strong> freien Liebe konfrontiert Hauptmann seine Vorstellungen<br />
mit Fragen des Christentums, das er für abgestorben <strong>und</strong> unattraktiv hält. Folglich wendet<br />
Hauptmann sich hin zu mythologischen Gegenentwürfen. Er notiert 1892: “Stück: Der<br />
Sonnenkultus <strong>Die</strong> dünne Schicht Christentum, <strong>der</strong> heidnische Fond”. (GH Tb. 1892-1894,<br />
17) Am Tage vor Ostern 1892 formuliert Hauptmann seine Positionen folgen<strong>der</strong>maßen: “<strong>Die</strong><br />
christliche Krankheit. <strong>Die</strong> heidnische Ges<strong>und</strong>heit. Aber auch <strong>die</strong> heidnische Naturreligion<br />
Sonnenanbetung. [ ] Das Christentum dressiert <strong>die</strong> Menschen für den Himmel, das heißt:<br />
für den Tod <strong>und</strong> zu Tode”. (GH Tb. 1892-1894, 18) In <strong>der</strong> skeptischen Haltung gegen das<br />
Christentum benennt er bereits im Frühjahr 1891 das Heidentum als zeugende, ges<strong>und</strong>e<br />
Kraft: “Der Heide drängt nach dem Licht. Der Christ nach <strong>der</strong> Dunkelheit. Der Heide hat<br />
<strong>die</strong> Augen voll Sonne, <strong>der</strong> Christ - blind gemacht - empfindet nur Dunkelheit. [ ] <strong>Die</strong><br />
Sonne, <strong>die</strong> Urzeugerin, das Zeugende im Menschen, <strong>die</strong> Liebe. <strong>Die</strong> Liebe, zurückgedrängt,<br />
selber bekennen <strong>und</strong> beurteilen: “Ein Mann ohne Frömmigkeit, das ist schon schlimm<br />
genug. Aber eine <strong>Frau</strong>, <strong>die</strong> nicht fromm ist [ ] Ich bete ja so viel. Ich bitte Gott<br />
ja täglich.” (CA I 173) Wahrhaftig erscheint <strong>Frau</strong> Vockerat als ein weibliches Inbild<br />
<strong>der</strong> traditionellen bürgerlichen Wertvorstellungen. <strong>Die</strong>se fromme <strong>Frau</strong> schöpft ihre<br />
Gewissheit <strong>und</strong> Tatkraft aus tiefem Gottesglauben: “wenn ich mal so recht voller<br />
Sorgen bin, <strong>und</strong> ich hab' mich dann so recht inbrünstig ausgebetet, hab' so alles dem<br />
lieben Vater im Himmel ans Herz gelegt, da wird mir so leicht, so fröhlich ums Her<br />
z !” (CA I 173) So nimmt in ihrer Seele ein erbarmungsvoller Gott, <strong>der</strong> ihr den<br />
schönsten Herzenstrost <strong>und</strong> <strong>die</strong> innere Ruhe gewährt, <strong>die</strong> höchste Stelle ein. Damit<br />
stellt <strong>die</strong>se ideale, mütterliche <strong>Frau</strong> in ihrer Bescheidenheit sich als ein eher kleines,<br />
einfältiges Wesen dar, <strong>und</strong> sie wird wie<strong>der</strong>um in eine stille, gefühlvolle Sphäre<br />
gerückt.<br />
Ihre Lebensanschauung ist völlig durch das überkommene Rollenmuster, das<br />
zugleich für sie für ewig gilt, geregelt: Mit dem Beruf <strong>der</strong> Mutter soll <strong>der</strong><br />
Einflussbereich <strong>der</strong> <strong>Frau</strong> begrenzt sein. Daher glaubt sie, dass ihr Leben erst<br />
angefangen habe, als Gott ihr den Sohn Johannes schenkte: “Sieh mal, wie war's<br />
denn bei uns: erst haben wir uns hingeschleppt, vier Jahre - ich <strong>und</strong> mein Mann -<br />
das war gar kein Leben. Dann erhörte <strong>der</strong> liebe Gott unsre Bitten <strong>und</strong> schenkte uns<br />
den Johannes. Da fing unser Leben erst an, Käthchen!” (CA I 173) <strong>Frau</strong> Vockerat<br />
kennt in ihrem ganzen Leben nichts Größeres in <strong>der</strong> Welt, als gerade den Interessen<br />
ihres Sohnes zu entsprechen, <strong>und</strong> ist <strong>der</strong> Meinung, dass <strong>die</strong> <strong>Frau</strong> um des Kindes<br />
willen <strong>die</strong> Familie nicht zerreißen sollte. In Ibsens einflussreichem Drama Nora wirkt<br />
<strong>die</strong> Protagonistin dadurch sicher unnatürlich, dass eine Mutter es über sich bringt, <strong>die</strong><br />
Kin<strong>der</strong> dem Gatten, den sie doch verachtet, zu lassen. Nach <strong>Frau</strong> Vockerats<br />
Überzeugung soll ihre Schwiegertochter Käthe auch <strong>die</strong> still duldende, sich ganz auf<br />
das Kin<strong>der</strong>wohl konzentrierende Mutter sein, <strong>die</strong> wie ein guter Geist über <strong>der</strong> Familie<br />
erzeugt Schwären <strong>und</strong> <strong>die</strong> christliche Para<strong>die</strong>shalluzination wie alle Para<strong>die</strong>shalluzinationen<br />
des Himmels. <strong>Die</strong> freie Liebe zeugt das Erdenpara<strong>die</strong>s.” (GH Hs 474-5.e Heir zit. nach <strong>der</strong><br />
Anmerkung des Herausgebers von Gerhart Hauptmann Tagebuch 1892-1894, S. 153f.)
steht. Solche Ideale werden selbst dann aufrechterhalten, wenn es in <strong>der</strong> Ehe schlecht<br />
geht <strong>und</strong> nicht einmal das Kind, das in so mancher Ehe Bindendes ist, hier helfen<br />
kann.<br />
<strong>Frau</strong> Vockerat, <strong>die</strong> selbst ganz im Leben ihres Sohnes aufgeht, setzt alles daran,<br />
Johannes “zu einem frommen Christenmenschen zu erziehen”. (CA I 196) Sie sieht<br />
in dem Kind eine Gnade Gottes. Deshalb hat sie zum Herrgott gebetet, er möge sie<br />
segnen. Folglich besteht für sie <strong>die</strong> mütterliche Aufgabe vor allem darin, ihren Sohn<br />
fromm zu erziehen. <strong>Die</strong>se gläubige Mutter sieht aber von Anfang an, dass Johannes<br />
“seinen Gott [ ] halt doch verloren” (CA I 196) <strong>und</strong> damit den falschen Weg<br />
eingeschlagen hat. Ungeachtet ihres Mutterstolzes glaubt sie, dass <strong>die</strong> größte “Unruhe<br />
<strong>und</strong> Hast” ihres Sohnes, <strong>die</strong> ihr als “<strong>die</strong> reine Hetzjagd” (CA I 196) erscheint, als<br />
Abrücken von Gott zu deuten sei: “Seht ihr nun! Seht ihr! was hab' ich gesagt! Seht<br />
ihr! Ein Haus, hab' ich gesagt, aus dem <strong>der</strong> liebe Gott verjagt ist, bricht über Nacht<br />
zusammen.”(CA I 224) Ganz im beschränkten Gesichtsfeld ihrer Gläubigkeit<br />
befangen, versteht sie nicht das freimütige Ringen ihres Sohnes um eine neue Idee.<br />
Indem sie <strong>die</strong> Ruhelosigkeit <strong>und</strong> Gereiztheit ihres Sohnes auf den Mangel an<br />
Glauben zurückführt, befürchtet sie sogar in <strong>der</strong> Fre<strong>und</strong>schaft ihres Sohnes mit <strong>der</strong><br />
Studentin Anna einen Ehebruch. In <strong>die</strong>ser einfältigen, religiösen Muttergestalt zeigt<br />
sich deutlich <strong>die</strong> Unfähigkeit, neuen Ideen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>s gearteten Gesinnungen<br />
zugänglich zu sein. Dem Umstand, dass Johannes nicht ihre fromme Gläubigkeit teilt,<br />
steht sie verständnislos gegenüber. Mit <strong>der</strong> konservativen, frommen Gesinnung ist in<br />
ihrem Wesen eine praktische Veranlagung gepaart. Von <strong>der</strong> geistigen Welt <strong>der</strong><br />
Männer entfremdet, lebt sie sich in <strong>der</strong> kleinen Denkart <strong>der</strong> allgemeinen <strong>Frau</strong>enwelt<br />
aus. Damit geht auch eine Tendenz zur <strong>Idealisierung</strong> <strong>der</strong> <strong>Frau</strong> <strong>und</strong> eine hohe<br />
Wertung <strong>der</strong> Mutterschaft einher, <strong>die</strong> aufgr<strong>und</strong> <strong>der</strong> Differenzierung des<br />
Geschlechtscharakters gerade auch bei Hauptmann als einen von Natur gegebenen,<br />
ureigensten Wirkungsbereich <strong>der</strong> <strong>Frau</strong> zu gelten hat. 9)<br />
9) <strong>Die</strong> Differenzierung <strong>und</strong> auch Polarisierung <strong>der</strong> Geschlechtscharaktere ist bei Hauptmann<br />
offensichtlich etwas von <strong>der</strong> Natur Vorgegebenes. Danach sollte sich jedes Geschlecht auf<br />
Es muss <strong>Frau</strong> Vockerat notwendigerweise ein Verständnis für <strong>die</strong> geistige Welt<br />
ihres Sohnes sowie für sein Streben fehlen, da sie allen ihrer eigenen Art fremden<br />
Dingen verständnislos entgegentritt. Ihr Misstrauen <strong>und</strong> ihre Sorge wegen <strong>der</strong><br />
Glaubenslosigkeit des Sohnes treiben den aus seiner inneren Haltlosigkeit ratlosen<br />
Johannes immer weiter in <strong>die</strong> Enge. Als schreckliche Vision erscheint er <strong>der</strong> Mutter:<br />
“Seht ihr! Irret euch nicht! Seht ihr nun? Was hab' ich gesagt? Erst Gottesleugner,<br />
dann Ehebrecher, dann ” (CA I 224) Zuletzt kommt Johannes <strong>die</strong>se Familie wie ein<br />
Gefängnis vor. Ihre tiefe mütterliche Liebe <strong>und</strong> Fürsorge kompensieren nicht ihre<br />
Verständnislosigkeit. Damit zeigt sich in <strong>die</strong>ser hingebungsvollen, religiösen<br />
Muttergestalt gleichzeitig, dass allein <strong>die</strong> übergroße Mutterliebe kaum das Verständnis<br />
für das geistige Leben des Sohnes ersetzen kann.<br />
<strong>Die</strong> Tatsache, dass Hauptmann auch in seinen naturalistischen Werken oft religiöse<br />
Fragen erörtert <strong>und</strong> fromme Menschen zur Gestaltung bringt, wird einerseits auf sein<br />
inneres Erlebnis selbst begründet sein. Er empfängt aus dem Heimatboden, <strong>der</strong> Jakob<br />
Böhme, Angelus Silesius <strong>und</strong> Hermann Stehr hervorgebracht hat, <strong>die</strong> besten,<br />
lautersten Kräfte <strong>der</strong> Seele <strong>und</strong> den Glauben <strong>der</strong> Mystik. Zu dem schlesischen<br />
Stammerbe einer tiefen Innerlichkeit sowie einer mystischen Weltanschauung kommt<br />
ernste Frömmigkeit, insbeson<strong>der</strong>s von mütterlicher Seite her. Entscheidend in <strong>die</strong>ser<br />
Richtung ist Hauptmanns Aufenthalt im Hause seiner Tante Julie Schubert. Während<br />
<strong>der</strong> Jahre 1878-1880, <strong>die</strong> er im Striegauer Kreise zubrachte, kämpft er selbst um<br />
seinen Glauben <strong>und</strong> seinen Gott. <strong>Die</strong> Eindrücke seiner Kindheit in <strong>der</strong> schlesischen<br />
Heimat sowie <strong>die</strong> tiefe Beeinflussung <strong>der</strong> religiösen Umgebung daheim <strong>und</strong> bei den<br />
Schuberts hat Hauptmanns empfängliche Seelenleben auf Lebensdauer beeindruckt.<br />
seine Aufgabe besinnen sowie <strong>die</strong> von <strong>der</strong> Natur aus angewiesene Stellung bewahren.<br />
Folglich wendet er sich gegen das Heraustreten <strong>der</strong> <strong>Frau</strong> aus den sogenannten <strong>weiblichen</strong><br />
Bezirken: “Es gibt <strong>Frau</strong>en, <strong>die</strong> <strong>Frau</strong>en <strong>und</strong> sonst ohne Talente sind, <strong>die</strong> aber nach Geist<br />
hungern, wie <strong>der</strong> Fisch, auf dem Strande, nach seinem Element. Sie öffnen <strong>und</strong> schließen<br />
gleichsam Kiemen <strong>und</strong> M<strong>und</strong> ihres Geistes krampfhaft, um aus <strong>der</strong> leeren Luft in <strong>die</strong> leere<br />
Seele Lebensgeist zu atmen.” (Gerhart Hauptmann Tagebücher 1897-1905. Hg. v. M.<br />
Machatzke. Frankfurt/M, Berlin, Wien: Propyläen 1987, S. 420)
Eine Reihe <strong>die</strong>ser frommen, idealen Muttergestalten in Hauptmanns naturalistischen<br />
Werken ist an<strong>der</strong>erseits als eine Tendenz <strong>der</strong> Zeit zur <strong>Idealisierung</strong> <strong>der</strong> <strong>Frau</strong> zu<br />
verstehen, <strong>die</strong> sich zusammen mit <strong>der</strong> Tendenz zur Dämonisierung <strong>und</strong><br />
Stigmatisierung <strong>der</strong> Weiblichkeit in jenen literarischen Modellen sowie jener<br />
männlichen Bildproduktion im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t - Gustav Moreaus Bild <strong>der</strong> Salome<br />
(1876) <strong>und</strong> sinnlich-dämonisierte <strong>Frau</strong>engestalten von Aubrey Beardsley o<strong>der</strong> von<br />
Wedekinds Lulu (1894; 1904) - beobachten läßt. <strong>Die</strong>se <strong>Idealisierung</strong> ist im Gr<strong>und</strong>e<br />
eine an<strong>der</strong>e Form <strong>der</strong> Unterdrückung <strong>der</strong> <strong>weiblichen</strong> <strong>Sexualität</strong>.<br />
Für eine <strong>der</strong>artig idealisierte Muttergestalt ist das praktische Wirken im Haus <strong>und</strong><br />
in <strong>der</strong> Familie <strong>der</strong> Lebensinhalt. Meist erscheint sie als <strong>die</strong> Nebenfigur, <strong>die</strong> mehr für<br />
<strong>die</strong> an<strong>der</strong>n als für sich selbst braucht <strong>und</strong> wenig Individualität hat. Vor allem sollte<br />
<strong>die</strong> <strong>Frau</strong> bei Hauptmann, <strong>der</strong> ebenfalls wie an<strong>der</strong>e Männer seiner Zeit von <strong>der</strong><br />
Differenzierung des Geschlechtscharakters ausgeht <strong>und</strong> gegen das Ausbrechen <strong>der</strong><br />
<strong>Frau</strong> aus ihrer natürlichen Bestimmung ist, auf ihren eigenen Bereich beschränkt<br />
bleiben <strong>und</strong> <strong>der</strong> geistigen Welt des Mannes fern bleiben. Folgerichtig stellt eine<br />
<strong>der</strong>artig ideale Mutter sich trotz all ihres ehrlichen Wollens als eine dem wirklichen<br />
Problem o<strong>der</strong> dem mo<strong>der</strong>nen Menschenschicksal nicht gewachsene Person heraus.<br />
Das ehrliche Bestreben <strong>der</strong> <strong>Frau</strong> Vockerat um Käthe, <strong>die</strong> immer unter dem<br />
Gedanken leidet, dass sie ihrem Mann geistig nicht genügt <strong>und</strong> dass sie das geistige<br />
Band zwischen sich <strong>und</strong> ihrem Mann Johannes nicht herstellen kann, vermag<br />
ebenfalls kein positives Ergebnis zu bringen, denn ihre konservative <strong>und</strong> fromme<br />
Gesinnung treibt ihren Sohn in den Freitod. Wie<strong>der</strong>um - nach <strong>Frau</strong> Buchner in Das<br />
Friedensfest - ist eine ‘ideale’ Mutter mit ihrem Anspruch an <strong>die</strong> Familie gescheitert.<br />
.<br />
In dem traditionellen Rollenverständnis <strong>der</strong> <strong>Frau</strong> hat <strong>Frau</strong> Flamm in Rose Bernd<br />
viel Gemeinsames mit <strong>Frau</strong> Buchner <strong>und</strong> <strong>Frau</strong> Vockerat. Im Vergleich mit <strong>Frau</strong><br />
Buchner, <strong>die</strong> zur besten Stütze des Patriarchats zählt, <strong>und</strong> <strong>Frau</strong> Vockerat, <strong>die</strong><br />
Religiosität über <strong>die</strong> Mutterliebe zu ihrem Sohn stellt, erscheint <strong>die</strong> kin<strong>der</strong>lose <strong>Frau</strong><br />
Flamm - so paradox das klingen mag - als <strong>die</strong> Verkörperung <strong>der</strong> reinen Mutterschaft.<br />
Ihr mütterliches Gefühl stellt sich noch stärker als bei den an<strong>der</strong>en dar. Bei <strong>der</strong><br />
Schil<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Physiognomie <strong>Frau</strong> Flamms bemüht sich Hauptmann beson<strong>der</strong>s<br />
eindrucksvoll, ihr <strong>die</strong> feinsten <strong>und</strong> schönsten Züge einer idealen Weiblichkeit zu<br />
verleihen, obwohl manche <strong>die</strong>ser episch entworfenen Elemente auf <strong>der</strong> Bühne schwer<br />
auszuspielen sind:<br />
Das Gesicht <strong>der</strong> <strong>Frau</strong> Flamm hat große, imponierende Verhältnisse. Ihre Augen sind<br />
hellblau <strong>und</strong> durchdringend, <strong>die</strong> Stirn hoch, <strong>die</strong> Schläfe breit. Ihr Haar ist bereits grau <strong>und</strong><br />
dünn, sie trägt es in korrektestem Scheitel. Sie streicht es zuweilen leicht mit den<br />
Fingerspitzen <strong>der</strong> flachen Hand zurück. Der Ausdruck ihres Gesichts verrät Wohlwollen.<br />
Der Ernst ist ohne Härte darin. Um Auge, Nase <strong>und</strong> M<strong>und</strong> spielt viel Schalkhaftigkeit.<br />
(CA II 202)<br />
<strong>Frau</strong> Flamm trägt auch wie <strong>die</strong> meisten idealen Muttergestalten Hauptmanns <strong>die</strong><br />
ovalen Gesichtszüge mit schwarzem, gescheiteltem Haar. <strong>Die</strong>se physiognomischen<br />
Züge hat allerdings <strong>die</strong> eigene Mutter des Dichters <strong>und</strong> auch seine erste <strong>Frau</strong> Marie,<br />
von <strong>der</strong> sich Hauptmann “bemuttert” (GH Tb. 1897-1905, 242) fühlt:<br />
Mimis eigenartige Schönheit fiel unter den Schwestern am meisten auf. Wenn sie mit<br />
dem Blauschwarz ihres Haares, den dunklen Augen im weißen Oval des Gesichts, mit<br />
ihren jugendlich vollen Form im Weiß <strong>und</strong> Blau <strong>die</strong>ses Raumes stand, steigerte sich bei<br />
mir das Gefühl ihres wun<strong>der</strong>vollen Reizes bis zur Schmerzhaftigkeit. (CA VII 848)<br />
Zugleich nähert sich Hauptmann in <strong>der</strong> Darstellung <strong>die</strong>ser mütterlichen <strong>Frau</strong> dem<br />
traditionellen literarischen <strong>Frau</strong>enbild, in dem <strong>die</strong> ideale Mutter allein durch absolute<br />
Enthaltsamkeit <strong>und</strong> Selbstlosigkeit als Gegenmodell <strong>der</strong> erotischen <strong>Frau</strong> gestaltet wird.<br />
An <strong>die</strong>ser Stelle sei an Adelheid in Goethes Götz von Berlichingen, Gräfin Orsina in
Lessings Emilia Galotti (1772), Marwood in Miss Sara Sampson (1755) <strong>und</strong> Lady<br />
Milford in Schillers Kabale <strong>und</strong> Liebe (1784) erinnert, <strong>die</strong> meist als Mätresse in <strong>der</strong><br />
bürgerlichen Ideologie auftreten <strong>und</strong> nicht zur Mutterschaft <strong>und</strong> zum selbstlosen,<br />
enthaltsamen <strong>und</strong> vor allem entsexualisierten Muttertyp geeignet sind.<br />
Bemerkenswert ist, dass in <strong>der</strong> Darstellung <strong>der</strong> idealen Muttergestalten bei<br />
Hauptmann <strong>die</strong> beson<strong>der</strong>e Körperlichkeit, <strong>die</strong> in den Bil<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Zeit <strong>der</strong> femme<br />
fatale zu beobachten ist, nicht in den Vor<strong>der</strong>gr<strong>und</strong> gerückt wird. Zu den Blonden, <strong>die</strong><br />
fast in allen Fällen das Schöne <strong>und</strong> das Dämonische verkörpern, steht im Gegensatz<br />
<strong>die</strong> mütterliche <strong>Frau</strong>, <strong>der</strong>en Haar meistens dunkel <strong>und</strong> schlicht ist. Oft wird in <strong>die</strong>sen<br />
herzensguten, idealisierten Muttergestalten Hauptmanns eine gewisse körperliche<br />
Schwäche sowie an<strong>der</strong>e Unzulänglichkeiten beobachtet wie bei <strong>Frau</strong> Vockerat <strong>und</strong><br />
<strong>Frau</strong> Flamm. <strong>Frau</strong> Flamm liegt bereits seit neun Jahren im Bett; hin <strong>und</strong> wie<strong>der</strong> wird<br />
sie im Rollstuhl umhergeführt. Das heftige Begehren ihres Mannes nach einer seiner<br />
vitalen Sinnlichkeit gemäßen <strong>Frau</strong> ist aus ihrer körperlichen Krankheit <strong>und</strong> dem<br />
Altersverhältnis zu ihrem Manne zu verstehen. Das stellt sich eindrücklich in <strong>der</strong><br />
Szene zwischen ihr <strong>und</strong> ihrem Mann heraus, nachdem ihr klar geworden ist, dass<br />
Flamm <strong>der</strong> Vater von Roses Kind ist: “Christel, was hab ich dir damals gesagt, da<br />
du rausgerickt kamst <strong>und</strong> du woll'st mich heiraten? [ ] Ich bin viel zu alt fer dich.<br />
A Weib kann sechzehn Jahre jinger sein, aber ni drei o<strong>der</strong> vier Jahre älter. Hätt'st du<br />
mir ock gefolgt dahier.” (CA II 239)<br />
<strong>Die</strong>se ideale, mütterliche <strong>Frau</strong> Flamm legt ihrer Gesinnung das traditionelle<br />
Weiblichkeitsideal zugr<strong>und</strong>e, <strong>und</strong> sie ordnet sich beson<strong>der</strong>s <strong>der</strong> patriarchalischen<br />
bürgerlichen Gesellschaftsordnung bedingungslos unter. Das zeigt sich beson<strong>der</strong>s<br />
ausdrucksvoll darin, dass sie ihrem lebenslustigen Manne nicht im Wege steht <strong>und</strong><br />
ihn nicht richtet, als sie von seinem Verhältnis zu Rose erfährt. Sie akzeptiert das<br />
Recht des Mannes auf freies Ausleben seiner <strong>Sexualität</strong>. Bei <strong>die</strong>ser <strong>Frau</strong> findet sich<br />
genügend passive Tapferkeit, <strong>die</strong> sie mit Unerschrockenheit ausharren <strong>und</strong> dulden<br />
läßt.<br />
Das Mütterliche <strong>der</strong> an den Rollstuhl gefesselten, gelähmten <strong>und</strong> dadurch<br />
entsexualisierten <strong>Frau</strong> Flamm stellt Hauptmann in starken Kontrast zu <strong>der</strong> naturhaften<br />
Sinnlichkeit Roses. <strong>Frau</strong> Flamm zeigt kaum noch einen erotischen Affekt <strong>und</strong> ihre<br />
Gattenliebe erfüllt sich vorrangig über <strong>die</strong> Mütterlichkeit. Ihrem Mann gegenüber<br />
fühlt sie sich als Mutter, <strong>und</strong> <strong>die</strong>ser nennt sie bezeichnen<strong>der</strong>weise auch Mutter.<br />
Angesichts solcher mütterlichen Haltung <strong>Frau</strong> Flamms dem Mann gegenüber, erinnern<br />
wir uns an Otto Weiningers Erklärung <strong>der</strong> klassischen Haltung <strong>der</strong> Mutter:<br />
<strong>Die</strong> Mutter fühlt sich dem Manne stets überlegen, sie weiß sich als seinen Anker; indes<br />
sie selbst in <strong>der</strong> geschlossenen Kette <strong>der</strong> Generationen wohl gesichert, gleichsam den<br />
Hafen vorstellt, aus dem jedes Schiff neu ausläuft, steuert <strong>der</strong> Mann weit draußen allein<br />
auf hoher See. 10)<br />
Wenn auch <strong>der</strong> weibliche Wirkungsbereich notwendig auf Haus <strong>und</strong> Familie<br />
eingeschränkt ist, erscheint jedoch <strong>die</strong> Stellung <strong>die</strong>ser mütterlichen <strong>Frau</strong> in <strong>der</strong><br />
Lebenspraxis keineswegs beschränkt, son<strong>der</strong>n umfassend <strong>und</strong> selbständig. Gemessen<br />
am idealen Muttertyp ist <strong>Frau</strong> Flamm weit stärker im praktischen Leben verankert als<br />
ihr Mann, <strong>der</strong> über seinem sinnlichen Genuss oft <strong>die</strong> Wirklichkeit vergisst. Sie soll<br />
sich um alles kümmern, was ihr Mann in leichtsinniger Unbedachtsamkeit - hier <strong>die</strong><br />
Schwangerschaft Roses - angestellt hat. Sie macht ihm jedoch keine Vorwürfe,<br />
son<strong>der</strong>n zeigt mütterliches Verständnis: “Ihr Männer seid wie de Kin<strong>der</strong> dahier ”<br />
(CA II 240)<br />
Aus ihrem mütterlichen Gefühl bemerkt <strong>Frau</strong> Flamm den Zustand Roses, ohne<br />
dass sie ein unmittelbares Geständnis erzwingt. Indem sie “eine große Puppe aus<br />
einem <strong>der</strong> Schübe”, mit <strong>der</strong> Rose als Kind gespielt hat, nimmt <strong>und</strong> <strong>die</strong> verstorbene<br />
<strong>Frau</strong> Bernd nennt: “Deine Mutter sagte amal zu mir: meine Rose, das wird ane<br />
Kin<strong>der</strong>mutter!” (CA II 211), erfährt sie Roses Geheimnis. <strong>Frau</strong> Flamm ist wirklich<br />
eine beeindruckende Muttergestalt Hauptmanns, <strong>die</strong> uns zugleich mit einem starken<br />
Muttergefühl konfrontiert. Ihr erscheint <strong>die</strong> Mutterschaft, <strong>die</strong> mit den tiefsten, größten<br />
10) O. Weininger, a.a.O., S. 293.
Schmerzen <strong>und</strong> Glück gesegnet ist, wichtig <strong>und</strong> steht über allem Glauben <strong>und</strong> über<br />
aller Moral: “Ich hab' ane eenzige Sache gelernt: neemlich was ane Mutter is hier uff<br />
<strong>der</strong> Erde <strong>und</strong> wie <strong>die</strong> mit Schmerzen gesegnet ist.” (CA II 212)<br />
Als Rose ein Kind erwartet, freut sie sich <strong>und</strong> fühlt sich mit ihr zusammen<br />
verantwortlich: “Du bist jetze ni mehr <strong>die</strong> <strong>und</strong> das Und da heeßt das getoppelt<br />
behutsam sein.” (CA II 212) Sie stellt sich ganz auf <strong>die</strong> Seite <strong>der</strong> jungen Mutter, für<br />
<strong>die</strong> <strong>die</strong> uneheliche Mutterschaft zur unerträglichen Qual wird. Indem <strong>Frau</strong> Flamm ihre<br />
Rolle als ‘wahre’ Mutter spielt, ermutigt sie Rose: “Nu, Mädel, 's is doch a Glick,<br />
was du hast! Fer a Weib gibt's kee greeßeres! Halt du's feste.” (CA II 213). Es ist<br />
ihr im Gr<strong>und</strong>e ganz “gleichgiltig”, wer <strong>der</strong> Vater des Kindes ist “ob's a Landrat o<strong>der</strong><br />
a Landstreicher is”. (CA II 212) Für sie scheint damit “<strong>der</strong> Hauptzweck des Lebens<br />
<strong>der</strong> Mutter” in <strong>der</strong> “Erreichung des Kindes” 11) zu bestehen. Sie ist auch ganz davon<br />
überzeugt, dass <strong>der</strong> <strong>Frau</strong> das Recht auf ein Kind von Natur aus zusteht. Während<br />
Flamm in Rose eine “Frovolke”, “<strong>die</strong> mit all'r Welt a Gestecke hat”(CA II 228) sieht<br />
<strong>und</strong> sich aus beleidigter Sinnlichkeit von dem Mädchen freimacht, versucht <strong>Frau</strong><br />
Flamm, obwohl sie am Ende des vierten Aktes alles weiß, über den eignen Schmerz<br />
hinaus Gutes zu tun. Hauptmann gewährt damit <strong>die</strong>ser hilfs- <strong>und</strong> opferbereiten,<br />
mütterlichen <strong>Frau</strong> gegenüber, <strong>der</strong>en Wesen das Ichbezogene fehlt, poetischen<br />
Beistand. Aus solcher Haltung heraus, <strong>die</strong> alles Selbstlose <strong>und</strong> Bescheidene betont,<br />
erklärt sich Hauptmanns beson<strong>der</strong>e Würdigung des Mütterlichen in je<strong>der</strong> <strong>Frau</strong>.<br />
Es ist von tiefer Symbolik, dass ausgerechnet <strong>die</strong>ser <strong>Frau</strong>, <strong>die</strong> aus tiefster Seele<br />
ein Kind begehrt, versagt ist, Mutter zu werden. Der Schmerz um das früh<br />
gestorbene Kind <strong>und</strong> <strong>die</strong> langjährige Lähmung, <strong>die</strong> scheinbar das weitere<br />
Mutterwerden verhin<strong>der</strong>t, for<strong>der</strong>ten von <strong>die</strong>ser <strong>Frau</strong> immer wie<strong>der</strong> in stiller Not<br />
Hingabe <strong>und</strong> Selbstbeherrschung. <strong>Die</strong> in Leid <strong>und</strong> Geduld herangereifte <strong>Frau</strong> Flamm<br />
vermag während des Stückes bei allem Kummer <strong>die</strong> mütterlichen Wesenzüge zu<br />
behaupten. Es vertieft sich zugleich ihr Verständnis für <strong>die</strong> menschliche Natur. Damit<br />
11) Ebd., S. 287.<br />
steht <strong>die</strong>se so warmherzig gezeichnete Muttergestalt Hauptmanns nicht allein als<br />
Sinnbild weiblicher Bescheidenheit <strong>und</strong> Selbstaufopferung da, son<strong>der</strong>n ist darüber<br />
hinaus auch eine Repräsentantin des praktischen Sinns <strong>und</strong> des ges<strong>und</strong>en<br />
Menschenverstandes.<br />
Indem <strong>Frau</strong> Flamm “Kin<strong>der</strong> <strong>und</strong> Gräber” zu “Weibersachen” (CA II 212) erklärt,<br />
betont sie <strong>die</strong> Bedeutung <strong>der</strong> Mutterschaft, <strong>die</strong> auf <strong>der</strong> Akzeptanz ihres Geschlechts<br />
<strong>und</strong> dem festen Rollenmuster einer <strong>Frau</strong> basiert. Ihre Haltung macht anschaulich, wie<br />
sehr in ihr <strong>die</strong> Wert- <strong>und</strong> Normvorstellungen sowie das Handlungsmuster <strong>der</strong><br />
bürgerlichen Gesellschaft verinnerlicht ist. Sie kennt eigentlich keinen Drang nach<br />
Geltung <strong>und</strong> Betätigung außerhalb des beschränkten Kreises, <strong>der</strong> <strong>der</strong> <strong>Frau</strong> als Mutter<br />
<strong>und</strong> Gattin zufällt, son<strong>der</strong>n sie nimmt selbst inbrünstig ihre Stellung als etwas<br />
Selbstverständliches, von Natur aus Gegebenes hin. Für sie steht daher <strong>die</strong> Mutter für<br />
das Höchste des <strong>Frau</strong>enschicksals <strong>und</strong> ist wichtiger als <strong>die</strong> eigene Persönlichkeit.<br />
Hauptmanns Mutterbild bleibt ganz in dem traditionellen <strong>Frau</strong>enideal befangen, das<br />
schon Wilhelm Heinrich Riehl in <strong>Die</strong> Naturgeschichte des Volkes als Gr<strong>und</strong>lage<br />
einer deutschen Socialpolitik (1855) vertreten hat. In seinem vielgelesenen Buch hält<br />
Riehl das Idealbild <strong>der</strong> <strong>Frau</strong> des 18. Jahrhun<strong>der</strong>ts fest. Er ist <strong>der</strong> Ansicht, dass <strong>der</strong><br />
natürliche Beruf <strong>der</strong> <strong>Frau</strong>en gerade dem Erhalten <strong>und</strong> Pflegen <strong>der</strong> überlieferten Sitte<br />
sowie <strong>der</strong> Bewahrung des Hauses <strong>die</strong>nt <strong>und</strong> dass sich in den <strong>Frau</strong>en noch am meisten<br />
Hingabe an den Gatten <strong>und</strong> an <strong>die</strong> Familie, gepaart mit Unschuld, Herzensreinheit<br />
<strong>und</strong> Gemüt findet: “<strong>Frau</strong>, das war das treu beharrende, in <strong>der</strong> Selbstbeschränkung<br />
große, in <strong>der</strong> Zucht <strong>der</strong> Sitte gefestigte Wesen, das Idealbild des an<strong>der</strong>en<br />
Geschlechts.” 12)<br />
In dem Punkt unterscheiden <strong>die</strong> mütterlichen Gestalten Hauptmanns sich kaum<br />
voneinan<strong>der</strong>. <strong>Die</strong> Überzeugung, dass <strong>die</strong> <strong>Frau</strong> ihrer natürlichen Bestimmung nach für<br />
den Mutterberuf <strong>und</strong> somit für das Leben des an<strong>der</strong>en bestimmt sei, ist für <strong>die</strong>se<br />
Gruppe charakteristisch. Höchste Tugenden sind ihnen Bescheidenheit bei sich selbst,<br />
12) Wilhelm H. Riehl, <strong>Die</strong> Naturgeschichte des Volkes als Gr<strong>und</strong>lage einer deutschen<br />
Socialpolitik, Stuttgart u. Augsburg 1855, 3. Bd.: <strong>Die</strong> Familie, S. 24f.
Hilfsbereitschaft <strong>und</strong> Großherzigkeit gegenüber an<strong>der</strong>en, also wahre christliche<br />
Nächstenliebe. Sie sind immer bereit, Lasten auf sich zu nehmen <strong>und</strong> zugleich<br />
fremdes Leid zu teilen. Dadurch stehen sie nicht nur in ihrer Familie, son<strong>der</strong>n auch<br />
in ihrer Umgebung als gutmütige, warmherzige, einfühlsame Wesen da <strong>und</strong> sollen<br />
dadurch Vorbildfunktion gewinnen.<br />
<strong>Die</strong> gütige, helfende Hand <strong>Frau</strong> Flamms kann allerdings Rose nicht retten.<br />
Angesichts des unehelichen Mutterschaftsproblems, das durch <strong>die</strong> Form <strong>der</strong><br />
patriarchalischen Familienordnung sowie <strong>die</strong> männlich orientierte Gesellschaftsnorm<br />
an Brisanz gewinnt, vermag sie nicht, Roses Kindesmord zu verhin<strong>der</strong>n. <strong>Die</strong>se<br />
tragische ‘Lösung’ wird nicht zuletzt dadurch erzwungen, dass Rose sich völlig<br />
isoliert fühlt. Selbst ihre ‘mütterliche’ Fre<strong>und</strong>in <strong>Frau</strong> Flamm ist im Gr<strong>und</strong>e eine<br />
Verkörperung eines weiblich-ethischen Ideals <strong>der</strong> patriarchalischen Gesellschaft.<br />
Es ist auch bemerkenswert, dass Hauptmann mit <strong>die</strong>sem Symbol reiner<br />
Mütterlichkeit zugleich ohne große dramatische Auseinan<strong>der</strong>setzung eine<br />
Gegenposition zu einer Welt schafft, in <strong>der</strong> <strong>die</strong> uneheliche Mutterschaft verachtet<br />
wird. Dadurch, dass <strong>Frau</strong> Flamm zu Ende des zweiten Aktes zu <strong>der</strong> werdenden<br />
Mutter Rose über das größte, tiefste Mutterglück sowie <strong>die</strong> gesegnete Mutterschaft<br />
spricht: “Nu, Mädel, 's is doch a Glick, was du hast! Fer a Weib gibt's kee<br />
greeßeres! Halt du's fest.” (CA II 213), legt Hauptmann sein Bekenntnis zu <strong>der</strong><br />
absoluten Überlegenheit des Muttertums über <strong>die</strong> religiöse <strong>und</strong> ethische Gr<strong>und</strong>haltung<br />
<strong>der</strong> bürgerlichen Welt ab.<br />
<strong>Die</strong> bisher vorgestellten mütterlichen <strong>Frau</strong>en sind Idealtypen. In ihrer<br />
Seelenhaltung lebt ein Ebenbild Rousseau'schen <strong>Frau</strong>enideals, ein Inbegriff <strong>der</strong><br />
Weiblichkeit, wie es sich durch Jahrhun<strong>der</strong>te hindurch gebildet <strong>und</strong> das im<br />
Muttertypus seine ideale Verwirklichung gef<strong>und</strong>en hat. <strong>Die</strong>sen <strong>Frau</strong>en ist eine tiefe<br />
Verb<strong>und</strong>enheit mit <strong>der</strong> Familie <strong>und</strong> dem Haus eigen <strong>und</strong> ihr Wesen ist geprägt von<br />
den überlieferten Vorstellungen ihres Standes. Zwar erscheinen sie äußerlich als<br />
schwache Personen im Sozialgefüge <strong>der</strong> männlich dominierten Hierarchie, aber ihre<br />
Stärke entwickeln sie über ihre großen ‘<strong>weiblichen</strong>’ Tugenden. Da sind sie selbst -<br />
wie <strong>Frau</strong> Flamm demonstriert - den Männern überlegen, wenn es um den kleinen<br />
Sozialverband <strong>der</strong> Familie geht. Statt auf Macht <strong>und</strong> Herrschaft setzen sie auf<br />
Zuneigung, Solidarität <strong>und</strong> Verständnis. Aber - <strong>und</strong> das macht ihre Tragik in den<br />
Hauptmannschen Dramen aus - retten können sie damit <strong>die</strong> Familiengemeinschaft<br />
nicht mehr.<br />
.<br />
Beson<strong>der</strong>s in den drei Muttergestalten seiner naturalistischen Werke - <strong>Frau</strong><br />
Buchner, <strong>Frau</strong> Vockerat <strong>und</strong> <strong>Frau</strong> Flamm - bestätigt Hauptmann das Wesen des<br />
traditionellen Weiblichkeitsideals: <strong>Die</strong> selbstlose Mutter harrt treu aus, duldet still <strong>und</strong><br />
widmet sich voller Liebe <strong>der</strong> Familie. Von <strong>der</strong> geistigen Welt <strong>der</strong> Männer ganz<br />
entfremdet, sind <strong>die</strong> Mütter ausnahmslos in den Rahmen <strong>der</strong> Familie eingeb<strong>und</strong>en,<br />
<strong>und</strong> ihr Aufgabenbereich <strong>und</strong> Wirkungsfeld werden, ebenso wie ihre<br />
geistig-seelischen Funktionen, von hier aus bestimmt. Bei <strong>die</strong>sen Müttern, <strong>die</strong> mehr<br />
für <strong>die</strong> an<strong>der</strong>n als für sich selbst leben <strong>und</strong> über wenig Individualität verfügen, findet<br />
sich vorrangig eine passive Tapferkeit, <strong>die</strong> das Handeln allein auf <strong>die</strong> Familie<br />
beschränkt.<br />
<strong>Die</strong> Lebensanschauung einer solchen Mutter ist so stark durch das überkommene<br />
Rollenmuster geprägt, <strong>und</strong> für sie bedeutet das Muttersein das <strong>Frau</strong>enideal. Das<br />
Mütterliche ist wichtiger als <strong>die</strong> Ausformung einer eigenen Persönlichkeit. <strong>Die</strong>ser<br />
Muttertypus ordnet sich <strong>der</strong> bestehenden Gesellschaftsordnung bedingungslos unter<br />
<strong>und</strong> erscheint selbst als eine Verkörperung des lebendig gewordenen,<br />
weiblich-ethischen Ideals <strong>der</strong> patriarchalischen Gesellschaft. In ihrer Bescheidenheit<br />
stellt sie sich als kleines, einfältiges Wesen dar, das sich in <strong>der</strong> beschränkten Denkart<br />
<strong>der</strong> allgemeinen <strong>Frau</strong>enwelt auslebt. Trotz all ihrer aufrichtigen Bemühungen ist sie<br />
damit nicht den wirklichen Lebensproblemen gewachsen.<br />
<strong>Die</strong>se idealisierten Muttergestalten, <strong>die</strong> durch absolute Enthaltsamkeit <strong>und</strong>
Selbstlosigkeit als Gegenmodell zur erotischen <strong>Frau</strong> gestaltet sind, werden meist ohne<br />
wahrnehmbare Körperlichkeit dargestellt <strong>und</strong> erweisen sich damit als entsexualisierte<br />
<strong>Frau</strong>en. Während <strong>die</strong> robuste, sinnliche <strong>Frau</strong>, wie es noch in <strong>Frau</strong> Krause, Lene Thiel<br />
<strong>und</strong> Hanne Schäl - beson<strong>der</strong>s in <strong>der</strong> aus den unteren sozialen Schichten kommenden<br />
<strong>Frau</strong> - veranschaulicht wird, meistens durch <strong>die</strong> üppige, kräftige Glie<strong>der</strong>fülle wirkt,<br />
wird <strong>die</strong> mütterliche, ideale <strong>Frau</strong> durch ovale Gesichtszüge, dunkles Haar, weiße<br />
Hautfarbe - also mit den gleichen physiognomischen Zügen von Hauptmanns eigener<br />
Mutter <strong>und</strong> seiner ersten <strong>Frau</strong> Marie - <strong>und</strong> oft kränklich aussehende Gesichtszüge<br />
gekennzeichnet.<br />
In seinen naturalistischen Muttergestalten geht eine hohe Wertung <strong>der</strong> Mutterschaft<br />
<strong>und</strong> zugleich eine Tendenz zur <strong>Idealisierung</strong> <strong>der</strong> <strong>Frau</strong> einher, zu <strong>der</strong> sich <strong>die</strong><br />
<strong>Negation</strong> <strong>der</strong> <strong>weiblichen</strong> Sinnlichkeit gesellt, also eine an<strong>der</strong>e, subtilere Form <strong>der</strong><br />
Unterdrückung <strong>der</strong> <strong>weiblichen</strong> <strong>Sexualität</strong>. Wo <strong>die</strong> <strong>Frau</strong> aber ihre natürliche<br />
Bestimmung als Mutter verfehlt hat, ist <strong>die</strong> weibliche Körperlichkeit <strong>und</strong> <strong>Sexualität</strong><br />
präsent <strong>und</strong> es tritt meist eine Katastrophe ein, wie z.B. bei <strong>Frau</strong> Krause zu sehen ist.<br />
Gerhart Hauptmann Sämtliche Werke, Hg. v. Hans Egon Hass, fortgeführt v. M.<br />
Machatzke u. W. Bungies (ab Bd. 10), 11 Bde., Frankfurt/M, Berlin, (Wien):<br />
Propyläen 1962. (Centanar-Ausgabe zum 100. Geburtstag des Dichters, 15. Nov.<br />
1962)<br />
Gerhart Hauptmann Tagebuch 1892 bis 1894, Hg. v. M. Machatzke, Frankfurt a. M.,<br />
Berlin, Wien: Propyläen 1985.<br />
Gerhart Hauptmann Tagebücher 1897-1905, Hg. v. M. Machatzke. Frankfurt/M, Berlin,<br />
Wien: Propyläen 1987.<br />
Guthke, Karl S./Wolff, Hans M., Das Leid im Werke Gerhart Hauptmanns, Bern 1958.<br />
Horkheimer, Max/Fromm, Erich/Marcuse, Herbert: Stu<strong>die</strong>n über Autorität <strong>und</strong> Familie.<br />
Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialforschung, Paris 1936.<br />
Riehl, Wilhelm H., <strong>Die</strong> Naturgeschichte des Volkes als Gr<strong>und</strong>lage einer deutschen<br />
Socialpolitik, Stuttgart u. Augsburg 1855, 3. Bd.: <strong>Die</strong> Familie.<br />
Scheuer, Helmut, Gerhart Hauptmanns Das Friedensfest. Zum Familiendrama im<br />
deutschen Naturalismus, in: R. Leroy/E. Pastor (Hg.): Deutsche Dichtung um<br />
1890, Bern u.a. 1991, S. 399-416.<br />
Weininger, Otto, Geschlecht <strong>und</strong> Charakter, Eine prinzipielle Untersuchung, München:<br />
Matthes & Seitz 1980.
이상적 여성상과 거부된 여성의 성<br />
게르하르트 하우프트만의 자연주의 작품을 접해보면 거의 모든 작품에서 여<br />
성인물의 성격과 문제점 그리고 그들의 비극적 운명이 주로 다루어지고 있음을<br />
볼 수 있다. 여성 인물의 성격묘사 내지는 내면의 갈등과 고통을 영혼의 작은 동<br />
요까지도 있는 그대로 그려내는 데에서 하우프트만의 작가적 재능과 사회적 문<br />
제의식이 잘 드러나고 있다. 우리의 관심을 끄는 것은 하우프트만이 창작활동<br />
초기뿐만 아니라 후기의 작품들에서도 전통적인 여성상을 이상적인 어머니상으<br />
로 부각시키고 있다는 점이다. 사회적인 문제나 시대비판적인 내용을 주로 담고<br />
있는 대표적인 자연주의 드라마