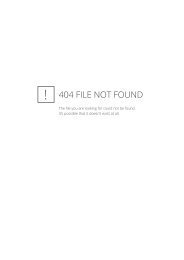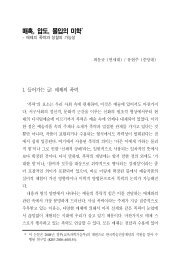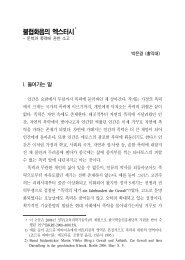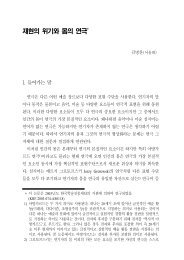Marlene Streeruwitz Gegen den Raub der Erinnerung und f r eine ...
Marlene Streeruwitz Gegen den Raub der Erinnerung und f r eine ...
Marlene Streeruwitz Gegen den Raub der Erinnerung und f r eine ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Streeruwitz</strong> oft gerückt wird. In <strong>eine</strong>m langen, kürzlich publizierten Interview äußert<br />
sich Jelinek über ihr eigenes Bedürfnis, das obszöne, das gewalttätige,<br />
“pornographische” Element, das die Gesellschaft durchdringt, zu entlarven. Sie<br />
bedient sich zu diesem Zweck <strong>eine</strong>r oft gefährlichen Waffe (gefährlich, weil sie leicht<br />
missverstan<strong>den</strong> wer<strong>den</strong> kann): sie setzt das Pornographische ein, um das<br />
Pornographische zu demaskieren. 2) Der Jelineksche “Anti-Porno”, <strong>der</strong> in <strong>der</strong><br />
Verwendung <strong>eine</strong>r “pornographischen” Sprache, dem Hervorbringen von immer<br />
wie<strong>der</strong> kehren<strong>den</strong> Gewaltsituationen besteht, verfolgt mehrere Ziele, im wesentlichen<br />
aber jenes, Gewalt in drei Gr<strong>und</strong>formen zu demaskieren: die Gewalt, die hinter<br />
politischen Einstellungen <strong>und</strong> Machtausübung verborgen ist o<strong>der</strong> ganz offensichtlich<br />
zutage tritt, die Gewalt zwischen <strong>den</strong> Geschlechtern <strong>und</strong> jene Gewalt, die <strong>der</strong><br />
‘Verdrängung <strong>der</strong> Gewalt’ inhärent ist.<br />
Genau dieses obszöne Element interessiert auch <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>. Sie geht von<br />
<strong>eine</strong>r Art “Urszene” aus, in <strong>der</strong> jener unbegreifliche Menschenhass <strong>und</strong> die<br />
organisierte Vernichtung angesiedelt sind, die <strong>den</strong> Holocaust definieren, <strong>und</strong> sie sieht<br />
hinter <strong>der</strong> Gewalt auch das Obszöne an sich: die Obszönität, die Menschen dazu<br />
bringt, an<strong>der</strong>e Menschen zu demütigen <strong>und</strong> schließlich zu ermor<strong>den</strong>. Sie beobachtet<br />
die Obszönität <strong>der</strong> Macht: das Machtgefühl, über Leben <strong>und</strong> Tod von an<strong>der</strong>en<br />
Menschen entschei<strong>den</strong> zu dürfen, freie Hand zu haben. Das Obszöne, das die<br />
Menschheit in sich trägt. Elfriede Jelinek beschreibt diese “Urszene” im oben<br />
zitierten Interview wie folgt:<br />
L’écrivain <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong> a vu elle aussi ce genre de films un peu plus tard, dans<br />
le cadre de l’école. Elle raconte que c’est l’obscénité de ces images qui l’avait surtout<br />
frappée à l’époque. L’avilissement de tous ces corps massés les uns sur les autres, ces<br />
femmes avec les jambes écartées. Elle avait ressenti ça comme obscène et elle avait<br />
raison. 3)<br />
2) Vgl. Elfriede Jelinek/Christine Lecerf, L’entretien, Paris: Seuil 2007; Vgl. auch u.a. Jelinek<br />
über ihren Roman Lust im Interview mit Sigrid Löffler in: Profil, Nr. 13 (1989).<br />
3) “Die Schriftstellerin <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>, auch sie, hat diese Art von Filmen gesehen, ein
Es geht bei <strong>Streeruwitz</strong> darum, wie die Literaturkritikerin Nele Hempel am<br />
Beispiel des Romans Nachwelt sehr überzeugend zeigt, 4) <strong>den</strong> Konflikt zwischen<br />
Kriegs- <strong>und</strong> Nachkriegsgeneration zu diagnostizieren, die Gründe für das Schweigen<br />
<strong>und</strong> die Verdrängung des Geschehenen zu untersuchen, die eigentlich zur<br />
“Weitergabe” des Problems an die nächste Generation <strong>Streeruwitz</strong>’ Generation<br />
geführt haben. Es geht also auch um diese an<strong>der</strong>e “Urszene”, in <strong>der</strong> die Fragen <strong>der</strong><br />
Nachgeborenen an die “Tätergeneration” mit aggressiven <strong>Gegen</strong>fragen beantwortet<br />
wer<strong>den</strong> (“Was hättest du <strong>den</strong>n getan?”) <strong>und</strong> in <strong>der</strong> die “Doppelmoral in <strong>der</strong><br />
Öffentlichkeit”, 5) wie <strong>Streeruwitz</strong> in ihrem Essayband Tagebuch <strong>der</strong> <strong>Gegen</strong>wart<br />
schreibt, begründet ist. In dieser zweiten, im Schoß <strong>der</strong> Familie6) <strong>und</strong> <strong>der</strong> eigenen<br />
Gesellschaft stattfin<strong>den</strong><strong>den</strong> Urszene die auf die erste gewalttätige Urszene, in <strong>der</strong><br />
Denunzianten, Kollaborateure, ‘Nicht-Wisser’ agieren <strong>und</strong> die zur Vernichtung, zur<br />
Shoah führte, folgte wird die jüngere Generation mit sich selbst <strong>und</strong> mit ihren<br />
Fragen allein gelassen. 7) Mit <strong>der</strong> gr<strong>und</strong>legen<strong>den</strong>, unbeantworteten Frage: Wie konnte<br />
wenig später, in <strong>der</strong> Schule. Sie erzählt, dass sie damals vor allem die Obszönität dieser<br />
Bil<strong>der</strong>n betroffen machte. Das Entwürdigende all dieser aufeinan<strong>der</strong> geschlichteten Leiber,<br />
<strong>der</strong> Frauen mit <strong>den</strong> geöffneten B<strong>eine</strong>n. Sie hatte all das als obszön empfun<strong>den</strong>, <strong>und</strong> sie hatte<br />
recht.” Elfriede Jelinek/Christine Lecerf, a.a.O., S. 28. [Übersetzung des Zitats ins Deutsche<br />
von B. A.]<br />
4) Siehe dazu Nele Hemperl: Die Vergangenheit als <strong>Gegen</strong>wart als Zukunft. Über <strong>Erinnerung</strong><br />
<strong>und</strong> Vergangenheitsbewältigung in Texten von <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>, a.a.O.; Nicht zufällig<br />
definiert <strong>der</strong> Romantitel die Welt <strong>der</strong> “nachgeborenen” Protagonistin Margarethe als<br />
“Nachwelt”. Margarethe verfolgt außerdem das Projekt, die Biographie von Anna Mahler,<br />
<strong>der</strong> Tochter von Alma Mahler-Werfel <strong>und</strong> Gustav Mahler, zu schreiben, die 1939 nach<br />
London flüchten musste <strong>und</strong> nach dem Krieg u.a. in Kalifornien <strong>und</strong> Spoleto lebte.<br />
5) M. <strong>Streeruwitz</strong>, Tagebuch <strong>der</strong> <strong>Gegen</strong>wart, Wien/Köln/Weimar 2002, S. 41.<br />
6) “In <strong>der</strong> Familie [ ] herrscht ja Reflexionsstopp <strong>und</strong> Denkverbot”, so M. <strong>Streeruwitz</strong>, die oft<br />
in politischen, sozialen <strong>und</strong> kulturellen Fragen ihre Meinung äußert, in ihrem Artikel:<br />
“Vater. Land”, basierend auf <strong>eine</strong>m Vortrag, <strong>den</strong> sie im Rahmen <strong>der</strong> “Erich Fried Lectures”<br />
im Wiener Literaturhaus hielt. In: Die Presse, Samstag 21. April 2007 (Spectrum, S. IV).<br />
7) Vgl. M. <strong>Streeruwitz</strong>, Waikiki-Beach. Und an<strong>der</strong>e Orte. Die Theaterstücke. Frankfurt a. M.<br />
1999, S. 53: Im Stück New York. New York kommt zum Beispiel folgen<strong>der</strong> Dialog vor:<br />
SELLNER [30 Jahre alt]: Mein Gott. Ich m<strong>eine</strong>. Ich frage ja nur. Ich frage alle. Ich habe<br />
<strong>den</strong> Krieg ja nicht mitgemacht. (Pause). / HORVATH: Das hat ja niemand. Das macht sich<br />
von selbst. (Pause); Siehe auch Nachwelt, S. 170; Vgl. Dazu Hempel, Die Vergangenheit als
das geschehen? Mit Schuldgefühlen, die man nicht haben will <strong>und</strong> <strong>den</strong>en man sich<br />
auch nicht entziehen kann, weil die “alte” Generation die Schuld nicht auf sich<br />
nimmt, k<strong>eine</strong> Verantwortung übernimmt, sie nicht bearbeitet <strong>und</strong> statt dessen <strong>den</strong><br />
Nachfolgen<strong>den</strong> auf die Schultern lädt. Allein gelassen also mit <strong>der</strong> einzigen<br />
Erkenntnis, dass man Glück gehabt hat, “danach” geboren zu sein; in an<strong>der</strong>en<br />
Worten, die Nachgeborenen sollen sich mit <strong>der</strong> ‘Gnade <strong>der</strong> späten Geburt’ begnügen.<br />
<strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong> arbeitet im Heute, <strong>und</strong> im Mikrokosmos des Ich, <strong>der</strong><br />
“persönlichen”, man könnte fast sagen “inwendigen” Geschichten. Ihre Analyse<br />
betrifft nicht nur die Gewalt <strong>und</strong> die Mechanismen <strong>der</strong> Macht im Allgem<strong>eine</strong>n,<br />
“Kirche, Politik, Geschichte, Literatur” <strong>und</strong> “grand récit”, (Braudels “große<br />
Erzählung”), 8) wie Jelinek eingehend beschreibt:<br />
Gewalt fährt auf die Figuren nie<strong>der</strong>, <strong>und</strong> die Gewalt ist immer einfach, auch wenn sie<br />
vielfältig auftritt. [ ] Es gibt verschie<strong>den</strong>e Möglichkeiten, Orangenmarmelade zu machen,<br />
aber es gibt nur <strong>eine</strong> Möglichkeit, Macht, diese holzige, sperrholzige, auszuüben, wie<br />
zeigt man das? Indem man zeigt, daß die Macht alles kaputtmacht <strong>und</strong> sich immer nur<br />
selbst an dessen Stelle setzt. [ ] Alles, was geschieht, auf <strong>der</strong> Bühne, im Leben, ist<br />
daher von Anfang an schon gezeichnet von diesem <strong>eine</strong>n, das nichts ist, weil es<br />
Zerstörung ist, <strong>der</strong>en Ziel wie<strong>der</strong>um das Nichts ist. [ ] Und diese Unbeschreibbarkeit<br />
dessen, dem wir alle unterliegen, macht ihre Stücke gleichermaßen konkret wie<br />
vollkommen rätselhaft. 9)<br />
<strong>Streeruwitz</strong> fokussiert zum Beispiel auf die Ausbeutung <strong>und</strong> die Unterdrückung,<br />
<strong>Gegen</strong>wart als Zukunft. Über <strong>Erinnerung</strong> <strong>und</strong> Vergangenheitsbewältigung in Texten von<br />
<strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>, a.a.O., S. 52-53.<br />
8) Stehle Maria/Harenberg Sabine, “Das Schreiben ist für mich <strong>eine</strong> Art Anti-<br />
Verdrängungsstrategie”. Themen <strong>und</strong> Formen in <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>' Theaterstücken <strong>und</strong><br />
Prosawerk, in: L. Nagelschmidt [u.a.] (Hg.), Zwischen Trivialität <strong>und</strong> Postmo<strong>der</strong>ne. Literatur<br />
von Frauen in <strong>den</strong> 90er Jahren, Frankfurt a. M. 2002, S. 207-222, hier S. 214.<br />
9) Elfriede Jelinek, Die Macht <strong>und</strong> ihre Preisliste (zu <strong>den</strong> Theaterstücken <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>’),<br />
in: M. <strong>Streeruwitz</strong>, Waikiki-Beach. Und an<strong>der</strong>e Orte. Die Theaterstücke. Frankfurt a. M.<br />
1999, S. VII-XVI, hier VII, IX, X, XI.
o<strong>der</strong> auf die Macht <strong>der</strong> Männer über die Frauen; 10) sie geht aber auch <strong>eine</strong>n Schritt<br />
weiter <strong>und</strong> zeigt “Macht- <strong>und</strong> Konkurrenzmuster <strong>der</strong> Frauen untereinan<strong>der</strong>” 11) <strong>und</strong> die<br />
subtile Gewalt <strong>der</strong> Machtinstanz, die Frauenbil<strong>der</strong> in <strong>eine</strong>r Gesellschaft schaffen. Wie<br />
Kramatschek in ihrem Artikel über <strong>Streeruwitz</strong>' weibliche Ästhetik ex negativo<br />
anhand von Beispielen aus ihrem Prosawerk zeigt, geht es bei <strong>der</strong> Autorin oft darum,<br />
das als feministischen Fortschritt getarnte Rollenmodell “Kin<strong>der</strong>, Karriere, Küche” zu<br />
demaskieren. Die weiblichen Ideale zu sezieren, die darauf hinauslaufen, <strong>eine</strong><br />
wun<strong>der</strong>bare Ehefrau <strong>und</strong> Mutter <strong>und</strong> zugleich <strong>eine</strong> erfolgreiche Karrierefrau zu sein,<br />
<strong>eine</strong> perfekt funktionierende Maschine “‘Obszön’. Helene sah sich bitter zu, wie sie<br />
funktionierte” 12) schreibt <strong>Streeruwitz</strong> in ihrem Roman Verführungen, <strong>den</strong> sie 1996<br />
publizierte nachdem sie sich allmählich vom Theater abgewandt hatte. 13) Diese<br />
beson<strong>der</strong>e Art <strong>der</strong> Obszönität steht in direkter Verbindung mit <strong>der</strong> Konstatierung<br />
<strong>eine</strong>r Selbsttäuschung: Das Bild, das Frauen von sich akzeptieren, erleben <strong>und</strong><br />
weitergeben, ist selbstverständlich kein selbst-geschaffenes, son<strong>der</strong>n ein ererbtes, auch<br />
aus dem Feminismus ererbtes, selbsttäuschendes Bild, das als obszön empfun<strong>den</strong><br />
wird, sobald <strong>der</strong> weibliche Anteil an dieser Täuschung auch nur bruchstückweise zu<br />
tage kommt.<br />
Anhand <strong>der</strong> Analyse von zwei Theaterstücken Tolmezzo (1994) <strong>und</strong> Sloane<br />
10) Vgl. dazu Alexandra Kedveš, über <strong>Streeruwitz</strong>’ Romane: “Geheimnisvoll. Vorwurfsvoll.<br />
Aber Zusammenhängend”. <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>’ Romane, Frauengeschichten, Männersprache,<br />
in: Text + Kritik, a.a.O., S. 19-36.<br />
11) Vgl. dazu Claudia Kramatschek, Zeigt her eure Wun<strong>den</strong>! O<strong>der</strong>: Schnitte statt Kosmetik.<br />
Vorentwurf zu <strong>eine</strong>r (weiblichen) Ästhetik zwischen Alltagsrealismus <strong>und</strong> ‘trivial pursuit of<br />
happiness’, in: Text + Kritik, a.a.O., S. 38.<br />
12) M. <strong>Streeruwitz</strong>, Verführungen. 3. Folge. Frauenjahre. Frankfurt a. M. 1996, S. 205.<br />
13) Wie sie selbst in <strong>eine</strong>m mit dem Titel “Eine Kritikbiographie” versehenen Artikel pointiert<br />
sagt, hat <strong>Streeruwitz</strong> von <strong>den</strong> Theaterstücken überwiegend zur Prosa übergewechselt: “Das<br />
war 1993. Und das mit dem Theater. Das war schon zu Ende [ ] Die Schwierigkeiten <strong>der</strong><br />
Vermittlung m<strong>eine</strong>r Theatertexte war an <strong>den</strong> neuen Aufführungen nachgewiesen. Ich wollte<br />
mit dem Leser <strong>und</strong> <strong>der</strong> Leserin selbst verhandeln. Ich kehre zur Prosa zurück”. <strong>Marlene</strong><br />
<strong>Streeruwitz</strong>: Text & Kritik. Eine Kritikbiographie. Bis 1993, in: Text + Kritik, S. 3-10, hier<br />
S. 10.
Square (1992) werde ich versuchen, <strong>eine</strong>rseits <strong>Streeruwitz</strong>’ Welt <strong>der</strong><br />
Nachgeborenen <strong>und</strong> an<strong>der</strong>erseits das Verhältnis zwischen “persönlichen”,<br />
uneingestan<strong>den</strong>en Geschichten (Frauengeschichten) <strong>und</strong> <strong>der</strong> Darstellbarkeit <strong>der</strong>selben<br />
zu untersuchen.<br />
Tolmezzo, Sloane Square: Die Beziehung zwischen <strong>der</strong> Geschichte <strong>und</strong> dem<br />
suggerierten Rahmen bzw. Ort <strong>der</strong> Handlung, die “Inkongruenz von Titel <strong>und</strong> Inhalt”<br />
wie es Hempel definiert, 14) stellt schon für sich die erste Verfremdung dar, mit <strong>der</strong><br />
das Publikum o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Leser bei <strong>Streeruwitz</strong> konfrontiert wird.<br />
<strong>Streeruwitz</strong>’ Theaterstücke tragen oft “exotische” Titel: New York. New York;<br />
Waikiki Beach; Sloane Square; Ocean Drive; Elysian Park; Tolmezzo; Troyes;<br />
Sapporo. Das Erleben <strong>eine</strong>s “exotischen” Orts wird jedoch verweigert, jede mögliche<br />
Zuschauererwartung wird enttäuscht. Die Inhalte sind fast immer vom Titel<br />
vollkommen losgelöst:<br />
Schon mit <strong>den</strong> Titeln ihrer Theaterstücken hat <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong> ihr Publikum<br />
absichtlich in die Irre geführt, indem sie spektakuläre Handlungsorte suggerierte, die<br />
Stücke aber dann an ganz an<strong>der</strong>en Schauplätzen spielen ließ man <strong>den</strong>ke zum Beispiel<br />
an New York New York, wo die Zuschauer sich tatsächlich in <strong>eine</strong>r öffentlichen k. <strong>und</strong><br />
k. Piss- <strong>und</strong> Bedürfnisanstalt in Wien wie<strong>der</strong> fan<strong>den</strong>. 15)<br />
Tolme zo (1994)<br />
Die Gemeinde von Tolmezzo, <strong>eine</strong>r italienischen Kleinstadt unweit <strong>der</strong><br />
österreichischen Grenze im Gebiet <strong>der</strong> Karnischen Alpen, hat die Existenz des<br />
Stückes mit Freude wahrgenommen <strong>und</strong> die Tatsache, dass k<strong>eine</strong> Verbindung<br />
zwischen <strong>der</strong> Stadt <strong>und</strong> dem Stück besteht, ansch<strong>eine</strong>nd akzeptiert. 16)<br />
14) N. Hempel, Die Vergangenheit als <strong>Gegen</strong>wart als Zukunft, a.a.O., S. 55.<br />
15) Ebda.<br />
16) Vgl. www.comune.tolmezzo.ud.it
Der eigentliche Ort <strong>der</strong> Handlung ist in diesem Stück eindeutig Wien,<br />
architektonische Signale lassen es erkennen: ein kl<strong>eine</strong>r Platz, auf dem ein Gebäude<br />
aus <strong>der</strong> Grün<strong>der</strong>zeit zu sehen ist, in dem sich ein Kaffeehaus befindet. “Im<br />
Kaffeehaus Säulen. Bemalt. Anklang an das historische Café Central.” 17)<br />
Manon Greeff <strong>und</strong> ihre amerikanische Tochter mit amerikanischem Namen Linda<br />
sind in Wien. Zum ersten Mal seit “damals”, als die Mutter vertrieben wurde.<br />
Einige Figuren kommen dazu, die das Wien des “danach” umreißen sollen, wie<br />
zum Beispiel Prof. Krobath, <strong>der</strong> sich als aktiv tätig “Im Rahmen des Untergangs<br />
dieser Kultur” erklärt (in New York. New York beklagte <strong>eine</strong> ähnliche<br />
Professorenfigur Namens Chrobath <strong>den</strong> Zerfall des Abendlandes) 18) o<strong>der</strong> Herr<br />
Lambert, <strong>der</strong> jüngste Chefredakteur aus <strong>der</strong> Provinz in Wien <strong>und</strong> <strong>der</strong> Geschäftsmann<br />
Stoll, <strong>der</strong> Manon sofort als “Wienerin” erkennt, ohne weitere Schlüsse zu ziehen:<br />
STOLL: Aha. Die Mamá ist Wienerin. Aber. Das sieht man doch sofort 19)<br />
Die drei alten Sängerknaben, die das Knabenterzett aus <strong>der</strong> Zauberflöte singen <strong>und</strong><br />
Geld einsammeln, sind Symbole <strong>der</strong> Wiener Kulturtradition <strong>und</strong> präsentieren sich,<br />
wie Manfred Mittermeyer anmerkt, “als heruntergekommene Relikte <strong>eine</strong>r<br />
anachronistisch gewor<strong>den</strong>en <strong>und</strong> bestenfalls noch im Zeichen des Frem<strong>den</strong>verkehrs<br />
vermarkteten Vergangenheit” 20)<br />
Es ist Nacht. Die Mutter zeigt <strong>der</strong> Tochter das Café, in dem sie <strong>und</strong> ihre Fre<strong>und</strong>e<br />
17) M. <strong>Streeruwitz</strong>, Tolmezzo. Eine symphonische Dichtung, in: dies.: Waikiki-Beach. Und<br />
an<strong>der</strong>e Orte. Die Theaterstücke. a.a.O., S. 294.<br />
18) M. <strong>Streeruwitz</strong>, New York. New York, in: dies., Waikiki-Beach. Und an<strong>der</strong>e Orte. Die<br />
Theaterstücke, a.a.O., S. 56.<br />
19) M. <strong>Streeruwitz</strong>, Tolmezzo, a.a.O., S. 299.<br />
20) Siehe Manfred Mittermayer, Theater <strong>der</strong> Zersplitterung. Zu <strong>den</strong> Dramen von <strong>Marlene</strong><br />
<strong>Streeruwitz</strong>, in: H. Harbers (Hg.), Postmo<strong>der</strong>ne Literatur in deutscher Sprache. Eine Ästhetik<br />
des Wi<strong>der</strong>stands, Amsterdam 2000, S. 178; Siehe auch Franziska Schößler, Zeit <strong>und</strong> Raum<br />
in Dra<strong>der</strong> 1990er Jahre. Elfriede Jelinek, Rainald Goetz <strong>und</strong> <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>, in: Georg<br />
Mein/ Markus Rieger-Ladich (Hg.), Soziale Räume <strong>und</strong> kulturelle Praktiken. Über <strong>den</strong><br />
strategischen Gebrauch von Medien. Bielefeld 2004, S. 235-255, insb. S. 250.
oft waren, <strong>und</strong> während sie es tut, spricht sie Deutsch mit ihrer Tochter, mit <strong>der</strong> sie<br />
sonst Englisch redet21): MANON: Hier. Hier waren wir immer. Je<strong>den</strong> Nachmittag. Nach <strong>der</strong> Schule. [ ] Und<br />
m<strong>eine</strong> Brü<strong>der</strong>. Und ich. Wir waren hier. Und <strong>der</strong> Heß. Der Schnabl. Und <strong>der</strong> Malcher.<br />
Und die Lizzi Bo<strong>den</strong>stedt. Je<strong>den</strong> Tag. Je<strong>den</strong> Tag waren wir hier. Da hinten sind wir<br />
gesessen. Da. Und laut waren wir. Jung. Halt. Und da vorne. Da ist immer dieser Dr.<br />
Walter gesessen. Der die Lizzi immer angestarrt hat. Und ihr Blumensträuße geschickt.<br />
Aufgedrängt. Weil sie schön war. Waren wir alle. Jung. Und schön. Unverletzlich.<br />
Irgendwie. 22)<br />
Ausgehend von dieser <strong>Erinnerung</strong>, die unmittelbar am Anfang des Stückes steht<br />
(1. Bild), kristallisieren sich an<strong>der</strong>e Fragmente <strong>der</strong> Geschichte heraus, die aber auch<br />
von an<strong>der</strong>en Figuren - zum Teil in <strong>eine</strong>r Art chorischem Gesang - wie<strong>der</strong>holt wer<strong>den</strong>,<br />
<strong>und</strong> damit “Gewaltzusammenhänge, die <strong>Gegen</strong>wart wie Vergangenheit durchziehen”<br />
darstellbar machen. 23) Manons <strong>Erinnerung</strong> steht dann auch am Ende des Stücks:<br />
MANON: Hier? Hier waren wir immer? Je<strong>den</strong> Nachmittag? So lange her. So viel. Und<br />
nicht zu Ende. Ich bin froh, daß ich alt bin. Und wenn <strong>eine</strong>m alles zugestoßen ist. Dann<br />
muß man k<strong>eine</strong> Angst mehr haben. Wenigstens. 24)<br />
Um diese <strong>Erinnerung</strong>sfragmente, die vor <strong>der</strong> Zeit des Exils <strong>und</strong> <strong>der</strong> Shoah liegen,<br />
21) Vgl. N. Hempel, Die Vergangenheit als <strong>Gegen</strong>wart als Zukunft, a.a.O., S. 51: Hempel<br />
definiert diese Art von Figuren, die beide Sprachen gemischt sprechen, o<strong>der</strong> Englisch mit<br />
deutschem Akzent <strong>und</strong> Deutsch “veraltet <strong>und</strong> nun wie<strong>der</strong>um mit <strong>eine</strong>m leicht<br />
amerikanischen Akzent versehen”, als “Hybridexistenzen”, <strong>und</strong> stellt fest, dass “in dieser<br />
beson<strong>der</strong>en Sprache <strong>der</strong> Emigranten ein Verweis auf ihre Vergangenheit unauflöslich<br />
festgeschrieben ist, <strong>und</strong> damit natürlich automatisch auch die <strong>Erinnerung</strong> an diese<br />
Vergangenheit”.<br />
22) M. <strong>Streeruwitz</strong>, Tolmezzo, a.a.O., S. 295.<br />
23) Franziska Schößler, Zeit <strong>und</strong> Raum in Dramen <strong>der</strong> 1990er Jahre. Elfriede Jelinek, a.a.O., S.<br />
250.<br />
24) M. <strong>Streeruwitz</strong>, Tolmezzo, a.a.O., S. 344.
kon<strong>den</strong>siert sich die Figur <strong>der</strong> Manon. Sie hält fünf innere Monologe, die so genannt<br />
wer<strong>den</strong> können, nicht nur weil sie nahezu inwendig sind obwohl die Figur sie<br />
ausspricht son<strong>der</strong>n <strong>und</strong> vor allem, weil es so aussieht, als ob alle an<strong>der</strong>en Figuren<br />
sie nicht hören könnten (o<strong>der</strong> wollten). Denn Manon erzählt nun nicht mehr ihrer<br />
Tochter, was geschehen ist, son<strong>der</strong>n sich selbst (dem Publikum, schreibt die Autorin):<br />
Manon erzählt <strong>den</strong> folgen<strong>den</strong> Text dem Publikum. Die Personen r<strong>und</strong> um sie beachten sie<br />
weiter nicht. Eine alte Frau erzählt ohne Zusammenhang <strong>eine</strong> <strong>der</strong> Geschichten aus ihrem<br />
Leben. Die an<strong>der</strong>en re<strong>den</strong> miteinan<strong>der</strong>. Leise. O<strong>der</strong> starren vor sich hin. 25)<br />
Manon erinnert sich für sich selbst <strong>und</strong> für all diejenigen, die Täter waren <strong>und</strong><br />
verdrängt haben, <strong>und</strong> für all diejenigen, die Nachgeborene sind <strong>und</strong> <strong>den</strong>en die<br />
<strong>Erinnerung</strong> geraubt wurde. Niemand hört ihr zu, sie erzählt Bruchstücke <strong>eine</strong>r<br />
Geschichte, die auch die Geschichte vieler an<strong>der</strong>er “Wiener” ist, sie redet vor sich<br />
hin. <strong>Streeruwitz</strong> bringt in diesem Theaterstück <strong>Erinnerung</strong> aus erster Hand zum<br />
Ausdruck, in Fetzen, die von allen unbeachtet bleibt, aber sie stellt sie dar <strong>und</strong> dem<br />
<strong>Raub</strong> <strong>der</strong> <strong>Erinnerung</strong> entgegen. “Das Verhin<strong>der</strong>n von Erinnern. Das Verdrängen”, wie<br />
die Autorin in ihren Frankfurter Poetikvorlesungen sagt. 26) Denn “das alles sind Akte,<br />
die sich gegen die Würde <strong>der</strong> Person richten”, die Würde liege in <strong>der</strong> “Fähigkeit <strong>der</strong><br />
<strong>Erinnerung</strong>”, 27) <strong>eine</strong> Fähigkeit, die die an<strong>der</strong>en Figuren um Manon herum nicht<br />
haben.<br />
MANON: Hubert Habich. Er wollte mich heiraten. Vorher. Wie ich dann die Visa hatte,<br />
hat er mich noch zum Zug gebracht. Ich hätte nicht mehr das Geld für die Straßenbahn<br />
gehabt. Sein Daimler stand vor <strong>der</strong> Tür. Hakenkreuzfahnen an bei<strong>den</strong> Seiten. Wir haben<br />
nichts gesprochen. Ich habe ihn dann gefragt, ob er Geld hätte. Unsere Konten waren ja<br />
alle geschlossen. Er gab mir Geld. Er hat dann jemand an<strong>der</strong>en geheiratet. Habe ich<br />
25) Ebda, S. 300-301.<br />
26) M. <strong>Streeruwitz</strong>, Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Lassen. Frankfurter<br />
Poetikvorlesungen, Frankfurt a. M. 1998, S. 124.<br />
27) Ebda.
gehört. Und ist gestorben. Hat sich zu Tode getrunken. Noch bevor es aus war. 28)<br />
In weiteren Monologen <strong>der</strong> Manon geht es um Visa, geschlossene Konten, Pässe<br />
(S. 311), um die Lizzi Bo<strong>den</strong>stedt, die schöne Fre<strong>und</strong>in:<br />
Sie war bei <strong>den</strong> ersten. Obwohl. Sie war nur. Es war nur ihre Mutter. Eigentlich. 29)<br />
Die Geschichte mit <strong>der</strong> Bahnreise <strong>und</strong> mit dem Geld wird zu Ende erzählt, nur<br />
von <strong>den</strong> belanglosen Gesprächen von Stoll <strong>und</strong> Krobath unterbrochen:<br />
MANON (zum Publikum:) Unsere Ausweise waren ja komplett illegal. Wir hatten diese<br />
Steuern doch nicht bezahlt [Reichsfluchtsteuer A.d.V.] 30) Hätten wir ja nicht können. Ich<br />
habe dem Schaffner gezeigt, daß ich Geld habe.<br />
[ ]<br />
MANON (zum Publikum:) Wie wir dann in Paris waren, ist <strong>der</strong> Schaffner gekommen. Er<br />
hat mir das Geld zurückgebracht. Ich habe ihm dann gesagt, er soll es behalten. Und so<br />
vielen Leuten wie möglich helfen. Es war das Geld vom Hubert Habich. 31)<br />
Die <strong>Erinnerung</strong>sfetzen wer<strong>den</strong> immer wie<strong>der</strong> unterbrochen, oft durch von an<strong>der</strong>en<br />
Figuren inszenierte Gewalt- <strong>und</strong> Machtrituale. Diese Verdichtung zu<br />
“assoziativ-atmosphärischen Situationen, die das Unheimliche <strong>der</strong> verdrängten<br />
Geschichte aufbrechen lassen [ ] kann als zentrales dramatisches Prinzip des<br />
Stückes beschrieben wer<strong>den</strong>”: nicht so sehr die semantischen Gehalte <strong>der</strong> erinnerten<br />
Geschichte sind wichtig, son<strong>der</strong>n das Signalisieren des Einbruchs des Verdrängten. 32)<br />
Denn die “Würde <strong>der</strong> <strong>Erinnerung</strong>” kann nicht schmerzlos von außen zu uns kommen.<br />
Es ist die Aufgabe <strong>eine</strong>s je<strong>den</strong> Einzelnen, <strong>der</strong> <strong>Erinnerung</strong> für sich (<strong>und</strong> zugleich für<br />
28) M. <strong>Streeruwitz</strong>, Tolmezzo, a.a.O., S. 301.<br />
29) Ebda, S. 314.<br />
30) Siehe www.reichsfluchtsteuer.de.<br />
31) M. <strong>Streeruwitz</strong>, Tolmezzo, a.a.O., S. 326, 327.<br />
32) Schößler Franziska, Zeit <strong>und</strong> Raum in Dra<strong>der</strong> 1990er Jahre. a.a.O., S. 250.
s<strong>eine</strong> ganze Gesellschaft) in die Augen zu schauen, zu lernen, damit umzugehen. Und<br />
vor allem mit dem Schweigen <strong>der</strong> älteren Generation umzugehen. Das Verdrängte<br />
so könnte man mit <strong>Streeruwitz</strong> sagen bricht sonst immer wie<strong>der</strong> ein, in<br />
verschie<strong>den</strong>sten Formen, <strong>und</strong> verfolgt uns. Bis wir stumpf wer<strong>den</strong>, um <strong>den</strong> Schmerz<br />
<strong>der</strong> <strong>Erinnerung</strong> nicht mehr abwehren zu müssen.<br />
Sloane Square (1992)<br />
Im Fall von Sloane Square fällt <strong>der</strong> Stücktitel mit dem Ort <strong>der</strong> Handlung<br />
zusammen. Die Figuren befin<strong>den</strong> sich in <strong>der</strong> “Un<strong>der</strong>gro<strong>und</strong>station Sloane Square”,<br />
müssen zur Victoria Station <strong>und</strong> dann weiter nach Gatwick. In <strong>der</strong> U-Bahn-Haltestelle<br />
das wird im ersten Bild beschrieben treffen zwei österreichische Familien<br />
zusammen (“Sie stellen die Gepäckstücke ab. Das Ehepaar Marenzi rechts. Das<br />
Ehepaar Fischer links.”), 33) die schon im selben Flugzeug nach London gereist waren<br />
<strong>und</strong> jetzt für <strong>den</strong> Rückflug auf dem Weg zum Flughafen sind. Wegen <strong>eine</strong>s Unfalls<br />
wird jedoch <strong>der</strong> Zugverkehr eingestellt: “there will be a consi<strong>der</strong>able delay”. 34) Diese<br />
Situation bildet <strong>den</strong> Ausgangspunkt für die Begegnung (2. Bild): beide Familien<br />
haben die Ansage nicht verstan<strong>den</strong>, kommen ins Gespräch <strong>und</strong> “Alle sind ein wenig<br />
verlegen darüber, ihre Erleichterung über das Treffen mit Landsleuten so offen<br />
gezeigt zu haben”. 35)<br />
Wenn <strong>Streeruwitz</strong> mit ihren “exotischen” Titelorten, die mit dem Ort <strong>der</strong> Handlung<br />
nichts zu tun haben, dem “Wunsch nach Exotik, dem ‘Sich-Verlieren’ im Glanz <strong>eine</strong>r<br />
an<strong>der</strong>en Welt” die Wahrheiten <strong>der</strong> eigenen Existenz “unerbittlich entgegenhält”, 36) so<br />
zeigt sie in Sloane Square, in <strong>der</strong> U-Bahn-Haltestelle, in <strong>der</strong> die Handlung stattfindet,<br />
33) M. <strong>Streeruwitz</strong>, Sloane Square, in: dies., Waikiki-Beach. Und an<strong>der</strong>e Orte. Die Theaterstücke,<br />
a.a.O., 1999, S. 125.<br />
34) Ebda.<br />
35) Ebda, S. 127.<br />
36) N. Hempel, Die Vergangenheit als <strong>Gegen</strong>wart als Zukunft, a.a.O., S. 55.
dass die Figuren verreisen, um die eigene Existenz nicht wahrhaben zu müssen:<br />
FRAU FISCHER: Aber. Die Atmosphäre. Und so weit weg. Von zu Hause. Alles an<strong>der</strong>s.<br />
Ich habe das gern. Ich. Dann muß man ohnehin wie<strong>der</strong> ins Büro. Immer das gleiche. So<br />
weiß man wenigstens, daß es etwas an<strong>der</strong>es gibt. Daß es ganz an<strong>der</strong>s 37)<br />
Die Situation, die präsentiert wird, ist nicht unüblich. Menschen begegnen an<strong>der</strong>en<br />
Menschen zufällig, müssen für <strong>eine</strong> Weile zusammen bleiben <strong>und</strong> wer<strong>den</strong> sich<br />
danach nie wie<strong>der</strong> sehen (wie in <strong>eine</strong>m Zugabteil): Am Ende des Stückes wird die<br />
<strong>eine</strong> Frau <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en nachrufen: “Jetzt weiß ich gar nicht, wie Sie heißen”. 38)<br />
In solchen Situationen ist es möglich, dass Gespräche geführt <strong>und</strong> Geschichten<br />
erzählt wer<strong>den</strong>, die sehr persönlich sind <strong>und</strong> doch dank des “Unbekanntbleibens”<br />
<strong>der</strong> sprechen<strong>den</strong> Subjekte zur Sprache gebracht wer<strong>den</strong> können. Es sind<br />
“Augenblicke <strong>der</strong> Wahrheit”.<br />
Herr <strong>und</strong> Frau Marenzi sind gemeinsam mit ihrem Sohn Michael <strong>und</strong> s<strong>eine</strong>r<br />
Fre<strong>und</strong>in Clarissa in London. Die 20jährige Clarissa hat vor kurzem festgestellt hat,<br />
dass sie schwanger ist, <strong>und</strong> Frau Marenzi äußert sich über die Übelkeit <strong>der</strong> jungen<br />
Frau, hastig <strong>und</strong> lieblos: “Übel. Übel. Schwanger ist sie. Schwanger. Heute. Bei<br />
diesen Möglichkeiten. Ich frage Sie.” 39) Hastig <strong>und</strong> lieblos, weil Frau Marenzi an<br />
ihrer eigenen Geschichte “zu Kauen” hat. Die Männer gehen ein Taxi suchen, <strong>und</strong><br />
die Frauen bleiben unter sich. Frau Marenzis Geschichte kommt mühsam zur<br />
Sprache, wird von ihrer “offiziellen” Geschichte oft unterbrochen, <strong>und</strong> lässt durch<br />
teilweise rhetorische - Fragen auch bei Frau Fischer Schmerzhaftes zutage treten.<br />
FRAU MARENZI: Um mich hat sich nie jemand gekümmert. Da ist <strong>eine</strong>m dann auch<br />
nicht schlecht. Wenn es niemandem auffällt. Wieviel Kin<strong>der</strong> haben Sie?<br />
[ ]<br />
37) M. <strong>Streeruwitz</strong>, Sloane Square, a.a.O., S. 137.<br />
38) Ebda, S. 163.<br />
39) Ebda, S. 132.
FRAU MARENZI: Also, ich wüßte nicht, was ich täte. Ohne die Kin<strong>der</strong>. Ich m<strong>eine</strong>. Da<br />
weiß man doch wenigstens. Wozu. Man lebt.<br />
[ ]<br />
FRAU MARENZI: Obwohl. Sorgen. Sorgen machen sie <strong>eine</strong>m schon. Aber. So. Zu<br />
Weihnachten. Wenn alle unter dem Baum. Beim Essen. Dann <strong>den</strong>ke ich mir doch. Es ist<br />
alles. Richtig. So.<br />
[ ]<br />
FRAU MARENZI: natürlich freue ich mich. Würde ich mich freuen. Wir freuen uns<br />
sehr. Das ist doch. Selbstverständlich ist das doch. Aber. Sie sind doch beide noch so<br />
jung. Der Michael ist noch nicht fertig. Studiert noch. Wohnung haben sie k<strong>eine</strong>. Am<br />
Anfang müssen sie bei uns wohnen. Das geht doch nicht. Das kann nicht gutgehen. Es<br />
wird gestritten. Und dann wird geschie<strong>den</strong>. Und was hat das Kind davon. Und sie?<br />
Niemand hat etwas davon. 40)<br />
Die Antwort <strong>der</strong> Frau Fischer kommt erst später, <strong>den</strong>n sie wird inzwischen noch<br />
direkter von Clarissa befragt, <strong>und</strong> mit <strong>der</strong> Antwort reißt sie ihre eigene W<strong>und</strong>e auf:<br />
CLARISSA: Und. Was wür<strong>den</strong> Sie an m<strong>eine</strong>r Stelle tun.<br />
[ ]<br />
FRAU FISCHER: Mich dürfen Sie das nicht fragen.<br />
[ ]<br />
FRAU FISCHER: [ ] Ich habe viermal. Fehlgeburten. Ich hätte natürlich. Ich m<strong>eine</strong>. Ich<br />
habe mir <strong>eine</strong>s gewünscht. Ein Kind. Obwohl. Nach <strong>den</strong> ersten zwei. Da habe ich noch<br />
gedacht, es wird. Aber. Das dritte Mal. Und beim vierten. Da habe ich nicht mehr<br />
wollen. Da war ich einfach am Ende. Am liebsten hätte ich mich. Aber auch das ist mir<br />
nicht. Gelungen. Ich m<strong>eine</strong>. M<strong>eine</strong>m Mann macht das nicht aus. Er hat Kin<strong>der</strong> aus <strong>der</strong><br />
ersten Ehe. Zwei Söhne. Und so. Wir können überall hinfahren. Ungestört. So viel wir<br />
wollen. [ ] 41)<br />
Frauen, von ihren Männern allein gelassen, erzählen also Brocken ihrer<br />
persönlichen, inneren Geschichte. Oft tun sie es eher für sich selbst. Wenn Manon<br />
40) Ebda, S. 133, 135, 138.<br />
41) Ebda, S. 156-157.
Greeff in Tolmezzo allein zum Publikum redet, hören die an<strong>der</strong>en Figuren nicht zu,<br />
weil Manon <strong>eine</strong> Geschichte von Vertreibung <strong>und</strong> Ermordung erzählt, <strong>und</strong> weil ihre<br />
Geschicke, ihre <strong>Erinnerung</strong>sbrocken, als “Einbrüche” des Verdrängten <strong>eine</strong>r ganzen<br />
Gesellschaft da stehen. Frau Marenzi hingegen hält ihre eigene Art des inneren<br />
Monologs, in dem <strong>Streeruwitz</strong> “die Ausgehöhltheit” <strong>der</strong> Figur zu erforschen versucht. 42)<br />
Zunächst wer<strong>den</strong> jedoch wie oft bei <strong>Streeruwitz</strong> “Regieanweisungen” gegeben.<br />
Solche Passagen ähneln oft <strong>eine</strong>m Kommentar zur Figur. Im 15. Bild wird ein<br />
Monolog <strong>der</strong> Frau Marenzi wie folgt eingeführt:<br />
[ ] Frau Marenzi steht da. Die Männer sind weg.<br />
Die folgen<strong>den</strong> Monologfetzen sind ein Versuch, Frau Marenzis Situation zu beschreiben.<br />
Sie versucht, mit diesen Worten sich selbst alles fassbar zu machen. Goethes Worte sind<br />
aber <strong>eine</strong> Fremdsprache für sie, <strong>der</strong> sie schon während des Deklamierens zuhört,<br />
nachhorcht, die sich ihr durch die Wie<strong>der</strong>holungen endgültig entziehen, sinnlos wer<strong>den</strong>.<br />
Der Text konstituiert <strong>eine</strong>n Zustand, <strong>eine</strong>n an<strong>der</strong>en Zustand als <strong>den</strong> ihren, <strong>den</strong> sie nicht<br />
versteht, vor dem sie aber große Angst hat. Deshalb verfällt sie während des<br />
Monologisierens in ihre geläufigen Alltagshandlungen. In das Ordnungmachen. [ ] 43)<br />
Wie Mittermayer eingehend analysiert, rezitiert Frau Marenzi stockend Passagen<br />
aus Goethes Drama Iphigenie auf Tauris (1786), die ein Mittel zur Angstbewältigung<br />
sein sollen. Die Autorin stellt damit nicht zuletzt die Funktion <strong>der</strong> klassischen<br />
Literatur zur Diskussion, die als “Sätzchen” mit nach Hause genommen wer<strong>den</strong> <strong>und</strong><br />
dem Bedürfnis nach Ordnung <strong>und</strong> Geborgenheit entsprechen. 44)<br />
Frau Marenzi hilft in <strong>der</strong> Tat <strong>der</strong> Figur <strong>der</strong> “Strotterin” beim “Aufräumen”, beim<br />
42) U. Hass/ M. <strong>Streeruwitz</strong>, “die Leerstellen zu sehen. Das wäre es”. Ein Gespräch über<br />
Theater, in: Text + Kritik, a.a.O., S. 59-65, hier S. 61.<br />
43) M. <strong>Streeruwitz</strong>, Sloane Square, a.a.O., S. 151-152.<br />
44) Siehe M. Mittermayer, Theater <strong>der</strong> Zersplitterung. Zu <strong>den</strong> Dramen von <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>,<br />
a.a.O., S. 174-175; Über die Bedeutung <strong>der</strong> Figur, die D’Annunzio heißt (die historische<br />
Figur des italienischen Dichters Gabriele D’Annunzio wird auch von Jelinek in Clara S.<br />
verwendet) <strong>und</strong> <strong>eine</strong> an<strong>der</strong>e, gehobenere Sprache als die Ehemänner spricht, siehe M.<br />
Mittermayer, a.a.O., S. 170-171.
Ordnungmachen. Weggetragen wer<strong>den</strong> die Leichen <strong>der</strong> von Punks - in mehreren die<br />
Haupthandlung des Stückes unterbrechen<strong>den</strong> Szenen - ermordeten Menschen. 45)<br />
Die “Anweisungen” gehen weiter:<br />
Es könnte sich um <strong>eine</strong>n Besuch handeln, bei dem die Hausfrau beim Erbsenauslösen<br />
angetroffen wurde <strong>und</strong> die Besucherin nun dabei mithilft.<br />
Aber was folgt, ist dann kein Rezitieren mehr, son<strong>der</strong>n die eigentliche Geschichte<br />
<strong>der</strong> Frau Marenzi, die so lange in <strong>der</strong> Täuschung <strong>und</strong> in <strong>der</strong> Lüge gelebt hat, dass<br />
es heute nicht mehr schmerzt. Sie weiß nur noch genau, aber spüren tut sie nicht<br />
mehr, sie ist abgestumpft:<br />
Frau Marenzi redet plau<strong>der</strong>nd vor sich hin. [ ]<br />
FRAU MARENZI: [ ] Der Michael erwartet ein Kind. Habe ich dir das schon gesagt?<br />
Was sagst du dazu? Das heißt. S<strong>eine</strong> Fre<strong>und</strong>in kriegt es. Natürlich. Ich bin dagegen. Der<br />
Bub versäumt alles. So war es schon bei uns. Kannst du dich erinnern. K<strong>eine</strong>r hat etwas<br />
gehabt. [ ] Dann. Bei <strong>der</strong> Taufe von dem Michael. Daß <strong>der</strong> Leopold <strong>und</strong> m<strong>eine</strong><br />
Schwester. Irgendwie haben die sich immer schon. Aber ich habe mir gedacht. Das kann<br />
es doch nicht. Das kann doch nicht sein. Aber dann. Man sieht es dann ja gleich. Finde<br />
ich. Wenn zwei. Mit <strong>eine</strong>m Blick kann man es sehen. Aber. Da war ich dann schon. [ ]<br />
Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Es war. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das<br />
beschreiben soll. Es war. Grauenhaft. Ununterbrochen nur <strong>der</strong> Gedanke daran. Wie ich es.<br />
Weißt du. Ich weiß es noch ganz genau. Spüren kann ich es nicht mehr. [ ] Gesagt hat<br />
er, er arbeitet. Aber. Ich bitte dich. Vielleicht hätte es mir gut getan. Es zu wissen. Weißt<br />
du. So habe ich es ja nur. Geahnt. Vermutet. Genau weiß ich es ja bis heute nicht. Und<br />
fragen. Fragen hätte ich mich nie getraut. Wissen wollte ich es auch nicht. Und irgendwie<br />
war alles auf einmal verschwun<strong>den</strong>. [ ] Währenddessen funktioniert alles weiter. Sogar<br />
man selbst. 46)<br />
45) Die Gewalt ‘bricht‘ nicht in <strong>den</strong> (klein-)bürgerlichen Alltag ein, wie oft von Kritikerinnen<br />
beschrieben, son<strong>der</strong>n sie existiert wie selbstverständlich in ebendiesem Alltag, wie Maria<br />
Stehle <strong>und</strong> Sabine Harenberg pointiert bemerken. Vgl. Stehle Maria/Harenberg Sabine, “Das<br />
Schreiben ist für mich <strong>eine</strong> Art Anti-Verdrängungsstrategie”. a.a.O., S. 211.<br />
46) M. <strong>Streeruwitz</strong>, Sloane Square, a.a.O., S. 153-154, 155.
Damit rückt Frau Marenzi in die Nähe <strong>der</strong> Figur Helene im Roman Verführungen,<br />
die sich bitter dabei zusieht, wie sie funktioniert, <strong>und</strong> gehört zugleich dem Kreis<br />
<strong>der</strong>jenigen, die nicht wissen wollten. Die Figur <strong>der</strong> Frau Marenzi will über die<br />
eigene, persönliche Geschichte nichts wissen. <strong>Streeruwitz</strong> zeigt, wie jede Geschichte<br />
in sich eingeschlossen (weil verdrängt) <strong>und</strong> daher auch nur zum Teil, wenn<br />
überhaupt, mitteilbar ist.<br />
So wie bei <strong>der</strong> verdrängten <strong>Erinnerung</strong> des Holocaust <strong>und</strong> dem daraus<br />
resultieren<strong>den</strong> “<strong>Raub</strong> <strong>der</strong> <strong>Erinnerung</strong>” bei <strong>den</strong> jüngeren Generationen die Wirkung,<br />
die Symptome klar zu sehen sind (k<strong>eine</strong> Möglichkeit, darüber re<strong>den</strong> zu können, k<strong>eine</strong><br />
Möglichkeit <strong>eine</strong>s Zueinan<strong>der</strong>, k<strong>eine</strong> Konfrontation), so ist in Sloane Square <strong>eine</strong><br />
Interaktion <strong>der</strong> privaten Geschichten unmöglich. Die Frauen “halten nicht zusammen”,<br />
o<strong>der</strong> vielleicht nur für <strong>eine</strong> Sek<strong>und</strong>e, <strong>und</strong> es macht sie verlegen:<br />
CLARISSA: Ich habe mich in m<strong>eine</strong>m Leben noch nie so verlassen gefühlt. So allein.<br />
[ ]<br />
CLARISSA (zu <strong>den</strong> Frauen): Ist das so. Alles?<br />
Beide Frauen wie<strong>der</strong> hilflos.<br />
FRAU FISCHER (verlegen, entschuldigend:) Ich glaube, so ist es. 47)<br />
Sowohl das Verdrängte als auch das “weibliche” Ungesagte, Uneingestan<strong>den</strong>e,<br />
bil<strong>den</strong> die Aufgabe, die <strong>Streeruwitz</strong> auf sich nehmen will. Es geht ihr, wie sie in<br />
<strong>eine</strong>m Interview definiert, um <strong>eine</strong> “Poetik des Suchens”, 48) die mit unterschiedlichen<br />
stilistischen Mitteln zum Ausdruck gebracht wird, wie zum Beispiel durch die<br />
exzessive Interpunktion, <strong>der</strong>en Bedeutung Elfriede Jelinek beson<strong>der</strong>s hervorhebt:<br />
So steht das da. In Sätzen, als würde uns <strong>eine</strong>r immer wie<strong>der</strong> in <strong>den</strong> Rücken boxen, <strong>und</strong><br />
47) Ebda, S. 162.<br />
48) Kramatschek Claudia, Es gibt k<strong>eine</strong> Utopien für Frauen. Im Gespräch: Die Schriftstellerin<br />
<strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong> über die Poetik des Suchens, in: Freitag, 20. 2. 1998. Zit. aus Stehle<br />
Maria/Harenberg Sabine, “Das Schreiben ist für mich <strong>eine</strong> Art Anti-Verdrängungsstrategie”,<br />
a.a.O. S. 218.
die Sätze kommen nur stückweise heraus, von Punkten zerhackt. [ ] Die Punkte sind die<br />
Leuchttürme im Sprechen <strong>der</strong> Schauspieler, damit sie besser aufpassen. Damit man selber<br />
besser aufpaßt. 49)<br />
Ein weiteres Stilmittel, das <strong>Streeruwitz</strong> in ihrer “Poetik des Schweigens” 50) in <strong>den</strong><br />
Tübinger Vorlesungen erläutert, ist die Konzeption ihrer Texte als Orte <strong>der</strong><br />
Begegnung des Zuschauers/Lesers mit sich selbst. Es sei vor allem in <strong>den</strong> Zäsuren,<br />
die <strong>den</strong> Satz <strong>und</strong> <strong>den</strong> Textkörper unterbrechen <strong>und</strong> zum Schweigen bringen, dass <strong>der</strong><br />
Text dem Leser o<strong>der</strong> dem Zuschauer “übergeben” wird, damit er, <strong>der</strong> Zuschauer, sich<br />
mit sich selbst konfrontiert. 51)<br />
Im Textfluss wer<strong>den</strong> also Lücken <strong>und</strong> Störungen produziert, die die Sprache zu<br />
<strong>eine</strong>r beschädigten wer<strong>den</strong> lassen. <strong>Streeruwitz</strong>’ Mittel sind auch “Schnitt, Wechsel <strong>der</strong><br />
Einstellung, Einschübe, Zitate, Collagierung linearer <strong>und</strong> räumlicher Natur”. 52) Ihre<br />
parataktische Syntax <strong>und</strong> ihre Zäsuren im Text spiegeln die Tatsache wie<strong>der</strong>, dass die<br />
Autorin k<strong>eine</strong> Antworten bereit hält. In ihren Theaterstücken gibt es k<strong>eine</strong> Schlüsse,<br />
k<strong>eine</strong> Antworten, k<strong>eine</strong> Lösungen, daher vermeidet Sie Kausalitätsbeziehungen<br />
zwischen <strong>den</strong> einzelnen Sätzen:<br />
Der ganze Satz, <strong>der</strong> behauptet, er könnte <strong>eine</strong>n Tatbestand beschreiben, ist <strong>eine</strong><br />
Riesenlüge. Und insofern kann man nur zum Zerbrechen greifen. Versuchen, über die<br />
Auslassung dessen, was man eben nicht hereinbringen kann, <strong>eine</strong> Wirklichkeit auf <strong>eine</strong>r<br />
an<strong>der</strong>en Ebene herzustellen, die zugibt, daß alles nur Splitterwerk ist. 53)<br />
49) Jelinek Elfried,, Die Macht <strong>und</strong> ihre Preisliste (zu <strong>den</strong> Theaterstücken <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>’),<br />
in: M. <strong>Streeruwitz</strong>, Waikiki-Beach. Und an<strong>der</strong>e Orte. Die Theaterstücke, a.a.O., S. VII-XVI,<br />
hier S. VIII.<br />
50) M. <strong>Streeruwitz</strong>, Sein. Und Schein. Und Ersch<strong>eine</strong>n, Tübinger Poetikvorlesungen, Frankfurt a.<br />
M. 1997, S. 71.<br />
51) Vgl. M. <strong>Streeruwitz</strong>, Nur ein Fetzen von Alltag. In: Intertextualität <strong>und</strong> Weiblichkeit. Die<br />
Philosophin. Forum für feministische Theorie <strong>und</strong> Philosophie, 1999 (April), S. 54.<br />
52) M. <strong>Streeruwitz</strong>, Sein. Und Schein. Und Ersch<strong>eine</strong>n, a.a.O., S. 81.<br />
53) Siehe Ernst Grohotolsky im Gespräch mit <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>. in: E. Grohotolsky (Hg.),<br />
Provinz, sozusagen: Österreichische Literaturgeschichte. Graz 1995, S. 247.
Beide dramatischen Beispiele, das Verdrängte in Tolmezzo <strong>und</strong> das “weibliche”<br />
Uneingestan<strong>den</strong>e in Sloane Square, sind Wirklichkeiten “auf <strong>eine</strong>r an<strong>der</strong>en Ebene”<br />
Vorgänge, die schwer in Gang kommen. Sie sind “Etwas Unabgeschlossenes, das sich<br />
gleichwohl zu <strong>eine</strong>r konkreten Repräsentation herausnimmt”. 54)<br />
<strong>Streeruwitz</strong>, <strong>Marlene</strong>: Waikiki Beach. Und an<strong>der</strong>e Orte. Die Theaterstücke. Mit <strong>eine</strong>m<br />
Vorwort von E. Jelinek, Frankfurt a. M.: Fischer 1999. Der Band versammelt<br />
folgende Stücke:<br />
- Brahmsplatz. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1993.<br />
- New York New York. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1993.<br />
- Waikiki Beach. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1992.<br />
- Sloane Square. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1992.<br />
- Ocean Drive. Ein Stück, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991.<br />
- Elysian Park. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1993.<br />
- Tolmezzo. Eine symphonische Dichtung. Frankfurt a. M.: 1994.<br />
- Bagnacavallo. Brahmsplatz. Zwei Stücke. Frankfurt a. M.: 1993.<br />
- Dentro. Frankfurt a. M: Fischer 1999<br />
- Boccaleone. Frankfurt a. M.: Fischer 1999.<br />
- Dies.: Sein. Und. Schein. Ein Ersch<strong>eine</strong>n. Tübinger Poetikvorlesungen. Frankfurt a. M.<br />
1997.<br />
- Dies.: Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Lassen. Frankfurter Poetikvorlesungen.<br />
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1998.<br />
- Dies.: ‘Hexen’ heute. Und. Warum es nicht lustig geht, in: Heinz Ludwig Arnold<br />
(Hg.): “Hexenre<strong>den</strong>”. Göttingen 1999, S. 21-26.<br />
- Dies.: Tagebuch <strong>der</strong> <strong>Gegen</strong>wart (Essayband). Wien: Böhlau 2002.<br />
- Dies.: Verführungen. 3. Folge. Frauenjahre. Frankfurt a. M. 1996.<br />
54) U. Hass/ M. <strong>Streeruwitz</strong>, “die Leerstellen zu sehen. Das wäre es”. Ein Gespräch über<br />
Theater, in: Text + Kritik, a.a.O., S. 59-65, hier S. 61.
- Dies.: Nachwelt. Frankfurt a. M: Fischer 1999.<br />
- Dies.: Text & Kritik. Eine Kritikbiographie. Bis 1993, in: Text + Kritik, S. 3-10.<br />
- Dies.: Vater. Land, in: Die Presse, Samstag 21. April 2007 (Spectrum, S. IV).<br />
- Dies.: Nur ein Fetzen von Alltag, in: Intertextualität <strong>und</strong> Weiblichkeit. Die Philosophin.<br />
Forum für feministische Theorie <strong>und</strong> Philosophie, 1999 April, S. 54.<br />
Arnold, Heinz Ludwig (Hg.): <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>, Text + Kritik, Heft 164, 2004.<br />
Grohotolsky, Ernst (Hg.): Provinz, sozusagen: Österreichische Literaturgeschichte. Graz<br />
1995.<br />
Hass, U. /<strong>Streeruwitz</strong> M.: “die Leerstellen zu sehen. Das wäre es”. Ein Gespräch über<br />
Theater, in: Arnold, Heinz Ludwig (Hg.): <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>, Text + Kritik,<br />
Heft 164, 2004, S. 59-65.<br />
Hempel, Nele: Die Vergangenheit als <strong>Gegen</strong>wart als Zukunft. Über <strong>Erinnerung</strong> <strong>und</strong><br />
Vergangenheitsbewältigung in Texten von <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>, in: Arnold,<br />
Heinz Ludwig (Hg.): <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>, Text + Kritik, Heft 164, 2004, S.<br />
48-58.<br />
Hempel, Nele: <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong> - Gewalt <strong>und</strong> Humor im dramatischen Werk.<br />
Tübingen: Stauffenberg 2001.<br />
Jelinek, Elfriede: Die Macht <strong>und</strong> ihre Preisliste (zu <strong>den</strong> Theaterstücken <strong>Marlene</strong><br />
<strong>Streeruwitz</strong>’), in: M. <strong>Streeruwitz</strong>, Waikiki-Beach. Und an<strong>der</strong>e Orte. Die<br />
Theaterstücke. Frankfurt a. M. 1999, S. VII-XVI.<br />
Jelinek, Elfriede/ Lecerf, Christine: L’entretien, Paris 2007.<br />
Kedveš, Alexandra: Über <strong>Streeruwitz</strong>’ Romane: “Geheimnisvoll. Vorwurfsvoll. Aber<br />
Zusammenhängend”. <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>’ Romane, Frauengeschichten,<br />
Männersprache, in: Arnold, Heinz Ludwig (Hg.): <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>, Text +<br />
Kritik, Heft 164, 2004, S. 19-36.<br />
Kramatschek, Claudia: <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>, in: Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Kritisches<br />
Lexikon zur deutschsprachigen <strong>Gegen</strong>wartsliteratur, Bd. 10, 73. Nachlieferung<br />
3/03. München 2003, S. 1-14.<br />
- Dies.: Zeigt her eure Wun<strong>den</strong>! O<strong>der</strong>: Schnitte statt Kosmetik. Vorentwurf zu <strong>eine</strong>r<br />
(weiblichen) Ästhetik zwischen Alltagsrealismus <strong>und</strong> ‘trivial pursuit of<br />
happiness’, in: Arnold, Heinz Ludwig (Hg.): <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>, Text + Kritik,<br />
Heft 164, 2004.
Löffler, Sigrid: Endkampf vom Paravent, in: Theater heute, 8 (1995), S. 52-53.<br />
Makoschey, Klaus/ Schmidt Wilhelm R. (Hg.): <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>, Begleitheft zur<br />
Ausstellung (Stadt- <strong>und</strong> Universitätsbibliothek Frankfurt/M.). Frankfurt a. M.<br />
1998.<br />
Mittermayer, Manfred: Theater <strong>der</strong> Zersplitterung. Zu <strong>den</strong> Dramen von <strong>Marlene</strong><br />
<strong>Streeruwitz</strong>, in: H. Harbers (Hg.): Postmo<strong>der</strong>ne Literatur in deutscher Sprache.<br />
Eine Ästhetik des Wi<strong>der</strong>stands. Amsterdam 2000.<br />
Schößler, Franziska: Zeit <strong>und</strong> Raum in Dramen <strong>der</strong> 1990er Jahre. Elfriede Jelinek,<br />
Rainald Goetz <strong>und</strong> <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>, in: Georg Mein/Markus Rieger-Ladich<br />
(Hg.): Soziale Raume <strong>und</strong> kulturelle Praktiken. Über <strong>den</strong> strategischen Gebrauch<br />
von Medien. Bielefeld 2004, S. 235-255.<br />
Stehle, Maria/ Harenberg, Sabine: “Das Schreiben ist für mich <strong>eine</strong> Art<br />
Anti-Verdrängungsstrategie”. Themen <strong>und</strong> Formen in <strong>Marlene</strong> <strong>Streeruwitz</strong>’<br />
Theaterstücken <strong>und</strong> Prosawerk, in: I. Nagelschmidt/ A. Hanke/ L.<br />
Müller-Dannhausen./ M. Schröter (Hg.): Zwischen Trivialität <strong>und</strong> Postmo<strong>der</strong>ne.<br />
Literatur von Frauen in <strong>den</strong> 90er Jahren. Frankfurt a. M. 2002, S. 207-222.