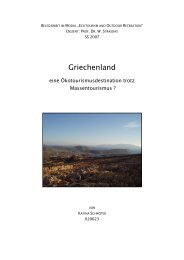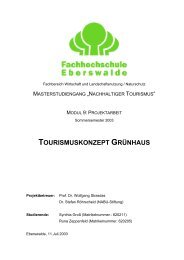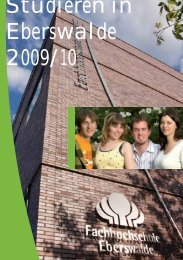Fachhochschule Eberswalde * Fachbereich: Wirtschaft/
Fachhochschule Eberswalde * Fachbereich: Wirtschaft/
Fachhochschule Eberswalde * Fachbereich: Wirtschaft/
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
teilung des Jahreszyklus in zwei Regen- und zwei Trockenzeiten (Hauptregenzeit von Februar bis Mai).<br />
Die Tage beginnen immer früh (Sonnenaufgang ca. um 04:30 Ortszeit) und enden bei Sonnenuntergang<br />
(ca. 18:00 im Durchschnitt). Die ergiebigen Regenfälle und der durch vulkanische Asche angereicherte<br />
Boden ermöglichen im allgemeinen gute Ernten für die lokale Bevölkerung (Durchschnittliche Niederschlagsmenge:<br />
787 mm/Jahr). Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 22,8 Grad Celsius.<br />
3.2.3 Bevölkerung und <strong>Wirtschaft</strong><br />
Obwohl der grössere Teil der Bevölkerung nach wie vor auf dem Land lebt (ca. 94%), ist seit Jahrzehnten<br />
ein ungebrochener Trend zur Verstädterung festzustellen. Schätzungen zufolge lebt ca. eine Million der<br />
insgesamt acht Millionen Ruander (Stand 2004) in der Hauptstadt Kigali im Zentrum des Landes. Bedeutende<br />
Anteile entfallen auch auf die Städte Butare (im Süden, Nähe burundische Grenze), Ruhengeri,<br />
Gisenyi (im Osten, Nähe kongolesische Grenze) und Kibuye (im Westen, Nähe tanzanische Grenze).<br />
Seit Menschengedenken lebt die Bevölkerung Ruandas grösstenteils von der Landwirtschaft. Traditionell<br />
leben viele vom Land- und Gartenbau (angebaut werden u.a Kaffee, Tee, Bananen, Tabak), andere von<br />
der Tierhaltung (im wesentlichen Rinderhaltung und Bienenzucht).<br />
3.2.4 Kultur und Geschichte<br />
Die Bevölkerung Ruandas durchlief in den vergangenen 200 Jahren eine stetige Entwicklung der Tribalisierung,<br />
die insbesondere im 20. Jahrhundert in der wohl grössten Tragödie des Landes gipfelte: dem<br />
Genozid von 1994.<br />
Die kulturhistorische und ethnologische Forschung hat im Versuch die Ursprünge dieses Konfliktes zu<br />
ergründen, mittlerweile zwei Hauptursachen identifiziert:<br />
1. Die zunehmende Stratifizierung der Gesellschaft unter den Tutsi-Königen:<br />
Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts bildete sich unter der Herrschaft des Fürsten Rwabugiri eines der ersten<br />
Grosskönigreiche Ostafrikas heraus. Rwabugiri unterwarf zahlreiche benachbarte Fürsten und verleibte<br />
deren Herrschaftsgebiet in das seinige ein. Zur Kontrolle dieses neuen Reiches etablierte er eine Elite von<br />
Beamten und Vasallen, die im Rahmen einer Klientelbeziehung direkt vom König bzw. von seinen<br />
lokalen Vertretern abhängig waren. Das Patron – Klient – Verhältnis wurde durch Landtransfer aber insbesondere<br />
durch Leihgabe von Rindern („ubuhake“-Klientelismus) in beiden Richtungen reguliert. Dadurch<br />
erhielten v.a. reiche Viehbesitzer aus der sozialen Schicht der „Tutsi“ einen Zugang zu den höheren<br />
und einflussreicheren „Beamten-„posten. Eine zunehmende Stratifizierung der Gesellschaft zwischen<br />
„arm“ und „reich“, zwischen vieh(reichen) „Tutsi“ und vieh(armen) „Tutsi“ bzw. vorwiegend im Landbau<br />
tätigen „Hutu“ war die Folge. Wichtig ist es jedoch festzuhalten, dass bis weit ins 20. Jh. hinein<br />
„ubuhake“ eine Durchlässigkeit zwischen den sozialen Schichten noch möglich machte. So konnten<br />
„Hutu“ auch „Tutsi“ werden z.B. durch Heirat.<br />
2. Die Ethnisierung während der Kolonialzeit<br />
Im „Kielwasser“ der Berliner Konferenz von 1886 und der daraus resultierenden Festlegung kolonialer<br />
Grenzverläufe in Afrika wuchs im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhundert das Interesse des Deutschen<br />
Kaiserreiches an seinem Protektorat „Ruanda“. Seit Beginn der 1890er Jahre wurde eine kleine<br />
militärische und administrative Präsenz von Bujumbura (der Hauptstadt des heutigen Burundi) aus etabliert.<br />
Kurz darauf wurde das Gebiet Teil der Kolonie „Deutsch-Ostafrika“, welche die Territorien der<br />
heutigen Staaten Tanzania, Ruanda und Burundi umfasste. Die neue Kolonialmacht folgte in puncto<br />
Administration dem britischen Vorbild der „indirect rule“ und pflanzte dem bereits vorhandenen Tutsi-<br />
Elite-System eine personell recht schwache europäische Verwaltung auf. Während dieser Zeit, aber v.a.<br />
während der anschliessenden belgischen Kolonialperiode, wurden das zunehmend stratifizierte Sozial-<br />
- 8 -