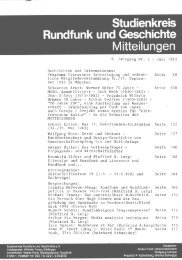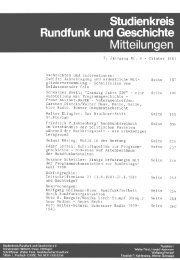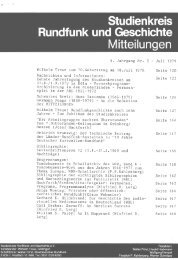1998, 24. Jahrgang (pdf) - Studienkreis Rundfunk und Geschichte
1998, 24. Jahrgang (pdf) - Studienkreis Rundfunk und Geschichte
1998, 24. Jahrgang (pdf) - Studienkreis Rundfunk und Geschichte
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ches stellten, heute als Ankläger gegen Männer aufstehen,<br />
die ebenso wehrlose oder noch wehrlosere<br />
Opfer des Terrors waren wie sie? Und wenn das richtig<br />
ist: was gedenkt das Parlament zu tun, um die<br />
Wiederholung solcher Vorkommnisse in Zukunft zu<br />
verhindern?« 12<br />
ln einer Forumsveranstaltung des <strong>R<strong>und</strong>funk</strong>s deren<br />
Mitschnitt erhalten ist, 1 3 wurden die Vorwürfe<br />
diskutiert. Teilnehmer der »Justiz <strong>und</strong> öffentliche<br />
Meinung« überschriebenen Diskussion, die den<br />
Grafeneckprozeß selbst nicht betraf, waren: Generalstaatsanwalt<br />
Dr. Richard Schmid, Ministerialrat<br />
Dr. von Wachter, Rechtsanwalt Dr. Wolfgang<br />
Schwamberger, Dr. Helmut Cron vom<br />
Journalistenverband Württemberg-Baden <strong>und</strong><br />
Redakteur der Stuttgarter »Wirtschaftszeitung«,<br />
Kurt Wessei von der »Stuttgarter Zeitung«. Es<br />
gab mit Mostars Schlußwort sechs Diskussionsbeitrage<br />
von jeweils etwa zehn Minuten Dauer.<br />
Unter den Beitragen aus dem Publikum fand -<br />
nach Dauer <strong>und</strong> Lautstarke - den meisten Beifall<br />
ein Herr Fink, der sich als Stimme des »kleinen<br />
Mannes« bezeichnete <strong>und</strong> den Gesichtspunkt<br />
des Opferstatus, der auch bei Mostar selbst angesprochen<br />
wird, thematisierte: die »kleinen<br />
Leute« waren alle Opfer.<br />
Ich greife die kontroversen Beitrage des Ministerialrats<br />
Dr. von Wachter <strong>und</strong> des Rechtsanwalts<br />
Dr. Schwamberger heraus. Von Wachter<br />
als Vertreter der Richter stellte die eher rhetorische<br />
Frage, ob die Justiz nach der öffentlichen<br />
Meinung urteilen solle, die es als einheitliche gar<br />
nicht gebe. Als abschreckendes Beispiel eines<br />
solchen Versuchs führte er die Abrechnung in<br />
Frankreich mit den Kollaborateuren an, über die<br />
die französische Öffentlichkeit inzwischen ganz<br />
anders denke, weil die Zusammenarbeit mit den<br />
Deutschen namlich Blutvergießen in Frankreich<br />
verhindern sollte. Über die tatsachlichen Vorgange<br />
in Frankreich weiß man heute mehr, als<br />
von Wachter damals wissen konnte, aber darum<br />
geht es auch nicht. Vielmehr ging es von Wachter<br />
für die Kontinuitaten in der Justiz um deren<br />
Rechtfertigung <strong>und</strong> um einen »harmonischen<br />
Dreiklang zwischen Recht, Richter <strong>und</strong> öffentlicher<br />
Meinung« mit Hilfe einer entsprechenden<br />
Vereinbarung.<br />
Eine der Gegenpositionen vertrat Rechtsanwalt<br />
Dr. Schwamberger. Seine Argumentation<br />
wurde haufig von starkem Beifall unterbrochen.<br />
Er machte deutlich, daß es sich bei dem Streit<br />
über die Grenzen des Rechts zu freier MeinungsaußerunQ<br />
um keinen Einzelfall im Nachkriegsdeutschland<br />
handele. Vielmehr lagen die<br />
strukturellen Ursachen in der fehlenden funktionsfahigen<br />
Opposition <strong>und</strong> der notwendigen<br />
Aufklarungsfunktion der Medien. Die mehrfache<br />
Berufung in den Podiumsbeitragen auf englische<br />
Institutionen, um die man die Englander nur be-<br />
Wilharm: A V-Oberlieferung <strong>und</strong> Geschichtswissenschaft 49<br />
neiden könne, helfe nicht weiter, weil die Rahmenbedingungen<br />
wegen der in Deutschland<br />
fehlenden starken Opposition nicht vergleichbar<br />
seien.<br />
Es gibt mehrere Ebenen der Interpretation,<br />
die ich kurz benennen will:<br />
1. Der Stellenwert der inhaltlichen Aussage:<br />
Die Thematisierung der öffentlichen Meinung<br />
<strong>und</strong> die Ängste vor der unkentreliierten <strong>und</strong> verantwortungslosen<br />
Presse <strong>und</strong> dem <strong>R<strong>und</strong>funk</strong> auf<br />
seiten der Etablierten sind ein zentrales Thema<br />
in der B<strong>und</strong>esrepublik auch noch in den 50er<br />
Jahren, <strong>und</strong> zwar durchaus für eine breitere Öffentlichkeit.<br />
Die beim Publikum erfolgreichen<br />
Pressefilme (z. B. »Der Mann, der sich verkaufte«,<br />
1959) hatten in den 50er Jahren genau den<br />
Tenor des verantwortungslosen Journalismus<br />
aus Ehrgeiz <strong>und</strong> Eitelkeit, der Existenzen zerstört.<br />
Die Unsicherheit in der verordneten Demokratie<br />
wird deutlich in den wiederholten Bemühungen,<br />
sich auf englische Verhaltnisse zu berufen,<br />
<strong>und</strong> das von den unterschiedlichsten Positionen<br />
aus.<br />
2. Die sprachliche Ebene: Wortwahl <strong>und</strong><br />
Sprachduktus, konventionelle Rede <strong>und</strong> Verwendung<br />
von Ironie charakterisieren die Sprecher<br />
<strong>und</strong> ermöglichen ihre Zuordnung zu unterschiedlichen<br />
Konventionen. Der »Blutkreislauf<br />
zwischen Justiz <strong>und</strong> Volk«, der »verantwortungslose«<br />
Journalismus, von dem der Generalstaatsanwalt<br />
spricht, die Einschrankung der Kritik<br />
auf die Sachkompetenz des Kenners bei von<br />
wachter sind leicht einzuordnen. Konkretheit<br />
<strong>und</strong> Sarkasmus bei Anwalt Dr. Schwamberger<br />
<strong>und</strong> dem Journalisten Wessei zeigen die Distanz<br />
<strong>und</strong> den ohnmachtigen Zorn der nachsten Generation<br />
gegenüber den alten <strong>und</strong> neuen Etablierten<br />
. Die Stimme des »kleinen Mannes« Fink aus<br />
dem Publikum benennt einen der haufigsten<br />
Schuldausschließungsgründe der Zeit, den Befehlsnotstand,<br />
in der Terminologie des autoritaren<br />
Staates seit der Kaiserzeit gelaufig: bestraft<br />
werden dürfe nicht der »kleine Mann«, der »an<br />
einen Platz gestellt war« . Der Sprache des Militars<br />
entspricht die Vorstellung des Gehorsams.<br />
3. Ambivalenzen der Kritik: Für die frühe<br />
Nachkriegsgeschichte hat sich Mitschertichs<br />
»Unfahigkeit zu trauern« <strong>und</strong> die Annahme der<br />
Verdrangung bei den Nachkriegsdeutschen weitgehend<br />
etabliert. Aus den Positionen des Forums<br />
wird deutlich, daß die kritischen Vorbehalte<br />
gegenüber den Kontinuitaten in der Justiz zusammen<br />
gehen mit einer Exkulpation, Entlastung<br />
von NS-Tatern <strong>und</strong> der Bereitschaft, viele als<br />
Mitlauter <strong>und</strong> letztlich Opfer zu behandeln. Die<br />
bemerkenswerten kritischen Positionen stützen<br />
die Tendenzen zur verbreiteten Selbststilisierung<br />
als Opfer. Der anhaltende Beifall für den<br />
»kleinen Mann« Fink ist nicht zufallig. Zusam-