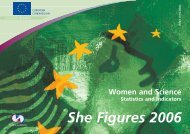Frauenstudien/Genderstudies Sommersemster 1999
Frauenstudien/Genderstudies Sommersemster 1999
Frauenstudien/Genderstudies Sommersemster 1999
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Lehrveranstaltungen<br />
Philosophische Fakultät für Sprachund<br />
Literaturwissenschaft II<br />
Prof. Dr. Erika Greber<br />
Der literarische Salon<br />
Hauptseminar<br />
Institut für<br />
Komparatistik<br />
Schellingstr. 3 / RG<br />
Tel.: 2180-3379<br />
bzw. -3185<br />
Wann?<br />
Mi 13-15<br />
Beginn: 5.5.<br />
Wo?<br />
Raum K 04b<br />
Schellingstr. 3 / RG<br />
Anmeldung<br />
über Listeneintrag<br />
Schellingstr. 7,<br />
Raum 002<br />
Sprechstunde<br />
Mo 14-15<br />
Schellingstr. 7,<br />
Raum 002<br />
Der literarische Salon ist von dem “kulturgeschichtlichen<br />
Randphänomen”, als das er einmal wahrgenommen<br />
wurde, zu einem der Brennpunkte der neueren<br />
kulturwissenschaftlichen Forschung und der Gender<br />
Studies geworden - als eine Kulturinstitution, die dem<br />
Denken, Sprechen und Schreiben von Frauen einen<br />
eigenständigen Platz gab und die androzentrischen<br />
Strukturen der literarischen Kommunikation zu verändern<br />
begann (“von der Salonière zur Schriftstellerin”,<br />
die Frau als Förderin männlicher Talente) sowie<br />
die Literaturgeschichte um subtilere Stilwerte bereicherte<br />
(“Feminisierung” der Sprache); all dies im Rahmen<br />
soziokultureller Verschiebungen zwischen den eher<br />
aristokratischen Salons des 17. und 18. Jahrhunderts<br />
und den eher bürgerlichen des 19. Jahrhunderts, zwischen<br />
Aufklärungsdiskurs und Nationaldiskursen. Das<br />
Seminar befaßt sich mit den Zentren Frankreich und<br />
Deutschland (etwa Mlle de Scudéry, Mme de Staël-<br />
Necker; Rahel Varnhagen, Bettine von Arnim, Dorothea<br />
Schlegel) und schaut auch zu den Rändern Europas<br />
nach Rußland (Jekaterina Karamzina, Zinaida<br />
Volkonskaja, Karolina Pavlova-Jaenisch), evtl. auch<br />
nach England und Skandinavien. Neben der lebendigen<br />
Historie des literarischen Lebens geht es um exemplarische<br />
Textlektüren und theoretische Fragestellungen,<br />
etwa: Gattungsinnovation durch Mündlichkeit<br />
und Konversationalität (jeux d’esprits, Gesprächsspiel,<br />
Briefliteratur), Konzepte der Dialogizität und<br />
kollektiven Autorschaft, Bedeutung von Rollenspiel<br />
und Maskerade (Doing Gender?). Besondere Aufmerksamkeit<br />
gilt dem Salon als Ort der polyglotten<br />
interkulturellen Kommunikation (mehrsprachiges<br />
Schreiben, Übersetzung).<br />
Literatur<br />
Heyden-Rynsch, Verena von der: Europäische Salons.<br />
Höhepunkte einer versunkenen weiblichen Kultur.<br />
München 1992.<br />
Seibert, Peter: Einleitungskapitel, in: Der literarische<br />
Salon. Stuttgart-Weimar 1993.<br />
Böhning, Antje: Der Salon. Ein Raum literarischer<br />
Selbstentfaltung von Frauen?, in: Rundbrief Frauen in<br />
der Literaturwissenschaft 45. 1995, S.28-31.<br />
32