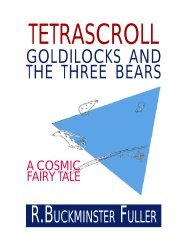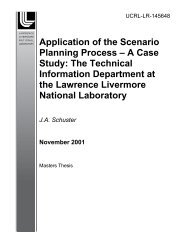mars und die terrestrischen planeten - LAMPSACUS.COM
mars und die terrestrischen planeten - LAMPSACUS.COM
mars und die terrestrischen planeten - LAMPSACUS.COM
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Antrag Schwerpunktprogramm ”Mars <strong>und</strong> <strong>die</strong> <strong>terrestrischen</strong> Planeten”<br />
al., 1998).] So haben <strong>die</strong> exobiologischen Aspekte der Marsforschung derart an Bedeutung gewonnen,<br />
daß sowohl NASA als auch ESA bei (nahezu) allen künftigen Marslandemissionen entsprechende<br />
Experimente durchführen. Allerdings gab es auch vorher schon gewichtige Überlegungen zu Leben<br />
auf dem Mars (<strong>die</strong> canali sind hier nicht angesprochen).<br />
Klimamodelle beschreiben für den Mars Szenarien, <strong>die</strong> eine frühe Feuchtperiode mit darauffolgender<br />
Erkaltung <strong>und</strong> zunehmender Austrocknung enthalten (McKay <strong>und</strong> Davis, 1991). Allerdings werden<br />
sporadisch auftretende Feuchtperioden auch in jüngerer Zeit für möglich gehalten (Baker, et al.,<br />
1991). Es stellt sich daher <strong>die</strong> Frage, in wieweit das Leben über geeignete Adaptationsstrategien verfügt,<br />
um sich den wandelnden Umweltbedingungen anzupassen oder Rückzugsgebiete (endolithische<br />
<strong>und</strong> unterirdische Zonen, hydrothermale Quellen) zu erobern. Terrestrische Beispiele für <strong>die</strong> hohe<br />
Anpassungsfähigkeit der Mikroorganismen an extreme Umweltbedingungen gibt es in großer Zahl:<br />
Tiefbohrungen haben mehrere h<strong>und</strong>ert Meter unter der Oberfläche eine bisher unbekannte Mikrobenwelt<br />
aufgespürt, <strong>die</strong> als sog. Steinfresser allein von chemischer Energie zehren; in Eisbohrkernen der<br />
Antarktis sowie im Permafrost Sibiriens wurden bis zu Tiefen von mehreren Kilometern aktive Mikrobengesellschaften<br />
entdeckt (Friedmann, 1993); in den Felsen kalter <strong>und</strong> heißer Wüsten findet man<br />
endolithische Mikrobengemeinschaften (Siebert <strong>und</strong> Hirsch, 1988; Friedmann, 1993; Wynn-Williams<br />
<strong>und</strong> Edwards, 2000), <strong>die</strong> sich so vor der rauen Umwelt schützen; heiße Quellen (black smokers) sowie<br />
geothermal erhitzte Erdöllagerstätten werden von hyperthermophilen Mikroorganismen besiedelt<br />
(Stetter, 1996). Solche unterirdischen Extrembiotope können als Modellsysteme für mögliche Mars-<br />
Ökosysteme <strong>die</strong>nen <strong>und</strong> wertvolle Hinweise bei der Suche nach Leben auf dem Mars liefern (Horneck,<br />
2000).<br />
Die SNC Meteorite legen den Schluss nahe, dass Material zwischen den <strong>terrestrischen</strong> Planeten ausgetauscht<br />
werden kann (Jagoutz <strong>und</strong> Wänke, 1986). Beim Einschlag eines Meteoriten können Gesteinsbrocken<br />
Fluchtgeschwindigkeit erreichen, wobei vor allem in den Randzonen des Gesteins <strong>die</strong><br />
Temperatur nicht über 100°C steigt (Vickery <strong>und</strong> Melosh, 1987). Bodenbakterien oder endolithische<br />
Mikroben könnten auf <strong>die</strong>se Weise in den Weltraum gelangen. Experimente im Weltraum (Horneck,<br />
1993, Horneck et al., 1994), in Weltraumsimulationsanlagen (Horneck, 2000) sowie darauf basierende<br />
Berechnungen (Mileikowski et al., 2000) haben gezeigt, dass resistente Mikroorganismen in Sporenform<br />
durchaus einen längeren Weltraumaufenthalt überleben können, wenn sie vor der schädlichen<br />
extra<strong>terrestrischen</strong> UV-Strahlung der Sonne geschützt sind (Horneck, et al., 1996).<br />
1.1.9 Entstehung der Planeten<br />
Das Ausgangsmaterial für <strong>die</strong> Sternentstehung sind interstellare Molekülwolken, <strong>die</strong> gravitationsinstabil<br />
werden <strong>und</strong> kollabieren. Zunächst bildet sich durch Gravitationskollaps ein Protostern, der von<br />
einer Scheibe aus Staub <strong>und</strong> Gas umgeben ist. Fast <strong>die</strong> gesamte Materie <strong>die</strong>ser rotierenden Akkretionsscheibe<br />
endet schließlich unter Abgabe von Drehimpuls im Zentralstern, der Sonne. Der kleine<br />
Teil an Materie, der zurück bleibt, in unserem Sonnensystem ca. 0.13 % der Gesamtmasse, bildet das<br />
Ausgangsmaterial für <strong>die</strong> Planeten <strong>und</strong> für kleinere Körper wie <strong>die</strong> Asteroiden, <strong>die</strong> Lieferanten von<br />
Meteoriten.<br />
Während <strong>die</strong> anfängliche Kollapsphase des Sternentstehungsprozesses etwa 1 Ma dauert, werden für<br />
<strong>die</strong> Dauer des solaren Nebels bis zu 10 Ma angenommen. Der solare Nebel ist ein quasistationärer<br />
Zustand der Akkretionsscheibe, wobei dem solaren Nebel bzw. der Akkretionsscheibe von außen <strong>die</strong><br />
gleiche Menge an Materie zugeführt, <strong>die</strong> nach innen an <strong>die</strong> wachsende Sonne abgegeben wird. Der<br />
solare Nebel, <strong>die</strong>se um <strong>die</strong> Sonne rotierende Mischung aus Gas <strong>und</strong> Staub, spielt eine Schlüsselrolle<br />
bei der Entstehung der festen Materie des inneren <strong>und</strong> äußeren Sonnensystems. Aus dem solaren<br />
Nebel sind <strong>die</strong> Planeten <strong>und</strong> <strong>die</strong> anderen kleinen Körper des Sonnensystem entstanden. Unterschiede<br />
in der Struktur <strong>und</strong> der chemischen Zusammensetzung der inneren Planeten sind direkt auf Vorgänge<br />
im frühen solaren Nebel zurückzuführen.<br />
Mikrometer große Teilchen, entweder Kondensationsprodukte des sich abkühlenden solaren Nebels<br />
oder interstellare Staubkörner, sammeln sich bzw. sedimentieren in der Zentralebene der Akkretionsscheibe<br />
<strong>und</strong> wachsen dort durch Zusammenstöße zu Zentimeter großen Objekten, <strong>die</strong> sich dann<br />
durch weitere Kollisionen zu Meter- bzw. Kilometer großen Körpern entwickeln. Haben <strong>die</strong> Gesteinsbrocken<br />
einmal Dimensionen von Kilometern erreicht, so bestimmt <strong>die</strong> Gravitation das weitere<br />
Wachstum. Planeten mit Massen von etwa 10 23 kg (ca. 2% der Erdmasse) entstehen durch rasche<br />
Akkretion lokalen Materials. Es konzentrieren sich also das Gas <strong>und</strong> <strong>die</strong> Teilchen der Akkretionsscheibe,<br />
das ursprünglich gleichmäßig in einer dünnen Scheibe ringförmig um <strong>die</strong> Sonne verteilt war,<br />
zu vergleichsweise wenigen Planetesimalen, <strong>die</strong> "Embryos" genannt werden. Die Entstehung <strong>die</strong>ser<br />
Embryos geschieht sehr rasch, da größere Körper auf Kosten von kleineren wachsen <strong>und</strong> sich so das<br />
Wachstum ständig beschleunigt, bis <strong>die</strong> gesamte zur Verfügung stehende Materie aufgebraucht ist.<br />
14