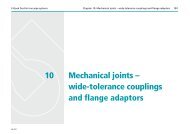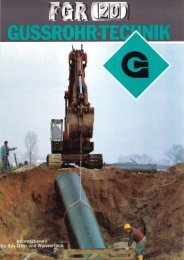PDF-Dokument downloaden - Fachgemeinschaft Guss ...
PDF-Dokument downloaden - Fachgemeinschaft Guss ...
PDF-Dokument downloaden - Fachgemeinschaft Guss ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
anschreiben, worin Cm ein von der Art delr Beanspruohung<br />
und dem Momentenbezugspurnkt abhängiger<br />
Beiwert ist.<br />
(13)<br />
Die lFormel läßt die bhängigkeit von K· und damit<br />
von der Systemsteifig e' SRB erkennen.<br />
f<br />
r den in Bild 1 b gegebenen Belastungsfall wird<br />
Um einen Vergleich mit frü'heren Berechnungsmethod<br />
n zu bekommen, werden die Gleichungen (1) und<br />
(12) herangezogen. Für den angegebenen Fall ist in<br />
(1) b ,- 2 rund rOr ß der Wert 0,125 zu setzen, während<br />
q mit qv i entifiziert wird.<br />
Der Vergleich der Formeln (1) und (12) ergibt darm<br />
!für den Quotienten d'~r Momentenbeiwerte<br />
G = 1 __O~_ 4 (15)<br />
2 (:l RB + 0,066<br />
Bild 3 zeigt den Einfluß der Systemsteifigkeit auf das<br />
IBiegemoment. It ger nger erdender Systemsteifigk<br />
11, d. h. in Ri I tung auf das "weichere" Rohr werden<br />
die Moment im Vergleich zu vorangegangenen<br />
Met oden star reduziert. Dies gilt besonders für<br />
du 1j1, Rohre großer Nennweiten, bei denen die<br />
Systemsteifigkeit • . kleiner als 0,1 ist.<br />
'3.2 Die gleichen Abhängigkeiten finden sich auch bei<br />
der Verformungsberechnung [3-8].<br />
Als Ergebnis ergibt sich für das Verhältnis der Verfm'mungsbeiwerte<br />
G v (neu) und ö/2 (alt)<br />
Cv = 1 = _ 0,,-0•._ (16),<br />
b vRB+O,066<br />
2<br />
wobei die vertikale Durchmesseränderung L'.dv durch<br />
dlie Formel<br />
(17)<br />
mit dem Verformungsbeiwert G v verknüpft ist.<br />
Auch hier zeigt sich der entscheidende Einfluß der<br />
Systemsteifigkeit auf die Deformation des Rohres.<br />
3.3 Auch bei der Ermittlung der Auflasten qv wird ein<br />
teilweise anderer Weg beschritten. Die Auflast qv ist<br />
die Differenz aus der vertikalen Belastung qv und der<br />
horizontalen Belastung Qh.<br />
Diese Annahme stützt sich auf die Tatsache, daß<br />
es einen allseitig angreifenden Belastungsanteil<br />
gibt, der nur vom horizontal wirkenden Erdruhedruck<br />
bestimmt wird, und der in der Rohrwand nur Ringdruckkräfte<br />
erzeugt. qh ist durch den Erdruhedruckboiwert<br />
K mit der nach der Silotheorie ermittelten<br />
Erdlast p verknüpft:<br />
qh ;;;; K . n . P (18)<br />
n ist hierbei der Konzentrationsfaktor für den Bereich<br />
neben dem Rohr.<br />
Die Gesamtbelastung des Rohres q1v' setzt sich aus der<br />
mit einem Konzentrationsfaktor m multiplizierten Erdlast<br />
p und der Verkehrslast Pv zusammen.<br />
qv = m· P + Pv (19)<br />
Der Faktor m berücksichtigt die Lastkonzentration über<br />
dem Rohr; außerdem ist er eine Funktion der überdeckungshöhe<br />
H, der Ausladungsziffer a und der<br />
Grabenbreite B. Der Grenzübergang für B ergibt die<br />
Bedingungen für die in einem Damm verlegte Leitung,<br />
so daß dieser Belastungsfall hier ebenfalls erfaßt ist.<br />
4. Belastungsannahmen 'als Funktion<br />
der System tel' gr 0,1 steife Rohre<br />
SRB < 0,1 weiche Rohre<br />
Bild 2 zeigt jedoch, daß der relatiV große übergangsbereich<br />
0,01 ~ SRB ~ 1, in dem vor allem Rohre aus<br />
duktilem Gußeisen liegen, einer genaueren Analyse<br />
bedarf.<br />
Für Rohre aus duktilem Gußeisen hat sich in Abhängigkeit<br />
von der Systemsteifigkeit folgende Aufteilung<br />
als praktisch erwiesen:<br />
Tabelle 1<br />
Bereich<br />
SRß< 0,01<br />
0,G1 $ SRS