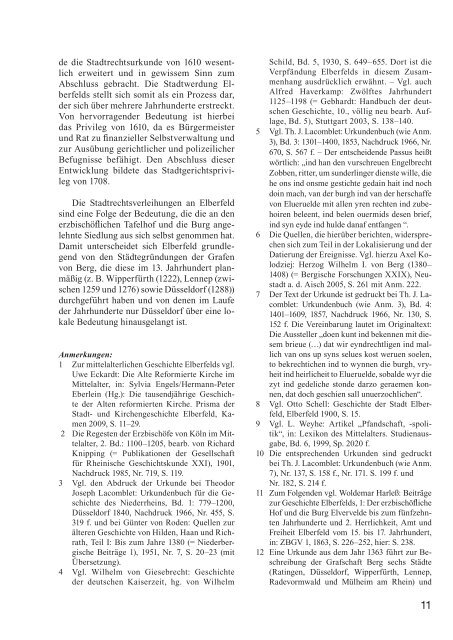Uwe Eckardt: 400 Jahre Stadtrechte Elberfeld. - BGV-Wuppertal
Uwe Eckardt: 400 Jahre Stadtrechte Elberfeld. - BGV-Wuppertal
Uwe Eckardt: 400 Jahre Stadtrechte Elberfeld. - BGV-Wuppertal
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
de die Stadtrechtsurkunde von 1610 wesentlich<br />
erweitert und in gewissem Sinn zum<br />
Abschluss gebracht. Die Stadtwerdung <strong>Elberfeld</strong>s<br />
stellt sich somit als ein Prozess dar,<br />
der sich über mehrere Jahrhunderte erstreckt.<br />
Von hervorragender Bedeutung ist hierbei<br />
das Privileg von 1610, da es Bürgermeister<br />
und Rat zu finanzieller Selbstverwaltung und<br />
zur Ausübung gerichtlicher und polizeilicher<br />
Befugnisse befähigt. Den Abschluss dieser<br />
Entwicklung bildete das Stadtgerichtsprivileg<br />
von 1708.<br />
Die Stadtrechtsverleihungen an <strong>Elberfeld</strong><br />
sind eine Folge der Bedeutung, die die an den<br />
erzbischöflichen Tafelhof und die Burg angelehnte<br />
Siedlung aus sich selbst genommen hat.<br />
Damit unterscheidet sich <strong>Elberfeld</strong> grundlegend<br />
von den Städtegründungen der Grafen<br />
von Berg, die diese im 13. Jahrhundert planmäßig<br />
(z. B. Wipperfürth (1222), Lennep (zwischen<br />
1259 und 1276) sowie Düsseldorf (1288))<br />
durchgeführt haben und von denen im Laufe<br />
der Jahrhunderte nur Düsseldorf über eine lokale<br />
Bedeutung hinausgelangt ist.<br />
Anmerkungen:<br />
1 Zur mittelalterlichen Geschichte <strong>Elberfeld</strong>s vgl.<br />
<strong>Uwe</strong> <strong>Eckardt</strong>: Die Alte Reformierte Kirche im<br />
Mittelalter, in: Sylvia Engels/Hermann-Peter<br />
Eberlein (Hg.): Die tausendjährige Geschichte<br />
der Alten reformierten Kirche. Prisma der<br />
Stadt- und Kirchengeschichte <strong>Elberfeld</strong>, Kamen<br />
2009, S. 11–29.<br />
2 Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter,<br />
2. Bd.: 1100–1205, bearb. von Richard<br />
Knipping (= Publikationen der Gesellschaft<br />
für Rheinische Geschichtskunde XXI), 1901,<br />
Nachdruck 1985, Nr. 719, S. 119.<br />
3 Vgl. den Abdruck der Urkunde bei Theodor<br />
Joseph Lacomblet: Urkundenbuch für die Geschichte<br />
des Niederrheins, Bd. 1: 779–1200,<br />
Düsseldorf 1840, Nachdruck 1966, Nr. 455, S.<br />
319 f. und bei Günter von Roden: Quellen zur<br />
älteren Geschichte von Hilden, Haan und Richrath,<br />
Teil I: Bis zum <strong>Jahre</strong> 1380 (= Niederbergische<br />
Beiträge 1), 1951, Nr. 7, S. 20–23 (mit<br />
Übersetzung).<br />
4 Vgl. Wilhelm von Giesebrecht: Geschichte<br />
der deutschen Kaiserzeit, hg. von Wilhelm<br />
Schild, Bd. 5, 1930, S. 649–655. Dort ist die<br />
Verpfändung <strong>Elberfeld</strong>s in diesem Zusammenhang<br />
ausdrücklich erwähnt. – Vgl. auch<br />
Alfred Haverkamp: Zwölftes Jahrhundert<br />
1125–1198 (= Gebhardt: Handbuch der deutschen<br />
Geschichte, 10., völlig neu bearb. Auflage,<br />
Bd. 5), Stuttgart 2003, S. 138–140.<br />
5 Vgl. Th. J. Lacomblet: Urkundenbuch (wie Anm.<br />
3), Bd. 3: 1301–1<strong>400</strong>, 1853, Nachdruck 1966, Nr.<br />
670, S. 567 f. – Der entscheidende Passus heißt<br />
wörtlich: „ind han den vurschreuen Engelbrecht<br />
Zobben, ritter, um sunderlinger dienste wille, die<br />
he ons ind onsme gestichte gedain hait ind noch<br />
doin mach, van der burgh ind van der herschaffe<br />
von Elueruelde mit allen yren rechten ind zubehoiren<br />
beleent, ind belen ouermids desen brief,<br />
ind syn eyde ind hulde danaf entfangen “.<br />
6 Die Quellen, die hierüber berichten, widersprechen<br />
sich zum Teil in der Lokalisierung und der<br />
Datierung der Ereignisse. Vgl. hierzu Axel Kolodziej:<br />
Herzog Wilhelm I. von Berg (1380–<br />
1408) (= Bergische Forschungen XXIX), Neustadt<br />
a. d. Aisch 2005, S. 261 mit Anm. 222.<br />
7 Der Text der Urkunde ist gedruckt bei Th. J. Lacomblet:<br />
Urkundenbuch (wie Anm. 3), Bd. 4:<br />
1401–1609, 1857, Nachdruck 1966, Nr. 130, S.<br />
152 f. Die Vereinbarung lautet im Originaltext:<br />
Die Aussteller „doen kunt ind bekennen mit diesem<br />
brieue (…) dat wir eyndrechtligen ind mallich<br />
van ons up syns selues kost weruen soelen,<br />
to bekrechtichen ind to wynnen die burgh, vryheit<br />
ind heirlicheit to Elueruelde, sobalde wyr die<br />
zyt ind gedeliche stonde darzo geraemen konnen,<br />
dat doch geschien sall unuerzochlichen“.<br />
8 Vgl. Otto Schell: Geschichte der Stadt <strong>Elberfeld</strong>,<br />
<strong>Elberfeld</strong> 1900, S. 15.<br />
9 Vgl. L. Weyhe: Artikel „Pfandschaft, -spolitik“,<br />
in: Lexikon des Mittelalters. Studienausgabe,<br />
Bd. 6, 1999, Sp. 2020 f.<br />
10 Die entsprechenden Urkunden sind gedruckt<br />
bei Th. J. Lacomblet: Urkundenbuch (wie Anm.<br />
7), Nr. 137, S. 158 f., Nr. 171. S. 199 f. und<br />
Nr. 182, S. 214 f.<br />
11 Zum Folgenden vgl. Woldemar Harleß: Beiträge<br />
zur Geschichte <strong>Elberfeld</strong>s, 1: Der erzbischöfliche<br />
Hof und die Burg Elvervelde bis zum fünfzehnten<br />
Jahrhunderte und 2. Herrlichkeit, Amt und<br />
Freiheit <strong>Elberfeld</strong> vom 15. bis 17. Jahrhundert,<br />
in: Z<strong>BGV</strong> 1, 1863, S. 226–252, hier: S. 238.<br />
12 Eine Urkunde aus dem Jahr 1363 führt zur Beschreibung<br />
der Grafschaft Berg sechs Städte<br />
(Ratingen, Düsseldorf, Wipperfürth, Lennep,<br />
Radevormwald und Mülheim am Rhein) und<br />
11