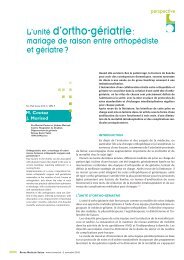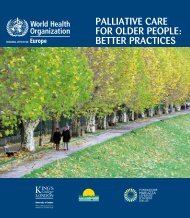Gerontologie+ Geriatrie - SGG-SSG
Gerontologie+ Geriatrie - SGG-SSG
Gerontologie+ Geriatrie - SGG-SSG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abstracts<br />
wünsche oder Unsicherheiten bezüglich des zukünftigen Wohnortes<br />
stehen jedoch in keinem Verhältnis zu den realisierten Remigrationen<br />
(Haug 2000). Entweder wurde die Rückkehr durch äußere Gründe verhindert<br />
oder aber jene Migranten brachten mit ihrem Rückkehrwunsch<br />
etwas anderes zum Ausdruck als eben den Wunsch nach einer Rückkehr.<br />
Ausgehend von dieser Überlegung wurde der Forschungsstand<br />
systematisch analysiert. Auf der Basis des Lebenslagekonzeptes (Backes,<br />
Clemens 2000) konnten verschiedene Lebenslageveränderungen<br />
ausfindig gemacht werden, die die gewünschte Rückkehr verhinderten.<br />
Zentral war die Entscheidung der Kinder in Deutschland zu bleiben.<br />
Einige ältere, türkische Migranten brachten darüber hinaus mit der<br />
Äußerung eines Rückkehrwunsches ihren Wunsch danach zum Ausdruck<br />
bringen, im Alter so behandelt zu werden, wie sie es von der türkischen<br />
Gemeinschaft erwarten. Darüber hinaus zeigte sich, dass die<br />
Verbalisierung eines Rückkehrwunsches sich in einigen Migrantengemeinschaften<br />
zu einer Konvention entwickelt hat (Weber 1922), deren<br />
Nichterfüllung den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Migranten<br />
bedeuten kann. Die Pendelmigration kann möglicherweise einen Kompromiss<br />
zwischen diesen Wünschen, Möglichkeiten und Verpflichtungen<br />
darstellen.<br />
0336<br />
Die Demenz im Krankenhaus (II) – Angehörigenarbeit<br />
H.G. Nehen<br />
Elisabeth Krankenhaus Essen, <strong>Geriatrie</strong>zentrum Haus Berge, Essen,<br />
Deutschland<br />
Dargestellt wird die Situation der pflegenden Angehörigen im zeitlichen<br />
Verlauf einer Demenzerkrankung. Kriterien zur Definition einer<br />
„Pflegekrankheit „ werden beschrieben.<br />
0340<br />
Definitionen und Erfassungsmethoden von Stürzen mit Verletzungsfolge:<br />
ein systematisches Review randomisierter, kontrollierter<br />
Studien im Bereich Sturzprävention<br />
*K. Hauer, A. Lauenroth, C. Stock, R. Rodrigues-Moreno, P. Oster, C. Todd,<br />
G. McHugh, M. Schwenk<br />
Bethanien-Krankenhaus/Geriatrisches Zentrum an der Universität Heidelberg,<br />
Forschungsabteilung, Heidelberg, Deutschland<br />
Hintergrund. Internationale Leitlinien geben Empfehlungen zur Standardisierung<br />
bei Sturzereignissen als Grundlage und Voraussetzung<br />
für Meta-Analysen; Stürze mit Verletzungsfolge blieben dabei jedoch<br />
bislang unberücksichtigt. Ziel war die Dokumentation von verwendete<br />
Untersuchungsmethoden und Definitionen von Stürzen mit Verletzungsfolge<br />
in randomisierten, kontrollierten Studien (RCTs) zur Sturzprävention<br />
und Entwicklung einer Neudefinition von Stürzen nach<br />
konsensfähigen Schädigungskriterien.<br />
Methodik. Studiendesign: systematisches Review. Zur Identifizierung<br />
von RCTs wurde eine elektronische Literatursuche in verschiedenen<br />
Datenbanken durchgeführt. Einschlusskriterien: RCT im Bereich<br />
Sturzprävention, englischsprachige Veröffentlichung, Probanden<br />
≥65 Jahre, definierter Sturz mit Verletzungsfolge als Studienendpunkt<br />
unter der Verwendung der Termini „Injurious“ und „Falls“.<br />
Ergebnisse. Die Literatursuche ergab 2102 Artikel (Ausschluss nach<br />
definierten Einschlusskriterien: n=2061, Einschluss: n=41 Artikel). Die<br />
Analyse zeigt eine hohe Varianz sowohl bei verwendeten Definitionen,<br />
als auch eine unterschiedliche Erfassung von Sturzereignissen mit Verletzungsfolge.<br />
Die begrenzte Standardisierung mindert maßgeblich die<br />
Vergleichbarkeit von Studienergebnissen. Die Anwendung einer standardisierten<br />
Definition in einer Subgruppe der untersuchten RCTs zeigt<br />
eine deutlich geringere Varianz der dokumentierten Sturz-Inzidenz.<br />
Schlussfolgerung. Es wird eine neue Sturzdefinition vorgestellt, die<br />
Studienergebnisse vergleichbar macht und eine Metaanalyse von epidemiologischen<br />
und interventionellen Untersuchungsansätzen erlaubt.<br />
(Publikation der Ergebnisse in Schwenk et al 2012).<br />
0341<br />
Wie eine allgemeinmedizinisch konzipierte Aufnahmestation im<br />
Albertinen-Krankenhaus in Hamburg die Versorgung insbesondere<br />
alter Menschen verbessert und der hausärztlichen geriatrischen<br />
Nachwuchsförderung dient<br />
M. Groening<br />
Albertinen-Krankenhaus, Notaufnahme/INKA, Hamburg, Deutschland<br />
Die Patientenzahlen in deutschen Notaufnahmen steigen. Im Albertinen-Krankenhaus<br />
hat sich die Zahl der alten Patienten in der ZNA in<br />
5 Jahren verdoppelt. Wohin mit denjenigen alten Patienten, die keiner<br />
Fachabteilung eindeutig zuzuordnen sind und keiner hochtechnischen,<br />
aber dennoch einer kurzen stationären Behandlung bedürfen? Betten<br />
werden knapper, die Medizin spezialisierter. In den Abteilungen sind<br />
sie ohne Diagnostik Fehlbelegungen (DRG) und mit Diagnostik überdiagnostiziert.<br />
Als Lösung wurde als Organisationseinheit mit der<br />
ZNA die allgemeinmedizinisch konzipierte „interdisziplinäre Notfall<br />
und Kurzlieger Aufnahmestation INKA“ gegründet. 21 INKA-Betten<br />
haben 2011 fast 2800 ZNA-Patienten aufgenommen. Mehr als 2000 waren<br />
über 70 Jahre, die größte Gruppe war die der 80- bis 90-Jährigen.<br />
1550 wurden nach einer mVD von 2,5 Tagen entlassen (als kurzstationäre<br />
Notfallversorgung mit geriatrischem Schwerpunkt), der Rest verlegt,<br />
insbesondere in die <strong>Geriatrie</strong>. Die Verbindung zur <strong>Geriatrie</strong> ist eng<br />
(tägliche geriatrische Konsiliarvisite, geriatrische Rotationsassistenten).<br />
Dies bewahrt alte Menschen vor Überdiagnostik, ist eine „sanfte“ Form<br />
der Priorisierung und trotzdem qualitätsverbessernd. Die INKA verhindert<br />
Fehlbelegungen der Fachabteilungen (auch der <strong>Geriatrie</strong>) und<br />
steigert die Gesamtfallzahl des Krankenhauses. Sie ist wirtschaftlich,<br />
da sie keine Funktionsabteilung hat und mit niedrigem CMI kalkuliert.<br />
Durch die allgemeinmedizinische Leitung haben sich zahlreiche Assistenten<br />
für den Facharzt für Allgemeinmedizin entschieden und sind im<br />
Verlauf zur Erlangung der Zusatzbezeichnung <strong>Geriatrie</strong> in die <strong>Geriatrie</strong><br />
gewechselt. Die INKA hilft somit, dass gesellschaftspolitische Ziel<br />
„mehr (Allgemein-)Ärzte mit <strong>Geriatrie</strong>kompetenz“ zu erreichen.<br />
0342<br />
Altern im Wandel – Lebensverläufe und künftiges Alter der Babyboomer<br />
*A. Motel-Klingebiel 1 , J. Simonson 1 , M.M. Grabka 2<br />
1<br />
Deutsches Zentrum für Altersfragen (DZA), Berlin, Deutschland, 2 Deutsches<br />
Institut für Wirtschaftforschung (DIW), Berlin, Deutschland<br />
Die Lebensphase Alter und die Lebenssituationen älterer Menschen befinden<br />
sich im Wandel. Lebenssituationen im Alter basieren wesentlich<br />
auf vorangegangenen Lebensverläufen. Erwerbs- und Familienverläufe<br />
sind in einem Wandel begriffen, der mit zunehmender Inhomogenität<br />
und fortschreitender Pluralität beschrieben werden kann. Wie sich die<br />
zunehmende Vielfalt und Inhomogenität von Lebensverläufen auf die<br />
zukünftige Lebenssituation im Alter und die soziale Sicherung auswirken<br />
wird, ist allerdings weithin unbeantwortet und steht im Zentrum<br />
dieses Symposiums. Die heute an der Schwelle zur Lebensphase Alter<br />
stehende Kohorte ist die der deutschen Babyboomer, die als erste Kohorte<br />
seit ihrer Geburt vom Ausbau des Wohlfahrtsstaates und der<br />
Bildungsexpansion profitierten. In wirtschaftlicher Prosperität und<br />
politischer Stabilität aufgewachsen, dann aber durch zunehmende gesellschaftliche<br />
Krisen begleitet, entsprechen ihre Lebensverläufe nur<br />
noch selten einer modellhaften „Normalbiographie“. Die Veränderungen<br />
in den Lebensverläufen sind verbunden mit tiefgreifenden Ver-<br />
76 | Zeitschrift für Gerontologie und <strong>Geriatrie</strong> · Supplement 1 · 2012