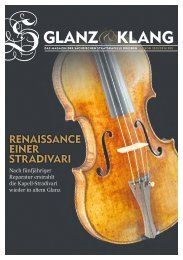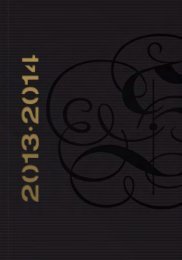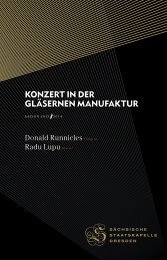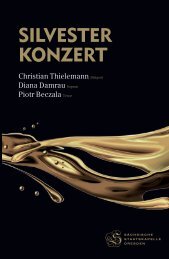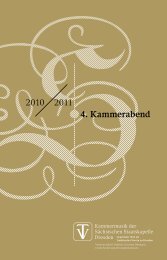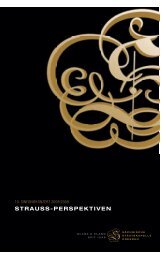4. Symphoniekonzert - Staatskapelle Dresden
4. Symphoniekonzert - Staatskapelle Dresden
4. Symphoniekonzert - Staatskapelle Dresden
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Maurice ravel am Klavier mit Vaslav Nijinsky (Paris, 1911)<br />
Gegenwelt zu der urbanen Eleganz Das G-Dur-Konzert ist ein sehr<br />
des Seitenthemas, und wenn es schwieriges Werk, vor allem wegen<br />
nicht ins Baskenland verweist, dann des zweiten Satzes, wo der Solist<br />
zurück in die märchenhaften Gefilde<br />
der »Ballets russes« im Paris Ich sprach mit Ravel über meine<br />
keine einzige Ruhepause hat.<br />
um 1912, zu Ravels eigenen Kompositionen<br />
oder zu Igor Strawinskys vollen und brillant orchestrierten<br />
Furcht, nach dem so phantasie-<br />
Märchenfigur Petruschka.<br />
ersten Satz auf dem Piano allein die<br />
Der zweite Satz dagegen Kantabilität der Melodie während<br />
entführt in die zurückgezogene, einer so ausgedehnten und langsam<br />
stille Welt eines Zimmers. Das Orchester<br />
schweigt und das Klavier ren zu können. »Diese fließende<br />
fließenden Phrase nicht fortfüh-<br />
spielt eine raffiniert einfache Musik, Phrase!«, rief Ravel. »Wie habe ich<br />
aus der Wolfgang Amadeus Mozart daran gearbeitet, Takt für Takt! Ich<br />
und Erik Satie gleichermaßen grüßen.<br />
Die erste Hälfte dieses Kla-<br />
bin fast daran verzweifelt!«<br />
viersolos ist wieder rein diatonisch, Marguerite Long<br />
erst dann treten sehr sparsam Versetzungszeichen<br />
dazu. Die Melodie entwickelt sich zunächst ganz engräumig,<br />
traumverloren, wie tastend. Verfremdend wirkt die Begleitung, in der,<br />
wenn man die Vorstellung einer traumartigen Atmosphäre ernst nimmt, der<br />
Freud’sche Begriff der Verschiebung ganz wörtlich genommen erfahrbar<br />
wird. Das vertraute Muster »um-ta-ta, um-ta-ta« erscheint hier ganz schematisch<br />
durchgeführt, aber gegenüber der Melodie konsequent verschoben<br />
und durch Ravels ungewöhnliche Notation nochmals verunklart.<br />
Im Schlusssatz wird mit einem Trommelwirbel die Stimmung des<br />
ersten Satzes wieder aufgenommen. Das Klavier setzt mit virtuosen Fanfaren<br />
ein, es dominieren kleine rhythmische Zellen wie im Eingangssatz, ein<br />
perkussiver Impuls ergreift Klavier und Orchester. Hörner und Trompeten<br />
erinnern an Gesten der Jagdmusik, so dass nach den Straßen der Großstadt<br />
und der Zurückgezogenheit des Zimmers jetzt eine von fröhlichen Menschen<br />
belebte Naturszenerie heraufbeschworen wird. Ravel nannte sein<br />
G-Dur-Konzert »ein Konzert im echten Sinne des Wortes: ich meine damit,<br />
dass es im Geiste der Konzerte von Mozart und Saint-Saëns geschrieben<br />
ist. Eine solche Musik sollte meiner Meinung nach aufgelockert und brillant<br />
sein und nicht auf Tiefe und dramatische Effekte abzielen. Man hat von<br />
bestimmten großen Klassikern behauptet, ihre Konzerte seien nicht ›für‹,<br />
sondern ›gegen‹ das Klavier geschrieben. Dem stimme ich gern zu. Ich hatte<br />
eigentlich die Absicht, dieses Konzert mit ›Divertissement‹ zu betiteln. Dann<br />
aber meinte ich, dafür liege keine Notwendigkeit vor, weil eben der Titel<br />
›Concerto‹ hinreichend deutlich sein dürfte.«<br />
<br />
Martin Wilkening<br />
22 23 <strong>4.</strong> SYMPHONIEKONZERT