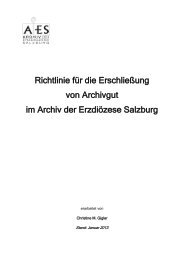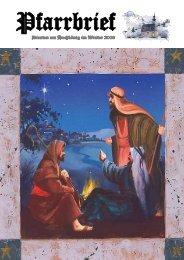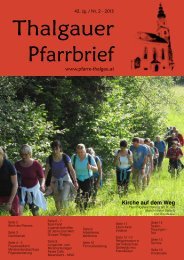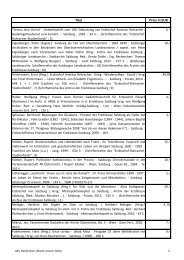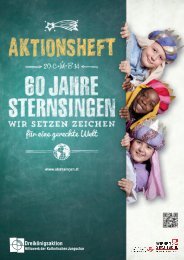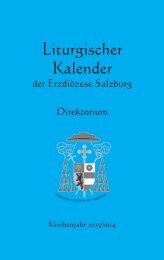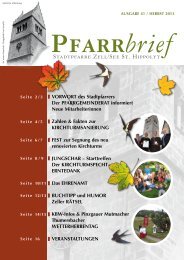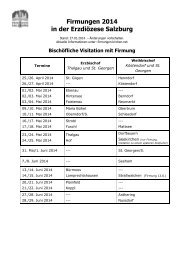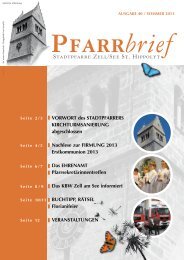PS „Karolingische und romanische Salzburger Buchmalerei“
PS „Karolingische und romanische Salzburger Buchmalerei“
PS „Karolingische und romanische Salzburger Buchmalerei“
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die deutschsprachige Forschung unterscheidet seit dem 19. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />
zwischen südlichem oder italienischem Pergament. Bei diesem blieb die<br />
natürliche Hautmusterung der Narben unangetastet. Beim nördlichem oder<br />
deutschem Pigment wurde die Hautmusterung mehr oder weniger stark<br />
entfernt. Der Pergamenter bezeichnet die anatomisch außen gelegene <strong>und</strong> bei<br />
der Arbeit zuerst behandelte Haarseite Narben oder Vorderseite. Die<br />
Fleischseite mit Innen oder Rückseite. Umgekehrt dagegen nennt der<br />
Historiker die sorgfältig zur Beschriftung vorbereitete Fleischseite Vorderseite.<br />
Die weniger gut bearbeitete Haarseite Rückseite.<br />
5. Tinten<br />
Der mittelalterliche Schreiber benötigte neben Vogelfeder <strong>und</strong> Tinte noch<br />
weitere Schreibstoffe. Zur Linierung diente entweder ein Griffel, bei dem keine<br />
Linien, sondern nur Rillen im Pergament sichtbar wurden (sog. Blindlinierung),<br />
ein Metallstift (Bleistift) oder ein Rötelstift. Tinte auch im Spätmittelalter. Für<br />
die Linierung wurde weiters ein punctorium, d. h. ein Zirkel oder ein Rädchen<br />
mit Spitzen benötigt. Mit diesem wurden am Blattrand kleine Löcher zur<br />
Adjustierung des Lineals gemacht. Neben Feder <strong>und</strong> Radiermesser gehörten<br />
auch ein oder zwei Tintenhörnchen zur Ausrüstung eines Schreibers: eines für<br />
schwarze oder braune Tinte <strong>und</strong> eines für die rote Tinte , mit der die einzelne<br />
Buchstaben oder Worte hervorgehoben wurden.<br />
Schon in der Antike gab es mehrere Rezepturen für die Herstellung von Tinte<br />
(atramentum, incaustum): Sie basierten auf Ruß <strong>und</strong> Gummi, andere auf Sepia<br />
(Tintenfisch) andere wiederum auf Galläpfeln <strong>und</strong> Eisenvitriol. Besonders<br />
letztere Tinten fraßen sich allerdings im Laufe der Jahrh<strong>und</strong>erte häufig durch<br />
den Beschreibstoff, sodass heute nicht mehr die Schrift, sondern die Löcher<br />
„lesbar“ sind. Die Tinte ist je nach Rezeptur tiefschwarz, bräunlich, teilweise<br />
auch olivgrün oder grau.<br />
Schwarze Tinten der Antike <strong>und</strong> des Mittelalters haben weniger gute<br />
Eigenschaften als die braune Dornentinte. Rußtinten wurden schon seit dem 3.<br />
Jahrtausend v. Chr. verwendet. Plinius gibt Ruß <strong>und</strong> Gummi als Bestandteile<br />
an. Diese Tinten sind lichtecht <strong>und</strong> sehr feuchtigkeits empfindlich. Seit Mitte