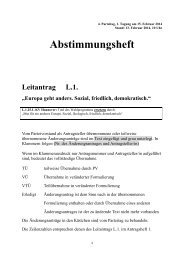Tobias J. Knoblich: »Zwischen Kreativität und Kulturinfarkt - Die Linke
Tobias J. Knoblich: »Zwischen Kreativität und Kulturinfarkt - Die Linke
Tobias J. Knoblich: »Zwischen Kreativität und Kulturinfarkt - Die Linke
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kulturpolitik neu denken – Neue Ansätze in der Kulturförderung. Kulturkonferenz der<br />
Ständigen Kulturpolitischen Konferenz der Partei DIE LINKE. am 31. Mai 2013 in Berlin<br />
Einstiegsreferat <strong>Tobias</strong> J. <strong>Knoblich</strong> (Vizepräsident der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.)<br />
"Zwischen <strong>Kreativität</strong> <strong>und</strong> <strong>Kulturinfarkt</strong>: Was heißt heute konzeptbasierte Kulturpolitik <strong>und</strong> was<br />
kann sie leisten?"<br />
Liebe Frau Mühlberg, meine sehr geehrten Damen <strong>und</strong> Herren. Ich bedanke mich ganz herzlich für die<br />
Einladung. Ich will noch sagen, warum ich eher gehen muss, obwohl ich sehr gerne noch zur<br />
Diskussion geblieben wäre. Wir haben in Erfurt zurzeit das Deutsche Kinder-Medien-Festival<br />
"Goldener Spatz", in dessen Trägerstiftung ich den Oberbürgermeister im Präsidium vertrete, <strong>und</strong><br />
heute findet die große Abschlussveranstaltung statt. Der OB hat mich kurzfristig gebeten, für ihn<br />
einzuspringen, so dass ich um 13.00 Uhr sein Grußwort im Theater Erfurt überbringen darf. Ich bitte<br />
dafür um Verständnis.<br />
Mein Titel ist ein wenig sperrig: "Zwischen <strong>Kreativität</strong> <strong>und</strong> <strong>Kulturinfarkt</strong>: Was heißt heute<br />
konzeptbasierte Kulturpolitik <strong>und</strong> was kann sie leisten?". Ich will versuchen – weil es ja ein Einstieg für<br />
die Tagung sein soll, die Sie heute haben – ein paar wesentliche Debatten nachzuzeichnen, die uns<br />
gerade bewegen in Deutschland, teilweise auch darüber hinaus. Dann möchte ich andeuten, welche<br />
neue Fachlichkeit es zum Kulturbereich gibt, die mit diesen Debatten entweder gegenläufig sind oder<br />
mit diesen korrespondieren, um dann in einem dritten Schritt zu zeigen, welche Möglichkeiten <strong>und</strong><br />
Grenzen sich für konzeptbasierte Kulturpolitik daraus ergeben <strong>und</strong> was überhaupt konzeptbasierte<br />
Kulturpolitik in meinem Verständnis heißen soll.<br />
I.<br />
Zwischen <strong>Kreativität</strong> <strong>und</strong> <strong>Kulturinfarkt</strong>, so will ich das erste Kapitel einmal überschreiben <strong>und</strong> auf zwei<br />
Bücher hinweisen, die im vergangenen Jahr erschienen sind <strong>und</strong> die kulturpolitische Debatte<br />
angeheizt <strong>und</strong> zu sehr kontroversen Debatten geführt haben. Das eine haben Sie bestimmt alle<br />
gelesen – das Buch "Der <strong>Kulturinfarkt</strong>". Es gibt kein kulturpolitisches Buch, das im Verkauf jemals so<br />
erfolgreich gewesen ist, wie dieses. <strong>Die</strong> Autoren haben mehr davon verkauft als die Kulturpolitische<br />
Gesellschaft seit ihrem Bestehen mit allen Büchern zusammen. Das finde ich schon sehr<br />
bemerkenswert, das heißt, man kann mit Kulturpolitik durchaus auch Geld verdienen.<br />
Der <strong>Kulturinfarkt</strong> ist eine Streitschrift, eine Polemik, die sich mit dem Kulturstaat, der Kulturförderung,<br />
überhaupt mit Subventionen <strong>und</strong> wohlfahrtsstaatlichen Axiomen auseinandersetzt; es ist natürlich<br />
inspiriert von Vorgängerbüchern. Eines davon ist „Der exzellente Kulturbetrieb“ von Armin Klein, mit<br />
dem dieser schon einmal aufgezeigt hatte, wohin ein Umdenken führen sollte, nämlich dass man auch<br />
den Betriebscharakter von Kultureinrichtungen stärker fördern sollte, dass man Mitarbeiterführung <strong>und</strong><br />
Mitarbeiterentwicklung betreiben, also den „Wissensmitarbeiter“ in den Blick nehmen muss, dass es<br />
um die Mehrdimensionalität von Finanzierungsstrategien <strong>und</strong> um die Kraft von Zukunftsbildern geht,<br />
die zu produzieren man nicht anderen überlassen darf. Wer entwirft eigentlich die Perspektiven <strong>und</strong><br />
welchen Anteil daran hat der öffentliche Kulturbetrieb? All das <strong>und</strong> vieles mehr hat Armin Klein dort<br />
aufgearbeitet. Das Buch ist zwar nun auch in zweiter oder dritter Auflage erschienen, aber hat –<br />
vielleicht weil es aus meiner Sicht sein bestes Buch bisher ist – bei weitem nicht diesen Protest<br />
ausgelöst wie der <strong>Kulturinfarkt</strong>. Ein anderes Buch, dessen Einfluss man spüren kann, ist Hans<br />
Abbings "Why are artists poor?", ein Buch, in dem Abbing versucht, die Gr<strong>und</strong>lagen der besonderen<br />
Ökonomie von Kunst <strong>und</strong> Künstlern darzustellen <strong>und</strong> zu zeigen, dass für diese der Markt immer etwas<br />
ganz schwieriges, etwas ganz schlechtes, verderbliches ist, der die Kunst <strong>und</strong> das Handeln der<br />
Künstler „kontaminiert“, <strong>und</strong> dass sie auf der anderen Seite natürlich von der öffentlichen Hand leben<br />
können, die eine Kulisse bietet, die es ganz, ganz vielen Künstlern – mehr als jemals in der<br />
Geschichte zuvor – ermöglicht, sich im System zu halten <strong>und</strong> mehr oder minder gut im Status zu<br />
bleiben. Das führt aus seiner Sicht erst dazu, dass es diese breite Debatte um Kunstförderung gibt<br />
<strong>und</strong> die Frage danach, wie man Künstlern „ihr Leben“ sichern, wie der Staat seine<br />
Sozialgestaltungsmacht wahrnehmen kann <strong>und</strong> soll. Und er sagt, das Problem ist eigentlich die<br />
Kulturpolitik, die Kunstförderung selbst, sie erst erzeuge eine Schieflage <strong>und</strong> strukturelle Armut. <strong>Die</strong>se<br />
beiden Bücher sind ganz wesentliche Gr<strong>und</strong>lagen für diesen „<strong>Kulturinfarkt</strong>“, der natürlich alles zuspitzt<br />
<strong>und</strong> unter anderem die weitreichende These vertritt, dass die Geschichte des Kulturstaats die<br />
Geschichte einer permanenten politischen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Kompensation sei, dass das<br />
aufklärerische Diktum, den Menschen durch Kultur zu bessern, durch breite Teilhabe eine Wohlfahrt<br />
1
insgesamt zu stimulieren, im Kern autoritär <strong>und</strong> etatistisch sei, ja dass „Kulturhoheit“ ein hoheitliches<br />
Handeln des Staates bedeute <strong>und</strong> im Kulturbereich eigentlich gar nichts zu suchen habe.<br />
Aus Sicht der Infarkt-Autoren sind dies alles Prozesse, die zur Zementierung eines Status Quo<br />
beitragen. <strong>Die</strong>s solle nunmehr alles aufhören, man solle Kulturgüter <strong>und</strong> Institutionen verknappen, die<br />
Infrastruktur halbieren, neue Finanzierungsmodelle finden, mehr Markt zulassen, weniger Kanon<br />
festschreiben <strong>und</strong> von den Nutzern her denken. Letzteres ist auch ein Aspekt, den Klein sehr zu<br />
Recht, wie ich meine, in seinem „Exzellenten Kulturbetrieb“ stark gemacht hatte. Alles ist sicher<br />
nachdenkenswert, aber vielleicht nicht in dieser Melange, in der es für viele ungenießbar schien. Das<br />
Buch, das vor Erscheinen zunächst den Arbeitstitel "Aufräumen" trug, geht ja auf eine Tagung der<br />
Kulturpolitischen Gesellschaft zurück, wo die Autoren zum Teil anwesend waren; aus diesem<br />
"Aufräumen" ist dann der "Infarkt" geworden (oder der Verlag hat es so zugespitzt, um den Verkauf<br />
anzukurbeln). <strong>Die</strong>ses "Aufräumen" ist im Kern ja nicht verkehrt. Wir wissen andererseits, dass es auch<br />
andere Bücher gab, die Kulturpolitikgeschichte geschrieben haben <strong>und</strong> die Polemik nutzten, um<br />
Aufmerksamkeit zu erlangen: Alexander Mitscherlichs explizite „Anstiftung zum Unfrieden“, „<strong>Die</strong><br />
Unwirtlichkeit der Städte“, gehört dazu.<br />
Der <strong>Kulturinfarkt</strong> stellt im Gr<strong>und</strong>e genommen die gewachsene kulturelle Infrastruktur <strong>und</strong> das gesamte<br />
Setting unseres kulturpolitischen Handelns nachdrücklich in Frage <strong>und</strong> sagt eigentlich primär, der<br />
Nutzer wird es schon richten, der Markt wird es schon richten, <strong>und</strong> wir müssen im Gr<strong>und</strong>e genommen<br />
diese wettbewerbsbefreiten Zonen, die meritorischen Güter im Kulturbereich, präziser definieren <strong>und</strong><br />
nach deren Berechtigung fragen. Das Nachdenkenswerte am Buch wird durch die Verkürzung <strong>und</strong><br />
Überzeichnung für viele ungenießbar.<br />
Das andere Buch, das mit dem vermeintlichen <strong>Kulturinfarkt</strong> durchaus korrespondiert, ist ein Buch, das<br />
man auch „Der Kreativinfarkt“ titulieren könnte: "<strong>Die</strong> Entstehung der <strong>Kreativität</strong>" von Andreas<br />
Reckwitz, das ebenfalls ein Bestseller zu werden verspricht. Im Untertitel heißt es "Zur Ästhetisierung<br />
gesellschaftlicher Prozesse". Ein sehr kluges Buch von einem Kultursoziologen aus Frankfurt/Oder,<br />
das er auf einer Tagung in Loccum kürzlich vorgestellt hat. Er hat dort einen Vortrag dazu gehalten<br />
<strong>und</strong> kulturpolitische Thesen gebracht; dieses Buch ist wesentlich differenzierter <strong>und</strong> spielt in einer<br />
anderen wissenschaftlichen Liga als der "<strong>Kulturinfarkt</strong>", das will ich gleich zur Ehrenrettung von<br />
Reckwitz vorab sagen. Kulturpolitisch forschende Soziologen <strong>und</strong> Wissenschaftler angrenzender<br />
Disziplinen haben sich lange nicht mehr so gefreut über ein Buch, das auch kulturpolitisch relevant ist,<br />
<strong>und</strong> wir wissen ja, dass die Soziologen bisher die wichtigsten Beiträge zur Reflexionstheorie im<br />
Bereich Kulturpolitik in den letzten Jahren beigesteuert haben, denken wir etwa an Gerhard Schulze<br />
oder Albrecht Göschel. In diese Reihe können wir Reckwitz (auch dank anderer Bücher, die er<br />
publiziert hat) jetzt schon einordnen. Wir werden seinen Gedanken das nächste Heft der<br />
Kulturpolitischen Mitteilung widmen, dort wird auch sein kompletter Vortrag publiziert sein.<br />
Bei diesem „Kreativinfarkt“ – aber das ist meine Zuschreibung – geht es darum, dass wir inzwischen<br />
nicht mehr nur kreativ sein sollen, dass es nicht nur eine bevorzugte Gruppe innerhalb der<br />
Gesellschaft gibt, nämlich die Künstler, die kreativ sind, sondern wir alle sollen, ja müssen inzwischen<br />
kreativ sein. Reckwitz spricht von einem regelrechten „<strong>Kreativität</strong>szwang“, der sich aus einer<br />
Ökonomisierung <strong>und</strong> Medialisierung des Sozialen ergebe, <strong>und</strong> im Gr<strong>und</strong>e genommen kippt jenseits<br />
der Genieästhetik, die ja für den Künstler historisch maßgeblich ist, alles ins Soziale. In allen<br />
Bereichen der Gesellschaft – wir sprechen ja inzwischen von Creative Industries, Creative Cities <strong>und</strong><br />
Körpertechniken bis hin zum durchgestylten, durchtätowierten, gepiercten <strong>und</strong> operativ<br />
umgewandelten Körper –, überall also greifen Ästhetisierungsstrategien. Seit den 1970er Jahren, das<br />
ist seine These, entfalte sich das „<strong>Kreativität</strong>sdispositiv“. Er bedient sich bei seiner Argumentation<br />
eines Machtbegriffes von Foucault <strong>und</strong> wendet ihn so an, so dass wir sagen müssten, „Kultur für alle“<br />
ist vor diesem Hintergr<strong>und</strong> <strong>und</strong> zu Ende gedacht nicht mehr eine Befreiungsbewegung, sondern<br />
lediglich der Ausdruck eines Prinzips im Gewand einer politischen Strategie. Eigentlich ist es nicht<br />
steuerbar, wir agieren lediglich in seiner Wirkungsmacht.<br />
Kulturpolitische Leitformeln wie Soziokultur künden davon, dass das Laienschaffen im Verb<strong>und</strong> mit<br />
dem Profischaffen, die Aufhebung der Distanz zwischen Produktion <strong>und</strong> Rezeption etwas<br />
progressives, emanzipatorisches sei; mit Reckwitz erleben wir eher ein „Regime des Neuen“, die<br />
fortwährende Erfindung neuer Ausdrucksweisen, das Einsickern des „Terrors“ von <strong>Kreativität</strong> in alle<br />
Lebensbereiche, so dass das Ganze auch als ein Infarkt von Gestaltungsansprüchen <strong>und</strong> – eo ipso –<br />
von Kulturpolitik betrachtet werden kann. Man muss dann natürlich fragen, welche Bedeutung<br />
Kulturinstitutionen, die gewachsen sind, bestimmte Zonen von <strong>Kreativität</strong>, die in der Gesellschaft<br />
2
existieren, mit denen wir uns als Kulturpolitikerinnen <strong>und</strong> Kulturpolitiker beschäftigen, dann noch<br />
haben. Werden diese dann obsolet, verändern sich ihre Berechtigung oder Daseinsformen oder ihre<br />
Entwicklungsmöglichkeiten, also wird damit nicht die exklusive Aufgabe von Kulturpolitik, so breit sie<br />
auch immer gestreut sei, gänzlich in Frage gestellt? Ist nicht der erweiterte Kulturbegriff dann eher ein<br />
Symptom, das den Anfang vom Ende von Kulturpolitik bedeutet <strong>und</strong> nicht eine breite Emanzipation?<br />
Also hat dort nicht auch Kulturpolitik versagt oder anders gefragt: hatte sie überhaut eine historische<br />
Chance? <strong>Die</strong>se Fragen könnte man stellen, wobei das <strong>Kreativität</strong>sdispositiv kein Subjekt der<br />
Geschichte ist, wenn man so will, sondern eher eine Dynamik, die entfacht wird durch unterschiedliche<br />
Elemente bis hin zu einem ausgeprägten „ästhetischen Kapitalismus“, wenn es zu einer Verkoppelung<br />
von Vermarktlichung <strong>und</strong> Ästhetisierung kommt.<br />
Ich empfehle Ihnen die Lektüre des Buches sehr <strong>und</strong> will es einmal mit dem <strong>Kulturinfarkt</strong> in eine<br />
Beziehung setzen. Ganz neu sind nicht alle seine Thesen. In Gerhard Schulzes "<strong>Die</strong> beste aller<br />
Welten" zum Beispiel finden wir auch schon das Regime des Neuen, aber wie diese Ästhetisierung<br />
das ganze antreibt, das habe ich bei Reckwitz in dieser Stringenz erstmals gelesen. Man könnte<br />
vielleicht danach fragen, was heute affirmative Kultur heißen kann, die damals von der neuen<br />
Kulturpolitik kritisiert worden ist. Hier ging es darum, Idealismus <strong>und</strong> Weltflucht im Kulturbegriff zu<br />
kritisieren <strong>und</strong> danach zu fragen, wie Kultur auch die Gegenwart verändern, wie sie kritisch <strong>und</strong><br />
lebensnah sein kann. Wenn damals die Kultur als Flucht in den Idealismus affirmativ war <strong>und</strong> damit<br />
keinen realen Wandel unterstützte, ist heute vielleicht diese innerweltliche Auflösung der <strong>Kreativität</strong><br />
eine kritische Zone des Affirmativen, im Sinne des unausweichlichen Erwartungsdrucks, kreativ sein<br />
zu sollen. Bei beiden verfestigt sich ja ein Gesellschaftsbild, in dem ein kritischer Kulturbereich nicht<br />
greifen kann. Insofern könnte man auch von einem „Kreativinfarkt“ sprechen. Das sind aber unfertige<br />
Fragestellungen, die sich mir ergeben haben, denn aus kulturpolitischer Perspektive war ich sowohl<br />
fasziniert als auch erschüttert davon, dass dieses Maß an <strong>Kreativität</strong> uns auch handlungsunfähig<br />
machen kann. Der Foucaultsche Begriff des Dispositivs fasst ja eine prägende Instanz unseres<br />
sozialen Handelns, also Vorbedingungen, während wir uns in der Kulturpolitik auf einer bewussten<br />
Steuerungsebene bewegen. Ein <strong>Kreativität</strong>sdispositiv beschreibt eine Summe von diskurs- <strong>und</strong><br />
handlungsbestimmenden Elementen, die uns formieren, die aber sicher auch bestimmte Formen<br />
politischen Handelns zur Folge haben. Wir befinden uns hier letztlich auf einer<br />
erkenntnistheoretischen Reflexionsebene, die nur bedingt kulturpolitisch verhandelbar ist. Und<br />
dennoch führen die Stringenz des Aufstiegs der <strong>Kreativität</strong> <strong>und</strong> ihr Herauswachsen aus dem System<br />
der Kunst zu elementaren Fragen an die Politik des Kulturellen.<br />
<strong>Die</strong>se beiden Dimensionen verhandeln wir also derzeit. All dies passiert in einer Zeit, in der wir<br />
eigentlich sehr viele Gewissheiten gewonnen haben, was wir mit Kulturpolitik erreichen können. Wir<br />
haben im Gr<strong>und</strong>e genommen in den letzten Jahrzehnten eine neue Fachlichkeit erreicht, etwa mit der<br />
Rede von einer aktivierenden Kulturpolitik, die Strategien sucht, um mit Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürgern ins<br />
Gespräch zu kommen, Konzepte zu entwickeln, Kulturentwicklungspläne – die ersten kommunalen<br />
waren ja etwas ganz Revolutionäres –, <strong>und</strong> auch der obsolete Begriff der Kulturpflege, bei dem man<br />
immer das Gefühl hatte, es gehe um einen Patienten, ist längst vergessen.<br />
II.<br />
Inzwischen verfügen wir auch über ein ausdifferenziertes Kulturmanagement mit unübersehbar vielen<br />
Studiengängen in ganz Deutschland <strong>und</strong> Europa. Ein Kulturmanagement, das sich wirklich wandelt<br />
<strong>und</strong> einen kulturpolitischen Reflexionsrahmen zulässt <strong>und</strong> nicht mehr nur als Werkzeugkoffer für die<br />
Kulturpolitik greift nach dem Motto: das Versagen des Staates <strong>und</strong> der Kommunen helfen wir heilen,<br />
indem wir die adaptierten Instrumente aus der Wirtschaft anbieten. Das wissenschaftliche Verständnis<br />
ist ein anderes geworden, gleichwohl noch immer kritisiert wird – jüngst hörte ich es von Carsten<br />
Winter –, dass eigentlich veraltete Managementinstrumente adaptiert worden seien. Im Kulturbereich<br />
steckt freilich auch die Bertelsmann-Ideologie mit den neuen Steuerungsmodellen. Das kann man<br />
alles kritisch dekonstruieren, was ich jetzt leider nicht vertiefen kann. Aber: im Kern hat sich doch eine<br />
sehr starke Professionalisierung ergeben, die sich etwa umfassend im Bericht der Enquete-<br />
Kommission „Kultur in Deutschland“ widerspiegelt. <strong>Die</strong>ser Bericht ist 2008 erschienen, <strong>und</strong> Oliver<br />
Scheytt, der Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft, hat parallel dazu ein Buch geschrieben<br />
„Kulturstaat Deutschland – Plädoyer für eine aktivierende Kulturpolitik“, in dem er seine Erfahrungen<br />
<strong>und</strong> Erkenntnisse systematisch entwickelt. Dazu gehört zum Beispiel die Vertiefung des neu gefassten<br />
Infrastrukturbegriffs, der die Debatte um eine kulturelle Gr<strong>und</strong>versorgung aufnimmt, das Bewusstsein,<br />
dass zur „Kernausstattung“ mehr dazu gehört, als nur die Kultureinrichtungen, sondern eben auch<br />
kulturelle Bildung, Kulturförderung oder auch Rahmenbedingungen für künstlerisches <strong>und</strong><br />
3
kulturwirtschaftliches Schaffen. Man kann diese nicht gegeneinander aufwiegen. Gerade das<br />
Zusammenspiel von Staat, Markt <strong>und</strong> Zivilgesellschaft, das wir heute als trisektorale Kulturpolitik<br />
bezeichnen, scheint besonders wichtig, wenn es um die Übernahme von Verantwortung in allen<br />
Sektoren <strong>und</strong> Formen der Kooperation oder Lastenteilung geht. Vieles ist heute auf kluge Weise auf<br />
den Begriff <strong>und</strong> auch in ein System gebracht worden, <strong>und</strong> ich habe es zum Beispiel im Kulturkonzept<br />
der Landeshauptstadt Erfurt aufgegriffen <strong>und</strong> gemerkt, dass es in der politischen Debatte nicht so<br />
leicht aufgeknüpft <strong>und</strong> in Frage gestellt werden kann. Mit definitorischer Stringenz <strong>und</strong> konzeptioneller<br />
Kraft kann man schon einiges an Verbindlichkeit schaffen.<br />
Es erscheinen inzwischen fast wöchentlich neue Bücher zum Kultur- <strong>und</strong> Medienmanagement, man<br />
kann das Feld gar nicht mehr beherrschen; ich versuche es immer noch, mir alles zu bestellen <strong>und</strong>,<br />
wo leistbar, auch zu rezensieren, um den Überblick zu behalten. Oliver Scheytt hat in seinem Buch die<br />
ganze Bandbreite des Handels pragmatisch aufgemacht, also vom Kulturbürger (das ist der Nutzer,<br />
wenn man Armin Klein jetzt mal dazu in Beziehung setzt) über die Kulturgesellschaft (das ist all das,<br />
was auf anderer Reflexionsebene zum Beispiel mit dem <strong>Kreativität</strong>sdispositiv thematisiert wird), bis hin<br />
zum Kulturstaat (der vom <strong>Kulturinfarkt</strong> als paternalistischer angegriffen wird). <strong>Die</strong>se gesamte<br />
Bandbreite wird theoretisch <strong>und</strong> mit praktischen Beispielen durchdrungen, <strong>und</strong> es werden die<br />
wesentlichen Felder kulturpolitischen Handelns aufgemacht, die im Gr<strong>und</strong>e genommen durch einen<br />
breiten Konsens auch rückversichert sind. <strong>Die</strong> hitzige Debatte heute lebt dennoch von der Mischung<br />
aus ordnungs-, steuerungs- <strong>und</strong> haushaltspolitischer Zuspitzung <strong>und</strong> – mit Reckwitz – einem<br />
kultursoziologischen Entwurf, für die die als Fachdisziplin bisher noch schwache <strong>und</strong> auf<br />
Interdisziplinarität verwiesene Kulturpolitik gar nicht satisfaktionsfähig reagieren kann, mausert sie sich<br />
doch erst seit wenigen Jahrzehnten zu einem echten Reflexions- <strong>und</strong> Gestaltungsfeld. Viele reagieren<br />
also subjektiv, verteidigend, empört, fasziniert, unsystematisch. In einem Sonderheft der<br />
„Kulturpolitischen Mitteilungen“ haben wir daher versucht, die Debatte etwas zu bündeln.<br />
<strong>Die</strong> Sorge für mehr Verbindlichkeit in der Kultur hat in den letzten Jahren zugenommen. Sie ist<br />
natürlich auch durch rhetorische Behauptungen gekennzeichnet. Ich will einmal Parolen aufzählen, die<br />
das zeigen, die einen hilflos, die anderen mit mehr Biss. Eine ist zum Beispiel, dass man<br />
Kulturausgaben nicht als Subvention, sondern als Investition begreifen soll. Das hat sogar die<br />
B<strong>und</strong>eskanzlerin immer wieder gesagt. Es ändert aber nichts daran, dass die Finanzleute darüber<br />
lachen <strong>und</strong> sagen, Investitionen bedeuten etwas anderes. Wir behaupten dann – wenn es bei<br />
Investitionen darum geht, Kapital zu binden – Kulturausgaben führen dazu, Humankapital zu binden,<br />
also in die Entwicklung der Köpfe zu investieren. Darin drückt sich letztlich dieser aufklärerische<br />
Impetus aus, der ja gerade von den <strong>Kulturinfarkt</strong>autoren in Frage gestellt wird. Ein anderes Beispiel ist<br />
„Kultur für alle“; hier war ja immer die große Kritik, dass man der große Heilsbringer sei <strong>und</strong> nicht<br />
danach fragt, was die Leute wirklich wollen. Manche sagten, es müsse richtigerweise heißen „meine<br />
Kultur für alle“, um den Teilhabegestus auf den Punkt zu bringen.<br />
Oder: die Debatte um „Kultur als Pflichtaufgabe“. Das ist Ihnen auch bekannt, bis hinein in den<br />
Enquete-Bericht beschäftigte uns das Thema intensiv; der Zwischenbericht widmete sich vollständig<br />
der Frage, ob man eine Kulturstaatsklausel im Gr<strong>und</strong>gesetz brauche. Ich meine ja, manche meinen<br />
nein, dritte wiederum sagen, das ist nicht so wichtig, es gebe dringendere Themen. Aber, diese<br />
Pflichtigkeit von Kultur, die Bedeutung kulturverfassungsrechtlicher Dokumente bis hinein ins<br />
Völkerrecht, die wird immer wieder debattiert. Große Verfassungsrechtler wie Peter Häberle zum<br />
Beispiel sprechen sich vehement dafür aus <strong>und</strong> bringen auch kluge Argumentationen. Er hat mit<br />
seinem Buch „Verfassungslehre als Kulturwissenschaft“ gezeigt, wie stark Verfassungen kulturell<br />
aufgeladen sind <strong>und</strong> welche Rolle der Kulturbegriff für das Kulturverfassungsrecht spielt, das ist keine<br />
nur deklaratorische Spielwiese. Aus solchen Debatten können sich konkrete legislative Vorstöße<br />
speisen.<br />
Es gibt ein B<strong>und</strong>esland, das – ausgehend vom innovativen Verfassungsrecht der neuen Länder –<br />
Nägel mit Köpfen machte: Sachsen. Es ist das einzige B<strong>und</strong>esland, das in einem Gesetz niederlegt,<br />
dass Kultur eine Pflichtaufgabe der Kommunen sei <strong>und</strong> dass diese solidarisch von Kommunen <strong>und</strong><br />
Land auch zu finanzieren sei. Das Land gibt jährlich 86,7 Mio. € dafür aus. Peter Rühmkorf hat<br />
natürlich Recht, wenn er sagt, Kultur ist nur eine unmaßgebliche Schutzbehauptung, aber die<br />
Verbindung des besonderen Nimbus, den dieses Gesetz hat, mit den dort aufgezeigten<br />
Verfahrenswegen führt zu echten Debatten <strong>und</strong> guten Entwicklungsplanungen. Am Ende wird erreicht,<br />
dass alle – vor allem die Landkreise – über ihren Tellerrand hinausblicken <strong>und</strong> mit<br />
Strukturentscheidungen größere Zusammenhänge reflektieren <strong>und</strong> berücksichtigen.<br />
4
Der Rahmen verändert sich also, aus Programmformeln werden Systeme, aus Diskursen im besten<br />
Falle rechtliche Flankierungen, <strong>und</strong> aus dem Wissen um notwendiges fachliches Handeln entstehen<br />
Reflexionstheorien, ja neue Lehren. Auf dem Weg dorthin befindet sich das Kulturmanagement, für<br />
das es seit kurzem auch einen Fachverband gibt. Auch gibt es inzwischen eine neue Spezialdisziplin,<br />
die sich mit dem gesamten Komplex von Institutionen im Kulturbereich befasst: die<br />
Kulturbetriebslehre. Ich verweise nur auf das gleichnamige Lehrbuch von Tasos Zembylas aus Wien,<br />
er ist einer, der dieses Gebiet vorangebracht hat. Aber es gibt auch eine ganze Reihe anderer<br />
Forschungsstränge bis hin zu Audience Development, bei dem es darum geht, die Aufmerksamkeit<br />
von Zielgruppen zu binden, sich damit auseinanderzusetzen, wie sich alle Milieus – unsere<br />
Zielgruppen sind ja heterogener denn je – ansprechen lassen <strong>und</strong> wie wir mit der „neuen<br />
Unübersichtlichkeit“ inmitten einer prosperierenden Unterhaltungskultur herkömmliche, aber auch<br />
neue Angebote positionieren können. Es gibt neue Standards, was die „Planbarkeit von Kultur“<br />
anbelangt. Das ist ein Topos, der immer umstritten ist – kann man Kultur wirklich planen? Da sagt<br />
man immer gerne nein, man kann nur die Rahmenbedingungen beeinflussen. Was früher so ein<br />
bisschen hemdsärmelige Kulturentwicklungpläne gewesen sind, das sind heute zum Teil umfassende<br />
Kompendien, an denen Expertengruppen arbeiten, schauen Sie sich allein den<br />
Kulturentwicklungsplan einer vergleichsweise kleinen Stadt wie Brandenburg an der Havel an, da ist<br />
der Kulturentwicklungsplan in zwei Bänden erschienen. Ich frage mich aber, wer von den<br />
Entscheidungsträgern das wirklich bewältigen kann. Aber es ist hervorragend gemacht. Im Vergleich<br />
zu den 70er Jahren haben wir hier eine ganz andere Messlatte. Da hat sich sehr, sehr viel getan, <strong>und</strong><br />
es existiert auch ein sehr lebhafter Diskurs, das heißt, man setzt solche Dokumente in Beziehung<br />
zueinander, man versucht von Praxisbeispielen zu lernen, <strong>und</strong> es wird auch sehr viel publiziert zu<br />
diesem Thema.<br />
Wir haben schließlich, das will ich auch noch als ein Feld der Professionalisierung in den Blickpunkt<br />
rücken, im legislativen Bereich einiges erreicht. <strong>Die</strong> deutsche Einigung gilt dafür als ein ganz<br />
wesentlicher Stimulus, sie hat noch einmal für einen richtigen Schwung gesorgt. Durch den Artikel 35<br />
des Einigungsvertrags, die kulturelle Substanz dürfe keinen Schaden nehmen, ist ja so etwas wie das<br />
sächsische Kulturraumgesetz erst möglich geworden, das natürlich auch ein Zeichen dafür ist, dass<br />
die B<strong>und</strong>esländer ganz andere Aufwendungen für Kultur tätigen müssen, konzeptionell wie finanziell.<br />
Ohne den postulierten Substanzerhalt wäre Sachsen nicht in die Not geraten, neue Modelle der<br />
Lastenteilung zwischen Land <strong>und</strong> Kommunen zu entwickeln. <strong>Die</strong> Kommunen wären nach Auslaufen<br />
der Übergangsfinanzierung Kultur des B<strong>und</strong>es schlicht überfordert gewesen, die Substanz zu<br />
erhalten, es hätte ein Kultursterben in diesem Land mit dichtester kultureller Infrastruktur eingesetzt.<br />
Sachsen-Anhalt <strong>und</strong> Thüringen, die auch sehr dichte Angebotskulissen haben, sind andere Wege<br />
gegangen <strong>und</strong> tun sich schwerer, die Balance zwischen Kommunen <strong>und</strong> Land zu finden. Jedenfalls ist<br />
mit der Einigung ganz viel an Schwung in das föderale Konzert gekommen. Bis auf Baden-<br />
Württemberg hatte ja bis dahin kein B<strong>und</strong>esland ein richtiges Kulturkonzept. Auch heute kann man<br />
teilweise noch große Unterschiede feststellen, aber in der Gesamtbilanz hat sich Landeskulturpolitik<br />
seit dem wesentlich weiter entwickelt, was Sie etwa im Jahrbuch für Kulturpolitik 2012 („Neue<br />
Kulturpolitik der Länder“) sehr gut nachlesen können. <strong>Die</strong> meisten Länder verfügen inzwischen über<br />
kulturpolitische Leitlinien, über Landeskulturkonzepte <strong>und</strong> dergleichen, <strong>und</strong> es gibt eine Reihe von<br />
Spezialgesetzen, die es vorher nicht gegeben hat. Zum Beispiel die Musikschulgesetze in<br />
Brandenburg <strong>und</strong> Sachsen-Anhalt oder Bibliotheksgesetze – Thüringen hat zum Beispiel eines, kein<br />
gutes zwar, aber es hat eines – oder das noch in der Debatte befindliche Kulturfördergesetz in<br />
Nordrhein-Westfalen. Wenn es dort gelingt (auch wenn es nur ein Rahmengesetz, kein<br />
Leistungsgesetz werden sollte), ein Gesetz auf den Weg zu bringen, dann ist das ein Meilenstein für<br />
die Sicherung eines breiten Engagementrahmens für den Staat <strong>und</strong> freilich auch für die Kommunen,<br />
was in Nordrhein-Westfalen eine wichtige Rolle spielt, weil der Kommunalisierungsgrad dort<br />
wesentlich höher ist als beispielsweise in Sachsen durch das Kulturraummodell. Das föderale Konzert<br />
bleibt ein vielstimmiges, ist aber wesentlich solider als vor 1990. Parallel dazu hat sich ja auch der<br />
B<strong>und</strong> gestrafft mit der Behörde des BKM seit 1998, der Wiedereinsetzung eines Kulturausschusses im<br />
B<strong>und</strong>estag oder etwa der Gründung der B<strong>und</strong>eskulturstiftung 2002.<br />
Das sind nur ein paar Beispiele. Es zeigt aber, wir erleben durchaus eine Konjunktur der<br />
wissenschaftlichen Debatten <strong>und</strong> Reflexionstheorien, der kulturpolitisch-interdisziplinären Publizistik<br />
<strong>und</strong> der konzeptionellen Durchdringung des Feldes. Und parallel erleben wir – <strong>und</strong> das führt<br />
wahrscheinlich zu dieser polemischen Zuspitzung von <strong>Kulturinfarkt</strong> <strong>und</strong> Kreativinfarkt – eine<br />
dramatische Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, vor allem die Zuspitzung der<br />
Krise der öffentlichen Haushalte. Meine Stadt, in der ich jetzt arbeite, hat bis heute keinen bestätigten<br />
Haushalt für 2013, also wir befinden uns in der vorläufigen Haushaltsführung. Dabei reden wir über<br />
5
eine Stadt, der es vergleichsweise gut geht, die Perspektiven hat, eine Stadt, die wächst, die<br />
wirtschaftlich prosperiert <strong>und</strong> trotzdem an den massiven Umbau ihrer Infrastruktur denken muss. Was<br />
wir dennoch konstatieren müssen, bei all diesen positiven Entwicklungen einer reflektierten<br />
Kulturpolitik, bei diesem Schub an Professionalisierung, an Austausch, an Anregung: Große<br />
konzeptionelle Entwürfe, die den Namen verdienen, sind nach wie vor eher selten. Es ist nicht so,<br />
dass jedes Konzept, jede kulturpolitische Leitlinie, jeder Gesetzestext, den man einmal entwirft, der<br />
Weisheit letzter Schluss sei. Es gibt noch immer viel zu tun, wenn es um die Überwindung des<br />
Sonntagsredenhabitus gehen soll.<br />
Das Gutgemeinte ist ja nicht immer das Gute. Es wird immer noch zu wenig an wirklicher<br />
Professionalität zugelassen, <strong>und</strong> es gibt zu wenig an Professionalität sowohl in den<br />
Kulturverwaltungen, als auch in Stadträten, in Kreistagen oder Parlamenten. <strong>Die</strong> Kulturpolitiker, die<br />
adäquat ausgebildet sind, die selber wissenschaftlich ein wenig aktiv bleiben, die die Möglichkeiten<br />
haben, zu reisen, zu vergleichen, sich zu engagieren, diese Leute sind sehr, sehr selten. Man kennt<br />
sich in der Regel. Ich bilde mir ein, alle Wesentlichen inzwischen zu kennen <strong>und</strong> bin immer wieder<br />
überrascht, wie wenige wir sind, wenn es darauf ankommt, <strong>und</strong> wie wenige ganz bestimmte Themen<br />
transportieren <strong>und</strong> dann doch die eine oder andere Wirkung erzielen. Das ist dann statistisch<br />
wahrscheinlich über dem Durchschnitt <strong>und</strong> lässt einen freuen. Aber auf der anderen Seite, wenn man<br />
das Aufgabenspektrum sieht, das da vor uns liegt, <strong>und</strong> darüber wird auf Ihrer Tagung zu debattieren<br />
sein, dann ist das auch beängstigend. Da habe ich noch nicht darüber gesprochen, wie es mit der<br />
Durchsetzbarkeit bestimmter Konzepte bestellt ist. Damit kommen wir auf die Ebene der Verfahren<br />
<strong>und</strong> zum Lobbying. Ich will es dabei zunächst bewenden lassen, was die Diagnose anbelangt. Ich<br />
muss auf die Uhr schauen, dass ich nicht ins Trudeln komme. Das kann ich mir heute nicht leisten.<br />
Das jedenfalls sind die großen Eckdaten aus meiner Sicht.<br />
III.<br />
Was heißt das nun für die Praxis, wenn wir über die Möglichkeiten <strong>und</strong> Grenzen konzeptbasierter<br />
Kulturpolitik sprechen wollen? Worum geht es im Detail? Was sind überhaupt Konzepte? Was ist eine<br />
konzeptbasierte Kulturpolitik? Natürlich geht es im Wesentlichen um Kulturentwicklungspläne,<br />
Gesetze oder thematische Konzepte, wie wir sie neuerdings im Bereich der kulturellen Bildung<br />
vielerorts entstehen sehen. Eine Kulturpolitik, die diese Elemente aufgreift <strong>und</strong> damit eine Gr<strong>und</strong>lage<br />
strategischen Handelns schafft, kann man als konzeptbasiert bezeichnen. Dazu gehört freilich auch<br />
die Kommunikation, der Diskurs, der öffentliche Aushandlungsprozess. Aber man muss es noch ein<br />
bisschen präzisieren <strong>und</strong> sagen, dass es um Inhalte, Verfahren, Kommunikation <strong>und</strong> Institutionen<br />
geht, vielmehr um das Zusammenwirken all dieser Elemente. An oberster Stelle steht natürlich immer<br />
die Haltung, oder wie es Carsten Winter gern nennt, intellektuelle Führerschaft. Man möchte über jede<br />
Veränderung, die es gibt, über jedes Szenario Bescheid wissen, man möchte über demografischen<br />
Wandel genauso sicher reden können wie über wirtschaftliche Entwicklungen, über globale<br />
Verflechtungen, die Medialisierung, das Internet, über das kulturelle Gedächtnis, man möchte wissen,<br />
was die UNESCO im Detail macht, worin die Debatten über immaterielles <strong>und</strong> materielles Kulturerbe<br />
wurzeln, über die Konvention kultureller Vielfalt in der Welt, man möchte über die GATS-<br />
Verhandlungen Bescheid wissen <strong>und</strong> dergleichen mehr <strong>und</strong> möchte aus all dem dann eine<br />
intellektuelle Führerschaft generieren <strong>und</strong> sie letztlich in der Debatte so zuspitzen, dass für die<br />
Kulturpolitik im engeren Sinne etwas herauskommt. Das ist eine sehr, sehr große Erwartungshaltung,<br />
weil eben Kulturpolitik noch immer für das große <strong>und</strong> ganze zuständig scheint <strong>und</strong> daraus auch eine<br />
gewisse Schwungkraft gewinnt, das darf man nicht unterschätzen. Ich bin immer schon zufrieden,<br />
wenn es so ist, dass es hinreichend viele Leute gibt, die überhaupt eine Haltung einnehmen, auch<br />
wenn sie nicht gleich die Vision einer post-kapitalistischen Gesellschaft entwickeln, sondern überhaupt<br />
erst einmal eine Haltung zu Kulturfragen einnehmen, <strong>und</strong> nicht nur im engeren Sinne diejenigen, die<br />
für Kulturverwaltung <strong>und</strong> Kulturpolitik zuständig sind, sondern eben auch die Entscheidungsträger,<br />
also Oberbürgermeister, Beigeordneter, Minister, Fraktionsvorsitzende <strong>und</strong> dergleichen, also<br />
diejenigen, die sich an vielen Schnittstellen bewegen <strong>und</strong> eben auch zwischen Haushaltspolitikern <strong>und</strong><br />
Kulturpolitikern, zwischen Jugendhilfe <strong>und</strong> Bildung <strong>und</strong> anderen Themen vermitteln müssen. Das ist<br />
entscheidend.<br />
Damit einher geht natürlich auch – <strong>und</strong> das gehört zur konzeptbasierten Kulturpolitik – der Inhalt, man<br />
braucht eine Programmatik. <strong>Die</strong> ist oft zum Teil rudimentär oder aber die Wiederholung der<br />
immergleichen Floskeln, die wir aus Sonntagsreden kennen. Programmatik ist immer wieder zu<br />
hinterfragen, zu erneuern. Ich bin ein großer Fre<strong>und</strong> nicht einer sehr breiten <strong>und</strong> ausgewalzten<br />
Programmatik, sondern einer zugespitzten, die dann eben das Gegenteil von reiner Verwaltung ist, die<br />
6
vielmehr der Verwaltung Eckpunkte an die Hand gibt, die auch Strategien entwickelt, die nicht gleich in<br />
Konzepte übersetzt werden können, aber überhaupt erst einmal bestimmte Veränderungsprozesse<br />
andenkt <strong>und</strong> auch Beteiligungsprozesse anstrengt, mit den Bürgern debattiert, mit den Nutzern von<br />
Kultur ins Gespräch kommt, überhaupt debattentauglich ist <strong>und</strong> eine öffentliche Wirkung erzielt. Das<br />
ist es ja häufig, was in der kommunalen Kulturpolitik viel zu kurz kommt, weil die Instrumente von<br />
Kulturverwaltung begrenzt sind <strong>und</strong> die politische Aufmerksamkeit von anderen Feldern geb<strong>und</strong>en<br />
wird. Ich habe vorhin mit Volker Külow am Rande ein paar Beispiele debattiert, unkonventionelle<br />
Sachen zu machen, die Leute herauszufordern <strong>und</strong> auch für diejenigen, die nicht die üblichen Nutzer<br />
sind, etwas anzubieten, also durchaus auch plakativ zu sein. Der „<strong>Kulturinfarkt</strong>“ hat das in gewisser<br />
Weise vorbildlich erreicht. Das halte ich für eine ganz wesentliche Dimension, wenn man über<br />
konzeptbasierte Kulturpolitik spricht, denn wenn Kultur ein Thema der Minorität bleibt, was sie ja bei<br />
allem Selbstbewusstsein der Kulturpolitik noch ist, dann kommen wir auch nicht weiter. Man muss die<br />
Kreise größer ziehen.<br />
Wenn man die Inhalte hat <strong>und</strong> die programmatischen Gewissheiten destilliert sowie eine gewisse<br />
Kommunikation darüber, erst dann kommen die Verfahren. Wenn man wirklich anfängt, Konzepte zu<br />
entwickeln, kommunale Kulturkonzepte, Kulturentwicklungspläne, dann auch Beschlüsse herbeiführt<br />
<strong>und</strong> damit auch eine Fachlichkeit sanktioniert, beginnt die Arbeit mit den Instrumenten. Und da ist es<br />
auch gut, wenn Kulturentwicklungspläne über Systematik verfügen <strong>und</strong> nicht nur eine<br />
Aneinanderreihung von programmatischen Positionen wiedergeben. Man muss auch zeigen, wofür<br />
man nicht zuständig ist <strong>und</strong> wo man Änderungen tatsächlich in Gang setzen kann. Mit guten<br />
Konzepten arbeitet man, man entwickelt Umsetzungspläne oder eben Verfahren, um sie in einen<br />
Prozess zu bringen. In Erfurt haben wir das mit einer gleichsam pyramidalen Argumentation versucht.<br />
Wir haben die Kultur von der Kulturverwaltung her gedacht. Das hat manche sehr irritiert. Aber dem<br />
liegt natürlich die Behauptung zu Gr<strong>und</strong>e, dass Kulturpolitik in der Stadt erst einmal nur das sein kann,<br />
was man auch ernsthaft mit Kommunalpolitik verändern kann. Es macht keinen Sinn, mit einem ganz<br />
weiten Portfolio anzufangen <strong>und</strong> in der Umsetzung dann zu merken, dass man dafür eigentlich<br />
überhaupt nicht zuständig ist, dass man gar kein Verfahren zur Hand hat, mit dem man etwas<br />
ausrichten kann. Das finde ich verheerend; es schwächt letztlich das Zutrauen in Kulturpolitik, da sie in<br />
ihrer Machtlosigkeit in ein deklaratorisches Stadium zurücksinkt. Dann ist es doch besser, sehr genau<br />
zu schauen, was kann man wirklich verändern kann, <strong>und</strong> einen wahrnehmbaren konkreten<br />
Veränderungsprozess einzuleiten. Man muss über die Konzepte <strong>und</strong> ihre Gr<strong>und</strong>lagen sehr genau<br />
nachdenken, man muß natürlich auch Lastenteilungen vereinbaren <strong>und</strong> Bündnisse eingehen, also<br />
scheinbare Verluste kommunaler Aufgabenerledigung in neue Modelle übersetzen. Das gehört auch<br />
zu konzeptbasierter Kulturpolitik dazu: beschreiben, was man anderen zumuten kann <strong>und</strong> das<br />
Gesamtsystem in den Blick nehmen. Das Kulturraumgesetz in Sachsen beispielsweise schreibt es ja<br />
regelrecht vor, ein Bündnis zwischen kommunaler Ebene <strong>und</strong> Landesebene einzugehen. Solche<br />
Modelle finde ich immer sehr gut. Bündnisse, Lastenteilungen sind wichtig, freilich nicht nur im<br />
öffentlichen Kulturbereich, sondern auch zwischen öffentlicher Hand <strong>und</strong> anderen Trägern, etwa freigemeinnützigen.<br />
Das Drei-Sektoren-Modell (Staat, Markt, Zivilgesellschaft) bildet ab, in welche<br />
Funktionslogiken die Gesellschaft zerfällt. Trisektorale Kulturpolitik arbeitet, wie schon gesagt, mit<br />
allen drei Sektoren <strong>und</strong> fragt danach, wer welche Aufgaben übernehmen kann <strong>und</strong> wie Kooperationen<br />
gelingen können. Im subsidiären Finanzierungssystem kommt natürlich auch die Kompatibilität der<br />
unterschiedlichen Ebenen ins Spiel, also zwischen Landeskonzepten, Kommunalkonzepten <strong>und</strong><br />
Gesetzen, so vorhanden. Konzeptbasierte Kulturpolitik funktioniert am besten im Zusammenspiel der<br />
Sektoren <strong>und</strong> der Ebenen, aber auch horizontal, also zwischen kommunalen Gebietskörperschaften<br />
oder in der Kooperation einzelner Länder. Im Gr<strong>und</strong>e ist hier auch die Konsistenz des Politikfeldes<br />
Kultur angesprochen, das ja eine freiwillige Aufgabe umreißt <strong>und</strong> relativ regelungsarm ist. Freiwilligkeit<br />
vereitelt aber nicht gemeinsame normative Setzungen.<br />
Zur konzeptionellen Arbeit zählt auch das institutionelle Gefüge jener, die zur Stabilisierung der<br />
Debatte <strong>und</strong> der Dignität öffentlicher Kulturangebote beitragen, etwa Verbände, die funktionsfähig<br />
sind, wie der Deutsche Kulturrat. Beim Deutschen Kulturrat ist es aber leider manchmal so, dass man<br />
nur das Gute an der Kultur verteidigt <strong>und</strong> eine rote Liste vom Aussterben Bedrohter fortschreibt; das<br />
hilft natürlich nur bedingt beim konzeptionellen Umbau. Weil man offiziell nicht schlichtweg gegen<br />
Kultur sein kann, ist Kultur nicht immer <strong>und</strong> überall nur gut; auch hier greift das schon genannte<br />
Rühmkorfsche Diktum von der unmaßgeblichen Schutzbehauptung. Das ist natürlich auch das, was<br />
im <strong>Kulturinfarkt</strong> beklagt wird. Aus dieser Haltung muss man raus. Konzeptbasiertes Arbeiten heißt<br />
immer auch, Dinge methodisch in Frage zu stellen. Und das, das habe ich jetzt in der kommunalen<br />
Praxis selber gelernt, tut natürlich auch weh. Sie kommen freilich an Grenzen der Partizipation, wenn<br />
Sie etwa ein Museum schließen, wenn Sie irgendeine Einrichtung privatisieren wollen, wenn Sie ein<br />
7
Interessenbek<strong>und</strong>ungsverfahren starten <strong>und</strong> sagen, das können andere besser als die eigenen<br />
Mitarbeiter, die es gerade tun. Dann stehen Sie sehr schnell alleine da <strong>und</strong> müssen ihr Konzept gut<br />
begründen, während die politische Ebene gern ihre Partikularinteressen zu entfalten beginnt, um aus<br />
dieser Schwäche Vorteile zu ziehen. Verbände <strong>und</strong> Fachorganisationen sind dann besonders hilfreich,<br />
wenn sie nicht nur verteidigen, sondern eben auch kritikfähig sind <strong>und</strong> Veränderung zulassen.<br />
<strong>Die</strong>ser korporatistische Rahmen, also die Verbandslandschaft, ist ganz wichtig, sie funktioniert<br />
mancherorts sehr gut. Das hat natürlich auch etwas mit der Förderkulisse zu tun. Welches Personal<br />
kann ich mir leisten? In welcher kulturpolitischen Gemengelage bringe ich mich ein? Welches sind die<br />
kulturpolitisch denkenden Köpfe? Aber Vereine, Initiativen, Verbände, also all das, was im<br />
intermediären Bereich zwischen Staat, Markt <strong>und</strong> Zivilgesellschaft passiert, ist unheimlich wichtig, um<br />
Konzepte zu transportieren, um ein Feedback zu bekommen, um auch eine Macht außerhalb von<br />
Verwaltung, außerhalb der unmittelbaren politischen Gestaltbarkeit aufzubauen <strong>und</strong> mit Leuten zu<br />
arbeiten, die letztlich nicht nur Betroffene sind, sondern eben auch ganz wichtige systembildende<br />
Elemente. Da ist man gut beraten, wenn es neben guten Konzepten auch Akteure gibt, die sich<br />
beteiligen, die ein Motor sind für eine Debatte. <strong>Die</strong>se sind vielerorts rar, besonders in Ostdeutschland.<br />
Der wissenschaftliche Anspruch ist natürlich auch ein wichtiges Element. Sie können keine guten<br />
Konzepte machen, wenn Sie niemanden haben, der es kann, wenn Sie niemanden bezahlen wollen<br />
oder können, der extern auch einmal einen anderen Blick einnimmt, der nicht der eigene ist. Ich<br />
beobachte, dass b<strong>und</strong>esweit da, wo zum Beispiel Leute wie Patrick Föhl aktiv gewesen sind,<br />
konzeptionelles Niveau entsteht. Er bringt natürlich das ganze Vergleichswissen aus anderen<br />
Regionen <strong>und</strong> Projekten mit, ob das in Dessau-Roßlau ist oder in Wittenberge. Er ist auf<br />
unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Es gibt eine Reihe von solchen Leuten, aber es sind auch nicht<br />
viele, man kennt sie inzwischen fast alle schon. Solche Expert/innen sind wichtig, weil sie nicht nur<br />
eine Expertise mitbringen, sondern die Akteure vor Ort unterstützen, ihnen neue Perspektiven<br />
eröffnen <strong>und</strong> den Rücken stärken. Man ist am Anfang, wenn man eine neue Aufgabe beginnt, immer<br />
besonders glaubhaft, weil man noch den Nimbus des Fremden trägt. Je länger man da ist, desto mehr<br />
wird man verändert, vereinnahmt, bekommt seinen Platz im Getriebe. Man erwirbt letztlich selber den<br />
Habitus dessen, der voll dazu gehört <strong>und</strong> wird dann rasch zum Nestbeschmutzer, wenn man<br />
Änderungen anstrebt. Auch die Distanz zu den eigenen Mitarbeitern nimmt ja beständig ab, je länger<br />
man da ist, desto stärker beginnt es zu menscheln. <strong>Die</strong>se Gefahr ist immer vorhanden <strong>und</strong> auch ganz<br />
natürlich. Hinzu kommt die Unbeweglichkeit des Öffentlichen <strong>Die</strong>nstes. Ein Externer kann da viel<br />
ausrichten <strong>und</strong> ist ein Korrektiv.<br />
Ich möchte noch etwas über die Grenzen des Ganzen, was Sie heute näher verhandeln wollen,<br />
sagen. <strong>Die</strong> Möglichkeiten des konzeptionell-fachlichen Handelns <strong>und</strong> was konzeptbasierte Kulturpolitik<br />
heißt, habe ich an einigen Beispielen versucht zu verdeutlichen. <strong>Die</strong> Grenzen liegen in einem<br />
ungeheuren Traditionalismus; egal, welche politische Partei sich in der Verantwortung befindet, wer in<br />
den Institutionen wirkt, jeder hat es gerne, wenn viel von dem weitergeht, was es gibt, woran man sich<br />
gewöhnt hat. Jeder Oberbürgermeister, jeder Minister ist dankbar, wenn er keine Briefe bekommt, in<br />
denen Leute sich beschweren <strong>und</strong> protestieren, wo irgend etwas durchargumentiert werden muss,<br />
was der/die Leser/in doch wieder durch seine/ihre subjektive Brille sehen wird. Es gibt eine gewisse<br />
natürliche Reformresistenz. „Das war schon immer so“, heißt es dann. Statt eines Arguments hört man<br />
über das eigene Handeln der Leute: „Das haben wir schon immer so gemacht.“ Das Wissen ist<br />
verloren gegangen, warum bestimmte Dinge einmal auf bestimmte Weise etabliert wurden, der Blick<br />
für Veränderung ist trübe geworden. Es gibt einen stillschweigenden Traditionalismus oder<br />
Konservatismus, wie immer man das nennen will. Es gibt auch ein Welterbegefühl, eine<br />
Pathosneigung für die Kulissen, die wir haben. Manches können wir uns aber auch nicht aussuchen.<br />
Es gibt ein echtes Problem: Burgen, Schlösser, historische Parks <strong>und</strong> dergleichen, die kann man nicht<br />
wegtragen, auch wenn es nur ein paar Kilometer bis zur Landesgrenze sind. Hier in Berlin hat man<br />
zwar mal ein Gebäude umgesetzt, am Potsdamer Platz, aber bis über die Landesgrenze hat es auch<br />
noch keiner geschafft. Aber man wünschte sich manchmal, dass man es könnte. Burgen, ich habe<br />
auch zwei in meinem Verantwortungsbereich, die würde ich gerne nach Brandenburg geben zum<br />
Beispiel. Gute Konzepte scheitern, das will ich damit sagen, auch an objektiven Gegebenheiten, an<br />
der Verwaltung schwieriger Immobilien oder anderweitiger Aufgaben. Der Fluss der Zeit hinterlässt<br />
Sedimente. Aber manche lassen sich auch verändern.<br />
Es ist ein Problem, dieses Welterbegefühl, im Theaterbereich begegnet es uns es mit dem Slogan<br />
„Theater muss sein“, das Stadttheatersystem als Weltkulturerbe, das finde ich höchst problematisch.<br />
Dann gibt es auf der anderen Seite eine mangelnde Durchsetzungsfähigkeit für große<br />
8
Strukturveränderungen, weil die Leute Angst haben, dass ihnen alles genommen werde. Der massive<br />
Eingriff ist immer das Argument, es lieber gar nicht anzupacken, bevor wir etwas gänzlich falsch<br />
machen. <strong>Die</strong>se Haltung korrespondiert freilich auch mit dem, was man lokale oder regionale Identität<br />
nennt. Ob es sinnvoll ist, ob es finanzierbar ist, ob es zukunftsfähig ist oder nicht, ob da Leute<br />
hingehen oder nicht, man kennt es halt <strong>und</strong> es gehört irgendwie dazu. Wir haben in Erfurt eine kleine<br />
museale Gedenkstätte, da geht kaum einer hin. Aber sobald Sie sie zumachen wollen, geht die Welt<br />
unter. Das sagt jetzt nichts über die Qualität dessen, was dort vorgehalten <strong>und</strong> wie es gepflegt wird,<br />
sondern nur über die gesellschaftliche Resonanz. <strong>Die</strong>se ist aber eine (nicht die einzige) Kategorie,<br />
wenn es um das Maß an Erinnern <strong>und</strong> Bewahren geht, um das Betreiben authentischer Orte.<br />
Und es gibt, das will ich vielleicht abschließend als ein Beispiel für Grenzen nennen, einen Wildwuchs<br />
in der Entstehung auch neuer Einrichtungen. Das wird im <strong>Kulturinfarkt</strong> ebenfalls beklagt. Es ist dies<br />
eine Debatte, die uns eigentlich schon so lange beschäftigt, wie die öffentliche Hand höfisches <strong>und</strong><br />
bürgerliches Erbe übernommen <strong>und</strong> weiterentwickelt hat. Ich habe es vor allem in den neuen Ländern<br />
nach der politischen Wende beobachtet, wo alle Angst vor Verlusten hatten; vielerorts ist das<br />
Gegenteil der Fall: ein Aufwuchs an kleinen Museen, an Gedenkstätten, natürlich in Bereichen, die<br />
vorher so nicht verhandelbar waren, Schulmuseen, bestimmte Gedenkstätten, Orte im Bereich<br />
Industrie- <strong>und</strong> Technikgeschichte infolge der flächengreifenden Deindustrialisierung. Am Anfang sind<br />
es die Ehrenamtlichen, <strong>und</strong> irgendwann gibt dann die Gemeinde Geld dazu, irgendwann findet es in<br />
die Förderung, weil man es aus bestimmten Gründen den Kollegen nicht ausschlagen kann, <strong>und</strong> dann<br />
wächst eben das, was im <strong>Kulturinfarkt</strong> als Subventionsschleife bezeichnet wird. Das ist ein großes<br />
Problem, zumal zahlreiche Einrichtungen in einem prekären Status betrieben werden <strong>und</strong> in diesem<br />
dauerhaft verbleiben.<br />
Das heißt, wir brauchen Konzepte, Gesetze, Verfahren <strong>und</strong> Kommunikationsstrategien, um ein<br />
Denken in größeren räumlichen, zeitlichen <strong>und</strong> trägerkritischen Zusammenhängen zu ermöglichen,<br />
um den Zufall zu bremsen, mit Gewohnheiten zu brechen, um die eigenen Denkfiguren <strong>und</strong><br />
Argumentationsmuster zu hinterfragen. Das ist nicht immer leicht. Es wird gerne behauptet, die alten<br />
Leitformeln seien auch die neuen: Kultur für alle! Damit ist es aber, glaube ich, nicht getan. Man muss<br />
sie schon auch neu interpretieren, kritisch wenden, man muss sie mit Zukunftsbildern in Verbindung<br />
bringen <strong>und</strong> auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigen, was die Wirkung solcher<br />
Slogans wirklich ist. Wenn ich dann Andreas Reckwitz zum Beispiel lese oder Carsten Winter, merke<br />
ich die Dringlichkeit einer Revision <strong>und</strong> Reformulierung von Programmatik. Natürlich reformulieren<br />
sich Formeln auch durch den Wandel im Begriffsgebrauch. So ist es etwa mit dem Kulturstaat, der<br />
heute mehrheitlich für ein positives Bild eines kulturell wachen <strong>und</strong> zuständigen Staates steht <strong>und</strong><br />
nicht für die Vereinnahmung mit Sinn. Dazu hatte ich mit Max Fuchs einmal eine Debatte, die Sie in<br />
den „Kulturpolitischen Mitteilungen“ nachlesen können. Begriffsarbeit ist ganz wichtig, doch was<br />
können die Begriffe dafür, dass wir mit ihnen schlecht umgehen? Sie werden immer neu aufgeladen<br />
oder neu belebt. Sie tragen jedoch auch ihre semantischen Hypotheken mit sich <strong>und</strong> fordern Umsicht<br />
ein. Aber wenn man Slogans <strong>und</strong> Programmatik nur weiter trägt, wenn man sie nicht beständig neu<br />
füllt mit einer Debatte, die auch wirklich trägt, dann bekommen wir Leerformeln. Das greift der<br />
<strong>Kulturinfarkt</strong> ja an, dass wir vielleicht zu stark den Begriffen vertraut haben <strong>und</strong> unsere Praxis zu<br />
unkritisch hinnehmen, die wir mit diesen Begriffen fassen. Konzeptbasierte Kulturpolitik, hat eine<br />
Chance, ein Motor von Veränderungsprozessen zu sein, wenn sie wirklich systematisch greift. Das<br />
wünsche ich mir sehr, <strong>und</strong> ich wünsche Ihrer Debatte, dass Sie dafür Beispiele finden, bis in die<br />
Kulturförderung hinein, auf die ich jetzt gar nicht eingegangen bin. Vielen Dank!<br />
Nachfragen zum Referat <strong>und</strong> Antworten von <strong>Tobias</strong> J. <strong>Knoblich</strong><br />
Dr. Annette Mühlberg: <strong>Tobias</strong>, wenn Du bitte noch einen Moment hier vorne bei mir bleiben könntest.<br />
Vielen Dank, lieber <strong>Tobias</strong>. Wir haben ja das Problem, dass Du uns in zehn Minuten verlassen musst.<br />
Deshalb frage ich jetzt einfach ins Publikum, ob es unmittelbare Nachfragen an den Referenten gibt.<br />
Wir haben dann, mit dem folgenden Podium <strong>und</strong> noch den ganzen Tag Zeit, die Dinge zu vertiefen.<br />
Und wir werden uns ja mindestens zum kulturpolitischen B<strong>und</strong>eskongress am 13. <strong>und</strong> 14. Juni wieder<br />
begegnen <strong>und</strong> weiter diskutieren. Dennoch jetzt die Frage an das Publikum, ob jemand von Ihnen<br />
unmittelbar Nachfragen an den Referenten hat. Und bitte den Namen sagen.<br />
Ulrich Wilke: Ich möchte mal die Gelegenheit nutzen, dass wir einen Erfurtkenner hier haben. Wie<br />
geht es denn den Theatern in Erfurt <strong>und</strong> Weimar. Sind die noch eigenständig?<br />
9
<strong>Tobias</strong> J. <strong>Knoblich</strong>: Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht gleich auf die Abschussliste komme,<br />
denn das ist eine regionale Glaubensfrage! Sie sind noch eigenständig. Wollen Sie auch hören, was<br />
ich dazu meine? Es ist immer ein heikler Punkt, sich mit dem Deutschen Nationaltheater in Weimar<br />
anzulegen <strong>und</strong> mit all dem, was dort an Beharrungsvermögen entfaltet worden ist, um diese Institution<br />
zu stabilisieren. Dass man in Erfurt vor zehn Jahren ein neues Theater gebaut hat, eines der<br />
modernsten, das wir in Deutschland haben, aber keine Schauspielsparte mehr drin ist, wirft natürlich<br />
Fragen auf. Auch bleibt immer wieder der kritische Kommentar, ob es sein müsse, 20 km von Weimar<br />
entfernt eine eigene Institution zu betreiben, ob das nicht nur Symbolpolitik ist. Natürlich gibt es auch<br />
in Erfurt eine gewisse Tradition, aber nicht eine solche wie in Weimar. Ich würde mir eine ehrliche,<br />
pragmatische <strong>und</strong> verantwortungsvolle Debatte über die Theater- <strong>und</strong> Orchesterstruktur in ganz<br />
Thüringen wünschen. Jeder weiß, dass wir so nicht zukunftsfähig sind. <strong>Die</strong> Kommunen können das<br />
Problem nur lösen, wenn es eine umfassende Strategie gibt, die politisch auch durchgehalten werden<br />
kann. <strong>Die</strong> ist leider nicht in Sicht. Erfurt steht natürlich zu seinem Theater, aber ich kann mir auch<br />
alternative Konstellationen vorstellen, da wir mit den Kosten kaum noch zurande kommen. Und<br />
darunter leiden alle anderen Akteure im Kulturbereich, von den Museen bis zu den freien<br />
Kulturträgern. Besonders schade ist, dass der Freistaat Thüringen sein neues Landeskulturkonzept<br />
nicht genutzt hat, das Thema offensiv anzugehen. Das wäre eine große Chance gewesen.<br />
Alexander Pinto: Sie sind in Ihrem Vortrag auf das Dreisektorenmodell Staat, Markt, Zivilgesellschaft,<br />
oder intermediären Sektor, eingegangen. Bernd Wagner hat mal analysiert, dass sich Kulturpolitik,<br />
insbesondere der Staat von einem etatistischen zu einem pluralistischen Akteur entwickelt <strong>und</strong> sich<br />
eigentlich selber zu einer intermediären Instanz entwickelt. Insofern würde sich ja theoretisch dieses<br />
Dreisektorenmodell verschieben, vom Staat bzw. der Öffentlichen Hand hin zu einem intermediären<br />
Akteur. Sehen Sie ähnliche Entwicklungen <strong>und</strong> wie wirkt sich das beispielsweise auf konzeptbasierte<br />
Kulturpolitik aus?<br />
<strong>Tobias</strong> J. <strong>Knoblich</strong>: Was Bernd Wagner gezeigt hat, ist eigentlich eine Verflüssigung, die da<br />
stattfindet. Ich glaube, das zeigen auch Begriffe wie Gewährleistungsstaat oder<br />
Gewährleistungskommune: man macht nicht mehr alles selber, sondern überträgt oder überlässt<br />
anderen bestimmte Aufgaben. Hinzu kommt, dass natürlich die Akteure selbst auch zwischen diesen<br />
Sektoren zirkulieren. Es ist ja nicht so, dass alle sich immer in einem Sektor aufhalten <strong>und</strong> dort aktiv<br />
sind, sondern da gibt es eine zunehmende Mobilität, wenn man so will, <strong>und</strong> das ist eigentlich ein<br />
wünschenswerter Prozess. Das Dreisektorenmodell ist ja ein idealtypisches, die Sektoren sind nicht<br />
abgegrenzt. Kulturpolitik ist nicht nur etwas für die Öffentliche Hand, sondern gerade im freigemeinnützigen<br />
Bereich ist unheimlich viel an Kultur gewachsen, ebenso in der Privatwirtschaft, die<br />
sogar das Hauptwachstumsfeld darstellt (Kultur- <strong>und</strong> Kreativwirtschaft). Trotzdem sehe ich die<br />
öffentliche Hand nicht nur als intermediären Akteur, es wird auch künftig darauf ankommen, zwischen<br />
Etatismus <strong>und</strong> Liberalismus Mischformen zu finden. Für die konzeptbasierte Arbeit ist dies natürlich<br />
interessant, weil es Möglichkeiten der alternativen Betreibung von Einrichtungen eröffnet. Dennoch<br />
muss man auch sehen, dass jeder Sektor seine Eigenlogik hat. Auf dem Feld der Kultur- <strong>und</strong><br />
Kreativwirtschaft <strong>und</strong> der angesprochenen Teilmärkte sind die Regionen zudem sehr unterschiedlich<br />
bestückt; ich kann keine Maßnahmen von oben <strong>und</strong> für alle generieren, sondern bin auf regionale<br />
Konzepte angewiesen.<br />
Konstanze Kriese: <strong>Die</strong> Frage schließt eigentlich unmittelbar an. Es ist ja in der europäischen <strong>und</strong><br />
dann speziell in der deutschen Kulturtradition, das kulturstaatliche Denken sehr groß, ist ein lange<br />
gewachsenes. Das wonach ich frage ist: Wenn über neue Kulturplanungs-,<br />
Kulturfinanzierungsmodelle nachgedacht wird - <strong>und</strong> wir hatten das Dreisektorenmodell im Gespräch -<br />
wird, wenn man auf den freigemeinnützigen Sektor kuckt, denn wirklich konsequent in neuen<br />
Planungsmodellen oder neuen Kulturfinanzierungsmodellen darüber nachgedacht, dass die Akteure in<br />
diesem freien Bereich, dann auch wirklich divergieren können. Denn es ist irgendwie immer dieses<br />
uralte Problem bis heute, dass eine Gruppe eine Finanzierung für ein Projekt erhalten hat, das aber<br />
eine Subventionsfinanzierung war <strong>und</strong> wenn sie dann irgendwie in einen Marktbereich diff<strong>und</strong>ieren es<br />
schnell heißt, dass sie irgendwie nicht mehr kritische Kulturleute sind, nicht mehr kreativ sind <strong>und</strong> so<br />
weiter. Sie stehen sogar eventuell bis in gesetzlichen Problematiken einer Rückzahlsituation<br />
gegenüber oder dergleichen. Das ist ein uraltes Problem, aber es wird nie angegangen. Ich habe<br />
immer das Gefühl, dass Diff<strong>und</strong>ieren funktioniert nicht. Da sage ich mir immer, kuckt man auf die alten<br />
amerikanischen Modelle, wo ja viele hingewandert sind aus Europa <strong>und</strong> bringe immer das Uraltmodell<br />
Lorey Andersen, 10 Jahre gefördert vom Council of Art, aber dann eine erfolgreiche kommerzielle<br />
Künstlerin <strong>und</strong> keiner, weil es eine andere Kulturtradition ist, regt sich dort darüber auf. Hier wird sich<br />
über so etwas aber gr<strong>und</strong>sätzlich aufgeregt <strong>und</strong> es wird diesen Akteuren abgesprochen, dass sie<br />
10
weiterhin kritische Kulturleute sind. Das Diff<strong>und</strong>ieren wird irgendwie nicht ermöglicht. Wird es<br />
inzwischen im konzeptionellen Denken oder im Verfahrensdenken ermöglicht? Das ist meine Frage.<br />
<strong>Tobias</strong> J. <strong>Knoblich</strong>: Das ist ja schon eher ein Kommentar. Sie haben vieles schon gesagt. Es ist eher<br />
eine Einstellungsfrage. Wie verhält man sich zu den Leuten, die aus dem subventionierten Bereich<br />
rausgehen, die also nicht rückzahlbare Zuschüsse, wie es immer so schön heißt, in Anspruch nehmen<br />
<strong>und</strong> zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, wir verzichten jetzt darauf. So etwas ist natürlich auch<br />
möglich. Ich kann mich natürlich entwickeln <strong>und</strong> auf weniger Förderung zugreifen, weil ich mehr selbst<br />
erwirtschafte. <strong>Die</strong>s ist eine Gratwanderung, gerade wenn Sie in einem Verein sind: wie viel<br />
wirtschaftliches Engagement ist da möglich, da muss man den richtigen Punkt finden, wo man<br />
abspringt. Das funktioniert schon. Aber dass es jetzt eine regelrechte Strategie gibt, wie man da<br />
Übergänge schafft, das bezweifle ich. Das kenne ich zumindest nicht. Wir kennen zumindest Ansätze.<br />
In Thüringen etwa gibt es eine Agentur für die Kreativwirtschaft, die aber von vornherein eher neue<br />
Geschäftsmodelle unterstützt, also diejenigen abholt, die wirklich von ihren kreativen Ideen leben<br />
wollen, die nicht in den frei-gemeinnützigen Bereich wollen oder aus diesem kommen <strong>und</strong> sagen, mit<br />
meinen Produkten kann ich auch am Markt bestehen. Aber da ist ein gewisser Mentalitätsunterschied<br />
vorhanden. Der bleibt natürlich. Das ist ein Problem auch der institutionellen Förderung. Es gibt ja<br />
viele im Bereich der Soziokultur (West), die am Anfang gar kein staatliches Geld wollten, dann aber<br />
große Hütten ausgebaut haben <strong>und</strong> so richtig in diesem subventionierten Bereich drin sind <strong>und</strong> sich,<br />
ich sage es mal ein bisschen bösartig, das trifft auch andere Bereiche, sich eingenistet haben. Das<br />
sagt jetzt nichts über ihren Erfolg oder Misserfolg aus. Aber, mit so einer Institution einen<br />
Mentalitätswandel vorzunehmen <strong>und</strong> zu sagen, ab morgen gibt es kein öffentliches Geld mehr <strong>und</strong> wir<br />
gehen an den Markt, das stößt nicht nur an Einstellungsgrenzen, sondern freilich auch an Grenzen<br />
der Geschäftspolitik, des Steuerrechts u. ä. Sie können nicht alles plötzlich verkaufen, nicht alles<br />
funktioniert, <strong>und</strong> da eine Mischung hinzukriegen <strong>und</strong> zu sagen, ich bin jetzt mal so ein bisschen<br />
Kulturwirtschaft <strong>und</strong> so ein bisschen eigenwirtschaftlich in derselben Institution, das ist ein juristisches<br />
Problem, das ist ein Problem der Gemeinnützigkeit <strong>und</strong> solcher Fragestellungen. Das ist schwierig. Je<br />
größer, je stärker institutionalisiert ein Akteur ist, desto schwerer fällt es ihm freilich auch, einen<br />
Wandel durchzuführen. Leichter ist es eher für die Individuen; wenn ich Künstler bin, da kann ich im<br />
Theater angestellt sein, ich kann bei einem freien Theater etwas machen <strong>und</strong> ich kann bei einem<br />
privaten Theater meine <strong>Die</strong>nstleistung oder meine Arbeitskraft verkaufen (wenn wir jetzt schon bei den<br />
LINKEN sind: am Markt als doppelt freier Lohnarbeiter). Das geht alles. Aber ein Generalmodell, das<br />
sich da jetzt auftut, das sehe ich nicht.<br />
Dr. Annette Mühlberg: Ich bedanke mich bei Dir, dass Du hier warst, uns einen anregenden Vortrag<br />
gehalten hast. Wir sehen uns. Wir sind ja ein kleiner Kreis, Du hast ja Recht. Wir diskutieren weiter.<br />
Vielen, vielen Dank.<br />
11