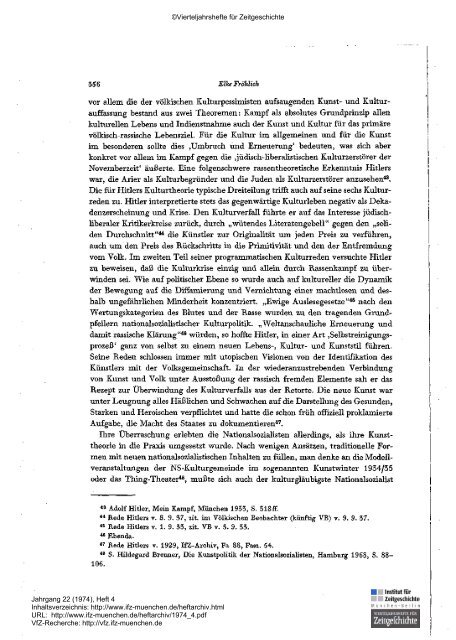Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte - Institut für Zeitgeschichte
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte - Institut für Zeitgeschichte
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte - Institut für Zeitgeschichte
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
356 Elke Fröhlich<br />
vor allem die der völkischen Kulturpessimisten aufsaugenden Kunst- und Kulturauffassung<br />
bestand aus zwei Theoremen: Kampf als absolutes Grundprinzip allen<br />
kulturellen Lebens und Indienstnahme auch der Kunst und Kultur <strong>für</strong> das primäre<br />
völkisch-rassische Lebensziel. Für die Kultur im allgemeinen und <strong>für</strong> die Kunst<br />
im besonderen sollte dies ,Umbruch und Erneuerung' bedeuten, was sich aber<br />
konkret vor allem im Kampf gegen die ,jüdisch-liberalistischen Kulturzerstörer der<br />
Novemberzeit' äußerte. Eine folgenschwere rassentheoretische Erkenntnis Hitlers<br />
war, die Arier als Kulturbegründer und die Juden als Kulturzerstörer anzusehen 43 .<br />
Die <strong>für</strong> Hitlers Kulturtheorie typische Dreiteilung trifft auch auf seine sechs Kulturreden<br />
zu. Hitler interpretierte stets das gegenwärtige Kulturleben negativ als Dekadenzerscheinung<br />
und Krise. Den Kulturverfall führte er auf das Interesse jüdischliberaler<br />
Kritikerkreise zurück, durch „wütendes Literatengebell" gegen den „soliden<br />
Durchschnitt" 44 die Künstler zur Originalität um jeden Preis zu verführen,<br />
auch um den Preis des Rückschritts in die Primitivität und den der Entfremdung<br />
vom Volk. Im zweiten Teil seiner programmatischen Kulturreden versuchte Hitler<br />
zu beweisen, daß die Kulturkrise einzig und allein durch Rassenkampf zu überwinden<br />
sei. Wie auf politischer Ebene so wurde auch auf kultureller die Dynamik<br />
der Bewegung auf die Diffamierung und Vernichtung einer machtlosen und deshalb<br />
ungefährlichen Minderheit konzentriert. „Ewige Auslesegesetze" 45 nach den<br />
Wertungskategorien des Blutes und der Rasse wurden zu den tragenden Grundpfeilern<br />
nationalsozialistischer Kulturpolitik. „Weltanschauliche Erneuerung und<br />
damit rassische Klärung" 46 würden, so hoffte Hitler, in einer Art ,Selbstreinigungsprozeß'<br />
ganz von selbst zu einem neuen Lebens-, Kultur- und Kunststil führen.<br />
Seine Reden schlossen immer mit utopischen Visionen von der Identifikation des<br />
Künstlers mit der Volksgemeinschaft. In der wiederanzustrebenden Verbindung<br />
von Kunst und Volk unter Ausstoßung der rassisch fremden Elemente sah er das<br />
Rezept zur Überwindung des Kulturverfalls aus der Retorte. Die neue Kunst war<br />
unter Leugnung alles Häßlichen und Schwachen auf die Darstellung des Gesunden,<br />
Starken und Heroischen verpflichtet und hatte die schon früh offiziell proklamierte<br />
Aufgabe, die Macht des Staates zu dokumentieren 47 .<br />
Ihre Überraschung erlebten die Nationalsozialisten allerdings, als ihre Kunsttheorie<br />
in die Praxis umgesetzt wurde. Nach wenigen Ansätzen, traditionelle Formen<br />
mit neuen nationalsozialistischen Inhalten zu füllen, man denke an die Modellveranstaltungen<br />
der NS-Kulturgemeinde im sogenannten Kunstwinter 1934/35<br />
oder das Thing-Theater 48 , mußte sich auch der kulturgläubigste Nationalsozialist<br />
43<br />
Adolf Hitler, Mein Kampf, München 1933, S. 318 ff.<br />
44<br />
Rede Hitlers v. 8. 9. 37, zit. im Völkischen Beobachter (künftig VB) v. 9. 9. 37.<br />
45<br />
Rede Hitlers v. 1. 9. 33, zit. VB v. 3. 9. 33.<br />
46<br />
Ebenda.<br />
47<br />
Rede Hitlers v. 1929, IfZ-Archiv, Fa 88, Fasz. 54.<br />
48<br />
S. Hildegard Brenner, Die Kunstpolitik der Nationalsozialisten, Hamburg 1963, S. 88-<br />
106.