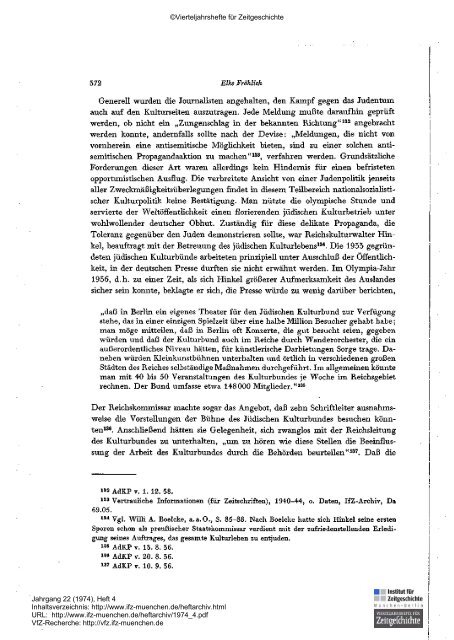Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte - Institut für Zeitgeschichte
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte - Institut für Zeitgeschichte
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte - Institut für Zeitgeschichte
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
372 Elke Fröhlich<br />
Generell wurden die Journalisten angehalten, den Kampf gegen das Judentum<br />
auch auf den Kulturseiten auszutragen. Jede Meldung mußte daraufhin geprüft<br />
werden, ob nicht ein „Zungenschlag in der bekannten Richtung" 132 angebracht<br />
werden konnte, andernfalls sollte nach der Devise: „Meldungen, die nicht von<br />
vornherein eine antisemitische Möglichkeit bieten, sind zu einer solchen antisemitischen<br />
Propagandaaktion zu machen" 133 , verfahren werden. Grundsätzliche<br />
Forderungen dieser Art waren allerdings kein Hindernis <strong>für</strong> einen befristeten<br />
opportunistischen Ausflug. Die verbreitete Ansicht von einer Judenpolitik jenseits<br />
aller Zweckmäßigkeitsüberlegungen findet in diesem Teilbereich nationalsozialistischer<br />
Kulturpolitik keine Bestätigung. Man nützte die olympische Stunde und<br />
servierte der Weltöffentlichkeit einen florierenden jüdischen Kulturbetrieb unter<br />
wohlwollender deutscher Obhut. Zuständig <strong>für</strong> diese delikate Propaganda, die<br />
Toleranz gegenüber den Juden demonstrieren sollte, war Reichskulturwalter Hinkel,<br />
beauftragt mit der Betreuung des jüdischen Kulturlebens 134 . Die 1933 gegründeten<br />
jüdischen Kulturbünde arbeiteten prinzipiell unter Ausschluß der Öffentlichkeit,<br />
in der deutschen Presse durften sie nicht erwähnt werden. Im Olympia-Jahr<br />
1936, d.h. zu einer Zeit, als sich Hinkel größerer Aufmerksamkeit des Auslandes<br />
sicher sein konnte, beklagte er sich, die Presse würde zu wenig darüber berichten,<br />
„daß in Berlin ein eigenes Theater <strong>für</strong> den Jüdischen Kulturbund zur Verfügung<br />
stehe, das in einer einzigen Spielzeit über eine halbe Million Besucher gehabt habe;<br />
man möge mitteilen, daß in Berlin oft Konzerte, die gut besucht seien, gegeben<br />
würden und daß der Kulturbund auch im Reiche durch Wanderorchester, die ein<br />
außerordentliches Niveau hätten, <strong>für</strong> künstlerische Darbietungen Sorge trage. Daneben<br />
würden Kleinkunstbühnen unterhalten und örtlich in verschiedenen großen<br />
Städten des Reiches selbständige Maßnahmen durchgeführt. Im allgemeinen könnte<br />
man mit 40 bis 50 Veranstaltungen des Kulturbundes je Woche im Reichsgebiet<br />
rechnen. Der Bund umfasse etwa 148000 Mitglieder." 135<br />
Der Reichskommissar machte sogar das Angebot, daß zehn Schriftleiter ausnahmsweise<br />
die Vorstellungen der Bühne des Jüdischen Kulturbundes besuchen könnten<br />
136 . Anschließend hätten sie Gelegenheit, sich zwanglos mit der Reichsleitung<br />
des Kulturbundes zu unterhalten, „um zu hören wie diese Stellen die Beeinflussung<br />
der Arbeit des Kulturbundes durch die Behörden beurteilen" 137 . Daß die<br />
132<br />
AdKP v. 1. 12. 38.<br />
133<br />
Vertrauliche Informationen (<strong>für</strong> Zeitschriften), 1940-44, o. Daten, IfZ-Archiv, Da<br />
69.05.<br />
134<br />
Vgl. Willi A. Boelcke, a.a.O., S. 85-88. Nach Boelcke hatte sich Hinkel seine ersten<br />
Sporen schon als preußischer Staatskommissar verdient mit der zufriedenstellenden Erledigung<br />
seines Auftrages, das gesamte Kulturleben zu entjuden.<br />
135<br />
AdKP v. 13. 8. 36.<br />
136 AdKP v. 20. 8. 36.<br />
137 AdKP v. 10. 9. 36.